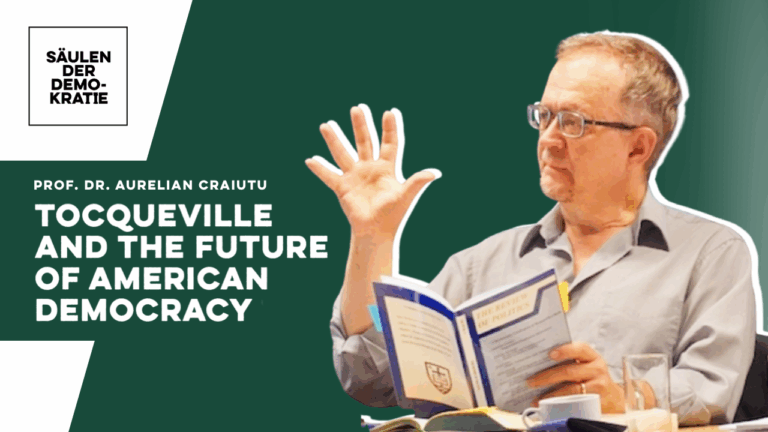Demokratie und Expertise
von Lisa Herzog (Universität Groningen)
„People have had enough of experts!” Dieser Spruch aus dem Brexit-Wahlkampf wird häufig zitiert, wenn es darum geht, dass Bürger*innen dem Einfluss von Expert*innen auf die Politik misstrauen. Aber ist die Spannung zwischen Gleichheit demokratischer und ungleicher Expert*innenautorität wirklich unüberwindbar? In diesem Blogpost argumentiere ich, dass diese Spannung durchaus konstruktiv gemanagt werden kann, aber dass dabei die Überwindung zweier Formen von illegitimem Einfluss auf den Nexus von Expertise und Politik zentral ist: epistemischer Ungerechtigkeit, wie Miranda Fricker sie konzipiert hat, und ökonomischer Verzerrungen der Wissenslandschaft, auf die sich Politik stützt.[1]
Virolog*innen, Biodiversitätsexpert*innen, Verkehrsplanner*innen – das sind nur einige wenige Beispiele für Berufsgruppen, deren Expertise demokratische Politik benötigt, um politische Strategien zur Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme zu entwerfen und umzusetzen. Aber ihr Wissen ist für Laien – seien es Politiker*innen oder Mitglieder der weiteren Öffentlichkeit – nicht ohne Weiteres zugänglich: sie können nicht beurteilen, welche Aussagen empirisch wie gut abgesichert sind, welche Schlussfolgerungen sie zulassen, oder, noch grundlegender, wer überhaupt vertrauenswürdige Expert*innen in diesen Bereichen sind.
Noch komplizierter wird das Verhältnis zwischen Expert*innen und Laien dadurch, dass man keine einfache Trennung nach dem Schema „wertneutrale Fakten“ versus „wertgesteuerte Politikgestaltung“ vornehmen kann. Wie die Wissenschaftstheorie überzeugend nachgewiesen hat, spielen Werte auch bei der Auswahl von Forschungsthemen, der Entscheidung für bestimmte Methoden und der Interpretation der Ergebnisse eine Rolle.[2]
Stattdessen müssen Expert*innengemeinschaften und die Gesellschaft als ganze gemeinsam daran arbeiten, dass Expert*innenwissen in die Politik einfließen kann, ohne die demokratische Legitimität zu unterminieren. Dafür muss einerseits eine unverzerrte Wissenserzeugung mit hinreichenden internen „Checks and Balances“ (z.B. Peer Review) ermöglicht werden: Forschende müssen zunächst ohne direkten politischen oder gesellschaftlichen Druck arbeiten können. Zweitens müssen die Schnittstellen gemanagt werden, durch die das erzeugte Wissen anschließend aus den spezialisierten Nischen in den breiteren öffentlichen Diskurs getragen wird. Dabei geht es nicht nur um die Übersetzung in eine für Laien verständliche Sprache, sondern auch darum, dass die Annahmen, die in ein bestimmtes Forschungsdesign eingeflossen sind, erklärt werden und die Grenzen der Aussagen mitberücksichtigt werden, z.B. was die externe Validität von Studien in einem anderen Kontext angeht. Hierzu ist besonders hilfreich, wenn es Individuen gibt, die „interaktionales Wissen“ über bestimme Expertisefelder haben, also Wissen, das nicht unbedingt zur eigenen Teilnahme an der Wissenserzeugung befähigt, aber zum Verständnis und zur Übersetzung in andere Wissensbereiche.[3]
Viele Expert*innengemeinschaften beteiligen sich aktiv daran, diese Fragen anzugehen und ihr Wissen nicht nur Politiker*innen, sondern auch Bürger*innen zur Verfügung zu stellen. Wenn dies gelingt, sollte die Tatsache, dass Politiker*innen zu bestimmten Sachfragen die jeweiligen Expert*innen konsultieren, aus demokratietheoretischer Sicht kein Problem sein – aber ganz so einfach ist es leider doch nicht. Mindestens zwei weitere Herausforderungen gilt es anzugehen.
Epistemische Ungerechtigkeit
Die erste Herausforderung entsteht, ganz allgemein gesprochen, aus der Frage, wer als Expertin oder Experte gehört wird. Unsere Gesellschaften sind an zahlreichen Stellen von Formen von Ungerechtigkeit geprägt, die Miranda Fricker als „epistemische Ungerechtigkeit“ beschrieben hat: Ungerechtigkeiten, die den Status von Individuen als Träger*innen von Wissen betreffen.[4] Fricker unterscheidet dabei verschiedene Formen, insbesondere „testimonial“ und „hermeneutical.“ Erstere bezieht sich darauf, dass manche Menschen aufgrund von negativen Vorurteilen über die gesellschaftliche Gruppe, der sie angehören, als Träger*innen von Wissen weniger ernst genommen werden als andere. Letztere bezieht sich darauf, dass nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleichberechtigten Zugang zur Erzeugung von Wissen, z.B. durch die Prägung entsprechender Begrifflichkeiten, haben. Fricker diskutiert insbesondere epistemische Ungerechtigkeiten, die entlang der Linien von geschlechtlicher oder ethnischer Identität laufen; es liegt jedoch nahe, auch epistemische Ungerechtigkeiten entlang von sozio-ökonomischen Klassen mitzudenken.
Welche Rolle spielen epistemische Ungerechtigkeiten für das Verhältnis von Expert*innengemeinschaften und demokratischer Politik? Sie kommen an verschiedenen Stellen zum Tragen. Zum einen sind viele Expert*innengemeinschaften intern nicht epistemisch gerecht. Viel zu viele akademische Fächer zum Beispiel sind stark geprägt von weißen, männlichen Individuen aus bürgerlichen Haushalten. Diejenigen, die in irgendeiner Hinsicht „anders“ sind, erleben oft implizite oder explizite Diskriminierung und ziehen sich dann aus den – oft auch noch sehr kompetitiv organisierten – Expert*innengemeinschaften zurück. Zum anderen gibt es auch zwischen Expert*innengemeinschaften epistemische Ungerechtigkeiten: manchen Wissensformen wird mehr Autorität zugestanden als anderen, nicht weil sie weniger relevant wären, sondern weil sie z.B. als „weiblich“ gelten und deswegen abgewertet werden. Das zeigt sich z.B. am Verhältnis von männlich konnotierter Medizin und weiblich konnotierter Pflegewissenschaft oder Kinderpsychologie – und man denke an deren ungleiche öffentliche Sichtbarkeit gerade zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland! Last but not least gibt es ein generelles Gefälle in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen akademischen und anderen Wissensformen, z.B. praktischem Erfahrungswissen oder indigenem Wissen. Auch hier muss aus Sicht der epistemischen Gerechtigkeit gefragt werden, was sachlich gerechtfertigte Relevanzurteile und was ungerechte Vorurteile gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen sind.
Derartige epistemische Ungerechtigkeiten zu überwinden, ist ebenfalls eine gemeinsame Aufgabe für Expert*innengemeinschaften und die Gesellschaft als Ganze. Für interne epistemische Gerechtigkeit sind naturgemäß in erster Linie die Expert*innengemeinschaften zuständig, aber auch andere Gruppen, z.B. Journalist*innen, haben eine Mitverantwortung dafür, wessen Stimme gehört wird und wer die „Gesichter“ eines bestimmten Faches in der Öffentlichkeit sind. Das ist besonders auch dann wichtig, wenn Werte und Fakten, wie oben beschrieben, auf komplexe Art und Weise verwoben sind und die Werte von Expert*innen aufgrund epistemischer Ungerechtigkeiten von denen der Bevölkerung insgesamt abweichen können, weil nur bestimmte demographische Gruppen in den entsprechenden Expert*innengemeinschaften vertreten sind.
Wissen und Interessen
Das zweite Problem in Bezug auf den Nexus von Expertise und Politik stammt von Verzerrungen der Wissenslandschaft durch ökonomische Interessen. Natürlich können auch andere, z.B. religiöse Interessen, eine derartige Rolle spielen, aber in Gesellschaften, die ein kapitalistisches Wirtschaftssystem haben, ist die Ökonomie von besonderem Belang. Denn das Expert*innenwissen, das in die Politik einfließt, ist nicht neutral, was die Verteilungswirkung der sich daraus ergebenden Handlungsimperative ergibt – es kann sein, dass wirtschaftliche Akteure viel zu verlieren haben, wenn die Politik Expert*innenwissen ernst nimmt. Und oft versuchen diese wirtschaftlichen Akteure dann, Einfluss auf die Politik zu nehmen, und zwar nicht nur, indem sie die von den Expert*innen bereitgestellten Fakten akzeptieren und für ihre Interessen kämpfen, sondern auch, indem sie die Faktengrundlage selbst angreifen.
Das historisch am ausführlichsten dokumentierte Beispiel für diese Art von Verhalten war die sogenannte „Tabak-Strategie“ der Tabakindustrie.[5] Als sich in der Forschung abzeichnete, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist – und konkret Lungenkrebs verursacht – taten sich die Tabakkonzerne zusammen. Sie gründeten eine Interessensorganisation, die bewusst Wissenschaftler*innen förderte, die alternativen Forschungslinien (z.B. eine mögliche genetische Ursache von Lungenkrebs) nachgingen und streuten gleichzeitig der Politik und der Öffentlichkeit Sand in die Augen, indem sie behaupteten, die wissenschaftliche Frage nach der möglichen Schädlichkeit des Rauchens sei noch nicht mit hinreichender Sicherheit beantwortet – daher der Buchtitel von Oreskes und Conway, Merchants of Doubt, „Händler des Zweifels.“ Besonders perfide daran ist, dass Skepsis und Zweifel für die Wissenschaft zentral sind; erst gründlich geprüfte und durch verschiedene Methoden so gut wie möglich erwiesene Hypothesen können den Anspruch erheben, als Fakten behandelt zu werden, und auch das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt als etablierter wissenschaftlicher Konsens gilt, kann möglicherweise in der Zukunft, wenn neue Forschungsmethoden zur Verfügung stehen, wieder revidiert werden. Dennoch kann und muss wissenschaftliches Wissen ab einem gewissen Grad an Evidenz handlungswirksam werden – z.B., indem auf die Gefahren des Rauchens öffentlich hingewiesen wird, die Werbung von Tabakkonzernen eingeschränkt wird, und Nichtraucher*innen besser vor Passivrauchen geschützt werden. Durch das Sähen von Zweifel an der Gesundheitsschädlichkeit des Rauchens schaffte die Tabakindustrie es, derartige Regulierung jahrzehntelang zu verzögern und in dieser Zeit hohe Gewinne einzufahren.
Dieser Fall ist tragisch – noch schlimmer aber ist, dass das „Drehbuch“ der Tabakindustrie auch von anderen Industrien übernommen wurden, unter anderem der Öl- und Gasindustrie, die mit entsprechenden Methoden auch die politische Wirksamkeit des Faktums des menschengemachten Klimawandels entsprechend verzögerten. Und natürlich wissen inzwischen auch viele Laien, dass immer dann, wenn ökonomische Interessen auf dem Spiel stehen, die Gefahr derartigen Verhaltens besteht. Das Misstrauen von Bürger*innen gegenüber angeblich neutraler Expertise, die tatsächlich im Dienst ökonomischer Interessen steht, ist berechtigt – aber die Gefahr ist groß, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und allen Expert*innen interessengeleitetes Handeln vorgeworfen wird.
Was können Demokratien tun, um sich vor derartigen Manövern zu schützen? Ein wichtiger Punkt sind sicherlich Offenlegungspflichten für alle Finanzströme zwischen Wissenschaft und Interessensgruppen. Wenn die Wissenschaft, wie Sheila Jasanoff schreibt, die „fünfte Macht“ in Demokratien geworden ist, dann sollten hier ähnliche Maßstäbe angelegt werden wie bei denjenigen, die andere Formen von politischer Macht ausüben.[6] Darüber hinaus muss in den Bereichen, in denen öffentliche Interessen kommerziellen Interessen gegenüberstehen, sichergestellt werden, dass es genügend unabhängige Forschung gibt, und nicht zu viele der entsprechenden Expert*innen direkt oder indirekt im Dienst der jeweiligen Industrie stehen. Diese Frage ist derzeit zum Beispiel in Bezug auf Forschung zum Einsatz von künstlicher Intelligenz und zur Auswertung großer Datenmengen („big data“) virulent.
Die Spannung zwischen dem gleichen Wert aller Bürger*innen in Demokratien und dem ungleichen Gehör, das Expert*innen in Bezug auf bestimmte sachliche Fragen in der Politik und der Öffentlichkeit finden, ist für moderne Gesellschaften mit ihrer hochgradigen Ausdifferenzierung und damit auch Ausdifferenzierung von Wissensformen unvermeidbar. Aber je epistemisch gerechter, und je freier von ökonomischen Interessen, die Vermittlungsprozesse zwischen Expertise und Politik gestaltet werden, desto eher kann diese Spannung konstruktiv bewältigt werden.
—–
Lisa Herzog unterrichtet politische Philosophie in Groningen, Niederlande. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich derzeit vor allem mit der Zukunft von Arbeit, Demokratie und Wissen, und der Demokratisierung des Wirtschaftssystems.
[1] Ausführlich diskutiere ich diese Themen in meinem 2023 erscheinenden Buch Citizen Knowledge. Markets, Experts, and the Infrastructure of Democracy (Oxford University Press).
[2] Siehe hierzu insbesondere Heather Douglas, Science, Policy, and the Value-Free Ideal (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009).
[3] Vgl. auch Collins, Harry and Evans, Robert, Rethinking Expertise (Chicago: University of Chicago Press, 2007).
[4] Fricker, Miranda, Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing (New York: Oxford University Press, 2007). Auf die an Fricker anschließende Debatte, die auch Begriffe wie “epistemische Unterdrückung“ o.ä. eingeführt hat, gehe ich hier aus Platzgründen nicht ein.
[5] Siehe exemplarisch Oreskes, Naomi, and Eric Conway, Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming (London: Bloomsbury, 2010).
[6] Jasanoff, Sheila, The Fifth Branch: Science Advisors as Policymakers (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990).