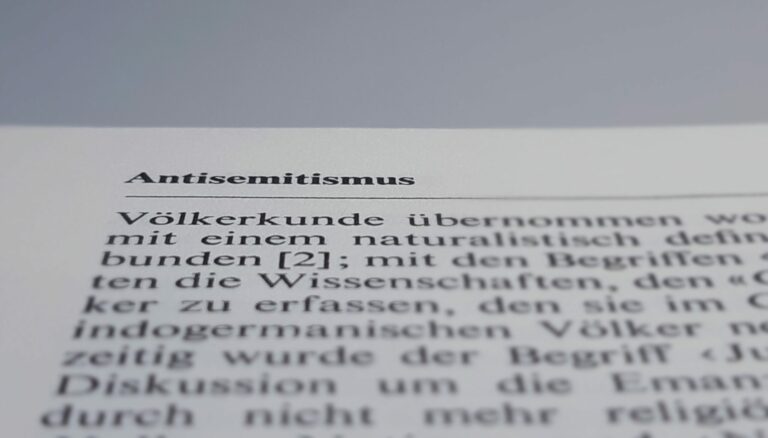„Disabled lives matter“ – Diskriminierung behinderter Menschen durch Pränataltestung?
Von Regina Schidel (Frankfurt am Main)
Dieser Blogbeitrag basiert auf einem Aufsatz, der im Schwerpunkt “Diskriminierung” in der Zeitschrift für Praktische Philosophie erschienen ist.
„[W]ir wollen nicht mehr abgetrieben werden, sondern auf der Welt bleiben.“ (Dedreux 2019) Vor einem guten halben Jahr wurde durch den Gemeinsamen Bundesausschuss – dem höchsten politischen Entscheidungsgremium der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland – beschlossen, dass ein einfacher vorgeburtlicher Bluttest auf Trisomien und damit auf das Down-Syndrom im Fall von Risikoschwangerschaften Bestandteil der Versorgung der gesetzlichen Gesundheitsfürsorge werden soll. Die genaue Regelung steht für Ende 2020 aus. Menschen mit Behinderung fühlen sich durch eine mögliche Standardisierung pränataler Testung auf das Down-Syndrom angegriffen und marginalisiert, so bringt das Zitat der Aktivistin Natalie Dedreux, die das Down-Syndrom hat, zum Ausdruck. Inwiefern kann die These einer Diskriminierung durch Pränataltestung auch philosophisch erhärtet werden?
Ableismus als Diskriminierung behinderter Menschen
Die Frage der Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer religiösen, ethnischen oder sozialen Zugehörigkeit, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts oder ihrer Hautfarbe stellt sich in liberalen Gesellschaften gerade dringlicher denn je. Die ungerechtfertigte Schlechterstellung von Menschen in Form von Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus bezieht sich aber nicht nur auf konkrete Akte – der Diffamierung und der Benachteiligung am Arbeitsplatz oder bei der Wohnungssuche – sondern wirkt auch auf einer strukturellen Ebene. Gemeint ist damit, dass jenseits direkter diskriminierender Handlungen die moralisch abzulehnende Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten und -merkmalen auch indirekt wirken kann – über stereotype Zuschreibungen, implizite Werturteile oder systematische Verzerrungen (‚biases‘) bei der Einschätzung von Leistungen.
Wenn behinderte Menschen aufgrund ihrer Behinderung und damit einhergehender Einschränkungen ihrer physischen oder kognitiven Fähigkeiten diskriminiert werden, spricht man auch von ‚Ableismus‘. Dabei ist keineswegs vorausgesetzt, dass die Verminderung bestimmter ‚speziestypischer‘ Funktionsweisen rein medizinisch zu erklären ist. Gemäß dem sogenannten ‚sozialen‘ Verständnis von Behinderung schwingt bei Be-hinderung vielmehr immer auch eine konstruktivistische Komponente mit: Menschen, deren physische und kognitive Grundvoraussetzungen ‚anders‘ sind, werden von der Gesellschaft be-hindert, indem die Lebensumwelt von Barrieren – materieller, institutioneller und epistemischer Natur – geprägt ist, die ihre gleichberechtigte Teilnahme erschweren oder verunmöglichen. Behinderung ist also immer auch ein Stück weit sozial gemacht.
Diskriminierung durch Pränataltestung?
Obwohl es keine zentralen Zahlen gibt, legen verschiedene statistische Erhebungen nahe, dass bei über 90% einer positiven Testung auf das Down-Syndrom ein Schwangerschaftsabbruch erfolgt (Tolmein 2012: 429f.). Damit wohnt pränataler Testung im Fall von Trisomien ein selektiver Charakter inne. Sie dient keinen therapeutischen Zwecken, da man das Down-Syndrom nicht ‚heilen‘ kann. Die Fälle, in denen es lediglich darum geht, sich auf das Leben mit einem behinderten Kind vorbereiten zu können, sind zahlenmäßig verschwindend gering. Vor der Einführung des Bluttests auf Trisomien (des sogenannten ‚Praenatests‘) konnten diese nur durch eine risikoreiche invasive Untersuchung (beispielsweise eine Fruchtwasseruntersuchung) bei Embryonen festgestellt werden. Befürchtet wird, dass mit der Einführung eines risikofreien Bluttests in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen, die Quote der Schwangerschaftsabbrüche im Fall von Trisomien auf nahezu 100% anwächst. Ob Embryonen durch eine solche Praxis der Selektion diskriminiert werden, ist eine komplizierte Frage, um die es hier nicht geht, denn ihre Beantwortung würde voraussetzen, genauer zu klären, was der genaue moralische Status von Embryonen ist.
Ein anderes Problem ist in diesem Zusammenhang einschlägiger: Menschen mit Down-Syndrom fühlen sich oftmals durch die Praxis der selektiven Schwangerschaftsabbrüche diskriminiert und gesellschaftlich marginalisiert. Befürchtet wird, dass Unterstützungsangebote abnehmen und Solidarität schwindet, wenn niemand mit Down-Syndrom überhaupt mehr geboren wird. Haben wir es hier deswegen mit einer indirekten bzw. strukturellen Form der Diskriminierung zu tun?
Die Adressierung der Frage nach einer möglichen Diskriminierung durch Pränataltestung auf Trisomien aus philosophischer Perspektive mag zunächst irritieren. Innerhalb eines liberalen Paradigmas erscheint es prima facie fraglos, dass ein Zugewinn an Informationen im Rahmen der medizinischen Schwangerschaftsvorsorge zu begrüßen ist und die reproduktive Autonomie von werdenden Eltern befördert. Im Einklang damit steht das Hochhalten der Selbstbestimmung von Frauen und deren Recht auf körperliche Integrität. Ob und unter welchen Umständen eine Schwangerschaft fortgeführt oder beendet wird, fällt in den höchstprivaten Bereich der Betroffenen und muss deswegen respektiert und nicht paternalistisch in Frage gestellt werden.
Beförderung oder Verhinderung von Autonomie?
Damit ist aber nur eine Seite der Medaille umrissen. Denn die Frage nach der Bewertung von Pränataltestung und der damit zusammenhängenden individuellen Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch stellt sich nicht nur aus bioethischer Perspektive, sondern entfaltet auch eine biopolitische Virulenz. In der Bioethik werden – ganz skizzenhaft formuliert – Konfliktsituationen und Entscheidungsalternativen, die im Fall von Grenzphänomenen des Lebens auftauchen, anhand von Gründen abgewogen und moralisch bewertet. Die Biopolitik (im Anschluss an den Soziologen und Philosophen) Foucault nimmt dagegen eine Perspektive ein, die weniger nach der moralischen Zulässigkeit individuellen oder kollektiven Handelns fragt. Im Vordergrund stehen vielmehr die diskursive Rahmung von biologischen Prozessen und Praktiken im Umfeld von Zeugung, Geburt, Krankheit und Tod sowie eine Analyse dessen, wie Macht auf die Bewertung von menschlichem Leben bzw. dessen unterschiedliche Wertschätzung wirkt.
Aus biopolitischer Perspektive fällt die Frage nach den normativen Dimensionen von Pränataltestung sehr viel komplizierter aus als aus Sicht eines liberal-bioethischen Paradigmas. Die Struktur der medizinischen Schwangerschaftsvorsorge und des von ihr vorgezeichnete Parcours an Untersuchungen, Tests und Risikoabklärungen kann nämlich auch ganz anders gedeutet werden, denn als bestmögliche Unterstützung für schwangere Frauen und zukünftige Kinder. Dieser alternative Blick auf die medizinische Praxis der Pränataltestung fällt sehr viel kritischer aus: Durch die Assoziation eines prädiktiv-diagnostischen Testregimes mit dem Ideal einer verantwortlichen Mutter- oder Elternschaft entsteht nämlich eine ganz bestimmte Vorstellung dessen, was wünschenswert ist und was nicht, was als zumutbar gilt und was nicht. Die Entscheidung gegen bestimmte Tests und damit für das Nicht-Wissen in Bezug auf das zukünftige Kind passt jedenfalls nicht in die systemische Logik der Pränatalversorgung.
Wenn eine Leistung Bestandteil der gesetzlichen Gesundheitsversorgung wird, ist damit nämlich schon impliziert, dass es sich um eine Gesundheits-Leistung handelt. Wer ab einem bestimmten Alter die standardisierte Krebsvorsorge nicht in Anspruch nimmt, verhält sich in der Struktur der Vorsorge-Logik tendenziell unverantwortlich. Ähnliches könnte für die Pränataltestung auf Trisomien gelten, wenn sie zur Kassenleistung werden (ganz zu schweigen von dem ökonomischen Kalkül, das die gesetzlichen Krankenkassen dazu motivieren dürfte, pränatale Bluttests in ihren Leistungskatalog aufzunehmen). Schon jetzt berichten Frauen, dass die psychosoziale Aufklärung und neutrale Beratung von Frauen im Kontext pränataler Diagnostik unzureichend sind (vgl. Boldt und Krause 2020). Zumindest aber geht mit der Standardisierung eine Normalisierung einher, die aus biopolitischer Sicht problematisch ist.
Biomacht und strukturelle Diskriminierung
Michel Foucault hat in seinen Analysen dazu, wie in der Moderne sich Macht von ihrer souveränen Form hin zu einer Bio-Macht verschiebt, herausgearbeitet, dass ein zentraler Effekt dieser Bio-Macht in einer Angleichung der Norm an die Normalität liegt. Das Durchschnittliche, Unmarkierte wird zum Wünschenswerten und Vorzugswürdigen. Umgekehrt ist damit impliziert: Das Andere, Abweichende wird abgewertet, marginalisiert und normativ exkludiert. Bezieht man diese Überlegungen auf die medizinische Rahmung der Pränataldiagnostik zurück, werden deren problematischen Züge sichtbar. Es geht um die Detektion des Abweichenden, Anderen – in diesem Fall um Embryonen mit chromosomalen Trisomien –, das aufgrund seiner Normabweichung negativ besetzt wird. Gleichzeitig wird durch diesen normierenden Zugriff eine Lösungsmöglichkeit angeboten: Das Down-Syndrom ist vermeidbar.
Was ist mit dieser normalitätsorientierten Struktur der medizinischen Schwangerschaftsvorsorge über die Diskriminierung von Menschen mit Down-Syndrom ausgesagt? Entscheidend ist die stereotypisierte gesellschaftliche Imagination von Menschen mit Down-Syndrom, welche durch die institutionelle Struktur der Pränataltestung und ihre Einbettung in die gesetzliche Gesundheitsversorgung erzeugt und fortgeschrieben wird. Wenn Trisomien gemäß dieser Logik als pathologisch klassifiziert werden, dann wirkt das auch auf die Wahrnehmung von Menschen mit Down-Syndrom zurück und verstärkt diese. Das Down-Syndrom wird als Abweichung, als Sonderfall, als A-Normalie gedeutet und kann im durch Pränataldiagnostik umschriebenen Kontext nur als Defizit erscheinen. Dass Menschen mit Down-Syndrom einfach auch Menschen sind und danach streben, ein erfülltes und gelungenes Leben zu führen, gerät durch die Reduktion auf ihr Andersein als ‚Behinderte‘ völlig aus dem Blick.
Es lässt sich in Hinblick auf die stereotype Bewertung des Down-Syndrom als pathologisch und vom Normalitätsmaß abweichend also durchaus von Diskriminierung sprechen. Da Menschen mit Down-Syndrom durch die Struktur der Pränataldiagnostik nicht direkt schlechter gestellt oder ungleich behandelt werden, sondern ihre Anerkennung als gleiche und vollwertige Menschen vielmehr durch soziale Normalitätsvorstellungen bedroht ist, handelt es sich um eine strukturelle Form der Diskriminierung. Wenn eine negative Konnotation von Down-Syndrom systemisch aufrechterhalten und fortgeschrieben wird, zementiert sich ein gesellschaftliches Bild von Menschen mit Down-Syndrom, das letztlich auch auf deren Leben und Unterstützungsangebote schädlich zurückwirken durfte.
Dass hier eine strukturelle Form von Abwertungen und Vorurteilen wirksam ist, bedeutet umgekehrt aber auch: Nicht die einzelnen Frauen bzw. werdenden Eltern sind Akteur*innen der Diskriminierung. Vielmehr werden sie selbst durch ein System der Schwangerschaftsvorsorge in ihren Entscheidungen beeinflusst, das nicht neutral aufklärt und informiert, sondern bereits durch die Binarität von normal und a-normal vorstrukturiert ist. Gerade dadurch wird eine wirklich selbstbestimmte Entscheidung in Fragen der Reproduktion, die auch die Entscheidung für ein behindertes Kind sein könnte, erschwert oder sogar verhindert. Die Skepsis gegenüber pränataler Diagnostik auf Trisomien als unhinterfragter medizinischer Standard gilt deswegen gerade auch aus einer feministischen Perspektive.
Disabled lives matter
Von dem Schauspieler Sebastian Urbanski, der das Down-Syndrom hat, stammt das Zitat „Wir sind, verdammt nochmal, alle Menschen.“ (Urbanski 2015, 255) Dieses Plädoyer ernst zu nehmen, heißt keineswegs, die Errungenschaften feministischer Kämpfe wieder rückgängig zu machen und reproduktive Selbstbestimmung oder das Recht auf Schwangerschaftsabbruch noch stärker einzuschränken. Wenn für werdende Eltern das Leben mit einem behinderten Kind nicht vorstellbar ist, dann ist diese Entscheidung zu respektieren. Problematisch wird es aber, wenn eine solche Entscheidung gar nicht selbstbestimmt getroffen werden kann, weil systemische und institutionelle Rahmungen wie diejenige der pränatalen Vorsorge bereits eine Bewertung dessen vorgeben, was normal ist und was nicht. Die Aufnahme des Bluttests in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen sendet jedenfalls ein falsches Signal. Viel dringlicher ist die gesellschaftliche Aufgabe, Menschen mit Down-Syndrom als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft anzuerkennen und Vorurteilsmuster ihnen gegenüber aufzubrechen. Die Abschaffung von Ableismus und dessen strukturelle Formen ist ein emanzipatorisches Anliegen, das sich einreiht in den gesellschaftlichen Kampf gegen Diskriminierung und Stigmatisierung von Minderheiten.
Regina Schidel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaft, Arbeitsschwerpunkt Politische Philosophie und Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der Politischen Theorie, der praktischen Philosophie und der Sozialphilosophie. In ihrer Doktorarbeit fragt sie nach den Möglichkeiten einer inklusiven Berücksichtigung von Menschen mit geistiger Behinderung aus Perspektive der praktischen und politischen Philosophie.
Literatur
Boldt, Joachim und Franziska Krause (2020). Das Recht auf Nichtwissen in der Medizin. Blogbeitrag auf praefaktisch (https://praefaktisch.de/nichtwissen/das-recht-auf-nichtwissen-in-der-medizin/)
Dedreux, Natalie (2019). Interview mit dem Deutschlandfunk am 11.4.2019 (https://www.deutschlandfunk.de/debatte-um-trisomiebluttest-
down-syndrom-ist-keine.694.de.html?dram:article_id=446036)
Foucault, Michel (2001). In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975–76). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Pressemitteilung des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 19.9.2019 (https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/810/)
Tolmein, Oliver (2012). ‚Selbstbestimmungsrecht der Frau, Pränataldiagnostik und die UN-Behindertenrechtskonvention‘, Kritische Justiz, 45 (4): 420-434.
Urbanski, Sebastian (2015). Am liebsten bin ich Hamlet: mit dem Downsyndrom mitten im Leben. Frankfurt a.M.: Fischer.