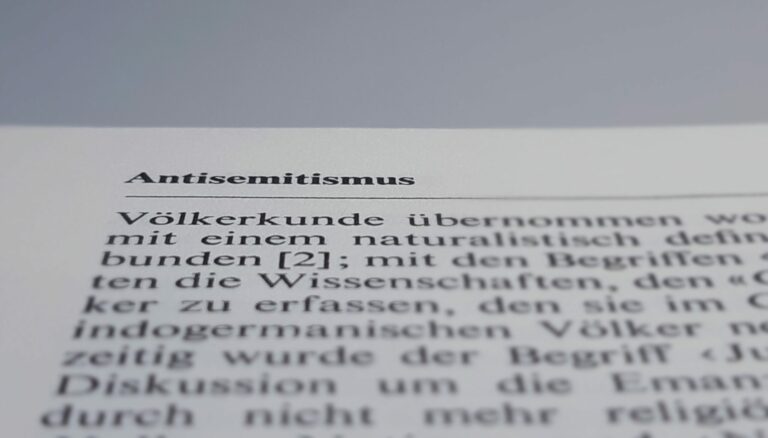Gruppenbezogene Benachteiligung. Précis zu „Diskriminierung und das Kriterium der Gruppenzugehörigkeit“
Podcast: Play in new window | Download
von Hauke Behrendt (Stuttgart)
Dieser Blogbeitrag basiert auf einem Aufsatz, der im Schwerpunkt “Diskriminierung” in der Zeitschrift für Praktische Philosophie erschienen ist. Der Beitrag kann auch als Podcast gehört und heruntergeladen werden:
Der Diskriminierungsbegriff ist bis heute umkämpft. Obwohl die meisten philosophischen, rechtlichen und politischen Diskussionen davon ausgehen, dass Diskriminierung falsch ist und verboten sein sollte, sind die begrifflichen Voraussetzungen und genauen Anwendungsdetails noch immer strittig. Um ein moralisches wie rechtliches Diskriminierungsverbot richtig beurteilen und ggf. sauber umsetzen zu können, ist es daher erforderlich, gründlich zu bestimmen, was eine diskriminierende Behandlung im Kern ausmacht. Dafür müssen explizite Kriterien formuliert werden, die den Tatbestand präzise auf den Begriff bringen.
Mit Blick auf den aktuellen Stand der Diskussion ist dabei die verbreitete Fokussierung auf gruppenbezogene Benachteiligung besonders klärungsbedürftig. So geht eine Reihe renommierter Theoretiker*innen davon aus, dass das Kriterium der Gruppenzugehörigkeit (KdG), wie ich es hier nennen will, für ein sinnvolles Verständnis von „Diskriminierung“ unerlässlich ist (vgl. u. a. Young 1990; Edmonds 2006; Hormel und Scherr 2010; Lippert-Rasmussen 2014; Altman 2020). Auf eine allgemeine Formel gebracht, besagt das KdG, dass Handlungen, Praktiken oder Strukturen nur dann diskriminierend sind, wenn die betroffenen Personen aufgrund ihrer (unterstellten) Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe benachteiligt werden. Mit dem Diskriminierungsbegriff werden demnach genau diejenigen Sachverhalte komparativer Benachteiligung eingefangen, in denen Gruppenzugehörigkeit als Unterscheidungsmerkmal fungiert. Das KdG greift damit eine besondere Kategorie von Gründen heraus, nämlich gruppenbezogene, die zur Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen nicht herangezogen werden dürfen.
In dieser unqualifizierten Form ist das Kriterium der Gruppenzugehörigkeit allerdings zu unspezifisch. Mein Vorschlag lautet, das KdG so zu spezifizieren, dass „Diskriminierung“ mit Rekurs auf soziale Klassifikationen von Individuen definiert wird. Dafür müssen der verwendete Begriff der sozialen Gruppe ausbuchstabiert und die genauen Konstitutionsbedingungen für Gruppenmitgliedschaft geklärt werden. In seiner ursprünglichen Form beinhaltet das KdG eine Mehrdeutigkeit: So lässt sich der Passus „Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe“ sozialontologisch zum einen in einem realistischen, zum anderen in einem klassifikatorischen Sinn verstehen. Während Gruppen nach der realistischen Deutung in erster Annährung als organisierte Zusammenschlüsse von mehreren Akteuren bestimmt werden, wie Fanclubs, Reisegruppen, Orchester usw., stellen sie nach der klassifikatorischen Deutung demgegenüber Klassifikationen von Individuen dar, die anhand ganz bestimmter übereinstimmender Merkmale in verschiedene soziale Arten („social kinds“) unterteilt werden, die übergeordneten sozial bedeutsamen Kategorien wie Gender, Class, Race usw. angehören.
Die Unterschiede liegen auf der Hand: Im realistischen Sinne setzt Diskriminierung die Existenz von sogenannten Realgruppen voraus, in denen sich eine begrenzte Anzahl von Mitgliedern über einen gewissen Zeitraum in sozialen Kommunikations- und Interaktionszusammenhängen in regelmäßigem Kontakt miteinander befindet, gemeinsame Ziele verfolgt sowie ein geteiltes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt (vgl. Schweikard 2011, 393–431, bes. 422; Schäfers 2016, 157). Die klassifikatorische Deutung ist demgegenüber in entscheidender Hinsicht schwächer: Hier wird der Ausdruck „soziale Gruppe“ allenfalls metaphorisch für auf generischen Eigenschaftszuschreibungen basierende symbolische Klassifikationen von Individuen verwendet. Damit ist Diskriminierung auch in Fällen möglich, in denen die Betroffenen keinerlei Kontakt miteinander pflegen, keine geteilte Gruppenidentität besitzen usw. – auch in Fällen also, in denen man es nicht mit Gruppenzugehörigkeit im realistischen Sinn zu tun hat.
Meine These lautet, dass die klassifikatorische Deutung mehr Überzeugungskraft besitzt, weil sie zu starke Forderungen an die Konstitutionsbedingungen von Gruppen vermeidet, was unplausibel viele Instanzen offensichtlicher Diskriminierung ausschließen würde. Sofern man Gruppenzugehörigkeit auf Realgruppen bezieht, wird der Diskriminierungsbegriff dadurch eindeutig zu eng. Prototypischen Diskriminierungen aufgrund von Gender, Class oder Race – die kein mir bekannter Ansatz bereit wäre auszuschließen – könnte nur unzureichend Rechnung getragen werden, weil diesen sozialen Kategorien die für Realgruppen erforderlichen Strukturmerkmale nicht notwendigerweise zukommen müssen. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen – und empirisch auch alles andere als außergewöhnlich –, dass Angehörige derselben sozialen Art eine kollektive Identität ausbilden und sich zu organisierten Realgruppen zusammenschließen. Interessenvertretungen, Selbsthilfegruppen, Protestbewegungen etc. bilden sich allerdings in der Regel erst in Reaktion auf Diskriminierungserfahrungen und gehen diesen nicht voraus.
Bezogen auf Realgruppen wäre das KdG aber nicht einmal hinreichend. Dies verdeutlichen Gegenbeispiele, in denen Realgruppenzugehörigkeiten eine ungleiche Behandlung rechtfertigen. So scheint es moralisch etwa völlig unbedenklich zu sein, nur von Vereinsmitgliedern Beiträge aufgrund ihrer Vereinszugehörigkeit zu erheben oder im Krieg nur aufgrund ihrer Truppenzugehörigkeit Kombattanten des Kriegsgegners zu bekämpfen. Nach der realistischen Deutung des KdG würde für die genannten Fälle der kontraintuitive Schluss gelten, dass sie Diskriminierungen darstellen.
Die klassifikatorische Deutung von Diskriminierung kann auch Fälle der realistischen Deutung einfangen. Das ist dann der Fall, wenn sich die entsprechenden Bedingungen, die vorliegen müssen, um einer bestimmten Kategorie anzugehören, auf Gruppenmitgliedschaft im anspruchsvollen Sinn beziehen. Zwar ist nicht für jede Realgruppe eine sozial bedeutsame Kategorie vorhanden, aber in vielen Fällen ist dies tatsächlich der Fall. Beispielsweise setzt die Kategorie der Ehefrau eine Realgruppenmitgliedschaft voraus. Sozial bedeutsame Klassifikationen können also sowohl auf der Grundlage von personenbezogenen Merkmalen als auch auf der Grundlage von realgruppenbezogenen Merkmalen gebildet werden, wie Albert Scherr (2010, 44) hervorgehoben hat: Im ersten Fall handelt es sich um stabile Merkmale, die den klassifizierten Individuen als in ihrer Person verankerte Eigenschaften zugerechnet werden – so etwa im Fall von Behinderung und Alter. Im zweiten Fall basiert die Klassifikation auf Eigenschaften, die aus der Zugehörigkeit zu einer Realgruppe resultieren, wie (häufig) im Fall von Religion und Weltanschauung.
Der klassifikatorische Diskriminierungsbegriff hat den weiteren Vorteil, noch in anderer Hinsicht sparsamer zu sein: So lässt sich ohne Rückgriff auf weitere Bedingungen erklären, warum Diskriminierung moralisch falsch ist. Und zwar, so die These, sind komparative Benachteiligungen moralisch nur dann zulässig, wenn sie die Folge von Umständen sind, die die betroffene Person selbst zu verantworten hat, sich also auf ihre freiwillige Entscheidung oder einen für sie vermeidbaren Fehler zurückführen lassen, was bei sozialer Artzugehörigkeit niemals der Fall ist, weil es sich dabei um überpersönliche Zuschreibungspraktiken handelt. Zwar mag im Einzelfall ein gewisser Spielraum bestehen, der einen Wechsel zwischen einzelnen sozialen Arten einer Kategorie zulässt, beispielsweise was die eigene Geschlechtsidentität oder Konfession betrifft. Doch stellen die den konkreten Arten jeweils zugehörigen übergeordneten Kategorien wie Gender oder Religionszugehörigkeit kulturell unhintergehbare Ordnungssysteme für die Definition sozialer Identitäten dar, zu denen sich der Einzelne stets auf die eine oder andere Weise ins Verhältnis setzen muss.
Dieser Sachverhalt spiegelt sich auch in konkreten antidiskriminierungsrechtlichen Bestimmungen wider: Das Recht schützt bekanntlich nicht partikulare soziale Arten (z.B. Frauen oder Buddhisten) vor Benachteiligung, sondern verbietet durchweg jede Benachteiligung auf der Grundlage der übergeordneten Kategorien. Nehmen wir die sechs im AGG geschützten Diskriminierungskategorien: a) Rasse oder ethnische Herkunft, b) Geschlecht, c) Religion oder Weltanschauung, d) Behinderung, e) Alter und f) sexuelle Identität. Jeder Mensch gehört auf die eine oder andere Art und Weise einer sozialen Art dieser Kategorien an. Die angeführten Diskriminierungskategorien verdeutlichen, wie der Schutz des Individuums vor Benachteiligung aufgrund einer (vermeintlichen) Gruppenzugehörigkeit heute rechtlich operationalisiert ist: So verbietet das AGG, jemanden wegen seiner Zugehörigkeit zu einer der genannten Gruppen zu benachteiligen.
Diese Überlegungen erklären, warum wir das KdG im Sinne eines klassifikatorischen Diskriminierungsbegriffs spezifizieren sollten. Ich übe folglich keine Fundamentalkritik am KdG, sondern präzisiere lediglich, wie wir dieses vernünftigerweise auslegen sollten. Dabei setze ich keinesfalls voraus, dass Befürworter des KdG zwingend auf die von mir verworfene Deutung, die Gruppenzugehörigkeit auf Realgruppen bezieht, festgelegt wären. Im Gegenteil: Mein Vorschlag weist einige inhaltliche Parallelen zu prominenten Positionen auf, die explizit auf das KdG Bezug nehmen. Kasper Lippert-Rasmussen etwa hat vorgeschlagen, diskriminierungsrelevante Gruppenzugehörigkeit auf sogenannte sozial hervorstechende Gruppen („social salient groups“) zu beziehen (vgl. Lippert-Rasmussen 2014, 30). Allerdings bleiben zentrale Implikationen seiner Idee unterbestimmt. Meine Ausführungen buchstabieren diese Implikationen aus und klären ihre sozialontologischen Voraussetzungen.
Mein Vorschlag lautet: Diskriminierung liegt genau dann vor, wenn Handlungen, Praktiken oder Strukturen Personen eine komparative Benachteiligung aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer auf generischen Eigenschaftszuschreibungen basierenden sozial bedeutsamen Kategorie auferlegen.[1] Werden Merkmalsträger von den Symbol- und Bedeutungssystemen einer kulturellen Lebensform auf eine Weise klassifiziert, die ihnen im Rahmen der gesellschaftlichen Praxis einen bestimmten normativen Status zuweist, haben wir es mit einer sozial bedeutsamen Kategorie zu tun, die das Leben der Betroffenen (mindestens kontrafaktisch) auf entscheidende Art beeinflusst und einen wesentlichen Teil ihrer Identität ausmacht. Anders als im Fall von Realgruppen müssen die unter eine sozial bedeutsame Kategorie fallenden Individuen dabei weder ein entsprechendes kollektives Selbstverständnis ausbilden noch besondere Beziehungen zueinander unterhalten.
Diese Begriffsbestimmung ist informativ, weil sie eine spezielle Klasse von Benachteiligungen bestimmt, die mit der moralischen Achtung gegenüber der Autonomie eines jeden Menschen unvereinbar ist. Damit wird indes nicht geleugnet, dass es daneben noch eine Menge anderer Formen ungerechtfertigter Benachteiligungen gibt. Wer andere wegen eines individuellen Merkmals herabwürdigt, ausgrenzt oder schädigt, macht sich fraglos ebenfalls großer moralischer Vergehen schuldig. Wir haben es hierbei, so das Fazit der vorliegenden Überlegungen, allerdings nicht mit Diskriminierungen zu tun.
Dr. Hauke Behrendt ist Akademischer Rat am Institut für Philosophie der Universität Stuttgart. Seine Dissertation „Das Ideal einer inklusiven Arbeitswelt. Teilhabegerechtigkeit im Zeitalter der Digitalisierung“ ist 2018 im Campus Verlag erschienen. In seinem Habilitationsprojekt beschäftigt er sich mit Phänomenen gruppenbezogener Ungerechtigkeiten wie Diskriminierung und Unterdrückung.
Literatur
Altman, Andrew. 2020. „Discrimination“. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), herausgegeben von Edward N. Zalta. URL = https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/discrimination.
Edmonds, David. 2006. Caste Wars. A Philosophy of Discrimination. London/New York: Routledge.
Hormel, Ulrike, und Albert Scherr. 2010. „Einleitung: Diskriminierung als gesellschaftliches Phänomen“. In Diskriminierung. Grundlagen und Forschungsergebnisse, herausgegeben von Ulrike Hormel und Albert Scherr, 7–20. Wiesbaden: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-92394-9_1.
Lippert-Rasmussen, Kasper. 2014. Born Free and Equal? A Philosophical inquiry into the Nature of Discrimination, Oxford: OUP.
Schäfers, Bernhard. 2016. „Die soziale Gruppe“. In Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie, herausgegeben von Hermann Korte und Bernhard Schäfers, 9. überarbeitete und aktualisierte Auflage, 153–172. Wiesbaden: Springer VS. DOI: 10.1007/978-3-658-13411-2.
Scherr, Albert. 2010. „Diskriminierung und soziale Ungleichheiten. Erfordernisse und Perspektiven einer ungleichheitsanalytischen Fundierung von Diskriminierungsforschung und Antidiskriminierungsstrategien“. In Diskriminierung. Grundlagen und Forschungsergebnisse, herausgegeben von Ulrike Hormel und Albert Scherr, 35–60. Wiesbaden: Springer. DOI: 10.1007/978-3-531-92394-9.
Schweikard, David P. 2011. Der Mythos des Singulären. Eine Untersuchung der Struktur kollektiven Handelns. Paderborn: Mentis.
Young, Iris Marion. 1990. Justice and the Politics of Difference, Princeton: PUP.
[1] Generische Eigenschaften sind Merkmale, die zur selben Zeit von beliebig vielen Trägern an beliebig vielen Orten instanziiert werden können. Diskriminierung aufgrund eines bestimmten Fingerabdrucks oder des Genoms ist also nicht möglich, weil dies individuelle Eigenschaften sind.