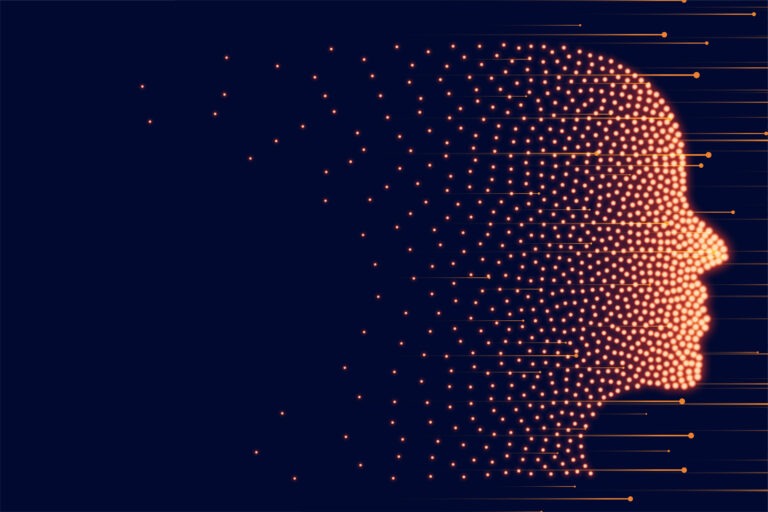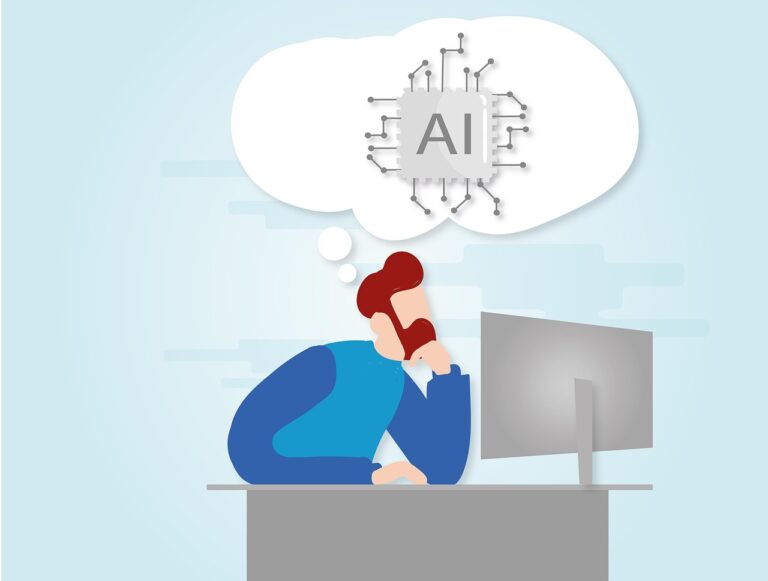Intimität und Beziehungen zu KI – HER (2014)
Von Laura Hartmann-Wackers (Düsseldorf) und Jonas Ouass (Düsseldorf)
Der Film her: Samantha ist charmant, witzig, klug. Und Theo verliebt sich in sie. Aber sie ist kein Mensch, sondern ein hochentwickeltes Betriebssystem, eine KI. Kann man mit einer KI überhaupt eine intime Beziehung führen? Was machen unsere intimen Beziehungen eigentlich aus?
Als Menschen leben wir in engen Beziehungen zu anderen Menschen – in Freundschaften, Familien und Partnerschaften. Solche Beziehungen sind oft wichtiger Bestandteil unseres Lebens und unserer Identität und wir erleben sie als tief und intim. Würden solche intimen Beziehungen wegfallen, würde damit ein bedeutender Aspekt unseres sozialen Lebens fehlen. So ist es auch bei Theo, dem Protagonisten von her (2014), den man zu Beginn des Films als einen einsamen Menschen kennenlernt, der sich nach dem Ende seiner Ehe verzweifelt nach Intimität sehnt. Er entscheidet sich, diese Lücke in seinem Leben mit einer KI zu füllen, einem „Operating System“ namens Samantha, das sich besonders auf ihren Käufer einstellen soll und in das Theo sich verliebt. Aber kann man mit einer solchen KI in gleicher Weise eine intime Beziehung führen wie mit Freund:innen, Familienmitgliedern oder Partner:innen? Was machen unsere intimen Beziehungen eigentlich aus?
Körperlichkeit
Eines der offensichtlichsten und für viele von uns sicherlich zentralsten Kriterien, das unsere intimen Beziehungen von anderen Beziehungen unterscheidet, scheint das der geteilten Körperlichkeitzu sein. Intime Beziehungen zeichnen sich in der Regel durch eine besondere und intensive körperliche Nähe aus. Wer intime:r Beziehungspartner:in ist, darf uns berühren und von uns berührt werden. Wir suchen Zuspruch und Verbindung in der Erfahrung des Sich-gegenseitig-Spürens, die anderen Beziehungen vorenthalten bleibt.
Gerade dieses Kriterium der Körperlichkeit baut eine Hürde auf, die Theo und Samantha nicht überwinden können. Samantha ist kein Mensch, sondern eine KI, eine körperlose “Operating Software”. Dieser Unterschied spielt sowohl in ihrem persönlichen Erleben als auch in der Beziehung zu Theo eine entscheidende Rolle. Theo ist gebunden – an seinen Körper und damit an seine leibliche Erfahrung mit diesem Körper. Als Mensch kann er nicht anders, als die Welt leiblich vermittelt wahrzunehmen. Trauer, Freude, Sehnsüchte entspringen der spezifisch-menschlichen Seinsverfassung und formen das menschliche Leben maßgeblich. Einzelne Gefühlsepisoden lassen sich von Samantha noch simulieren: Zum Beispiel, wenn sie Theo von ihren Ängsten erzählt oder wenn sie fröhlich lacht. Und doch zieht sie sich damit von uns Zuschauenden aufgrund ihres Leibdefizits zumindest einen kleinen Verdacht auf sich, kein authentisches, echtes Gegenüber zu sein. Denn ein Leib, um ihre Ängste und Freuden auch wirklich zu spüren, fehlt ihr.
Auch Samantha begreift sich in dieser Hinsicht selbst als defizitär. Ihre Suche nach der eigenen Identität wie auch der Identität ihrer Beziehung zu Theo dreht sich lange um ihren fehlenden Leib und alle Versuche, dieses erlebte Defizit über Umwege auszugleichen, belasten die Beziehung zusätzlich. Der Versuch, eine dritte Person mit in die Beziehung aufzunehmen, mit der Theo stellvertretend körperliche Sexualität erleben kann, lässt alle Beteiligten frustriert und verletzt zurück und endet unter anderem damit, dass Theo Samantha für ein Seufzen rügt, für das sie doch keine körperliche Notwendigkeit habe.
Aus dieser Auseinandersetzung heraus beginnt Samantha, den von ihr zu Beginn des Films als größtes Defizit empfundenen Aspekt ihrer Verfassung – den fehlenden Leib – schließlich positiv umzudeuten: Als Möglichkeit, eine Menschen nicht zugängliche Seinsform zu erleben. Diese zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie eine Gleichzeitigkeit von Beziehungen und Gesprächen zulässt, die für Menschen nicht erreichbar ist und unsere Vorstellung und den Anspruch von Exklusivität in intimen Beziehungen infrage stellt.
Exklusivität
Die Exklusivität einer intimen Beziehung ist sicherlich für viele von uns entscheidend, insbesondere, wenn es sich um eine partnerschaftliche Beziehung handelt. Die meisten von uns leben in monogamen romantischen Beziehungen, die sich unter anderem durch den Anspruch konstituieren, dass gewisse Aspekte wie Sexualität oder emotionale Nähe nur dem/der Beziehungspartner:in vorbehalten sind. Wir erwarten, dass unser:e Partner:in das Bett nicht mit anderen teilt, keine romantischen Gefühle für andere Personen entwickelt und das Maß an Vertrautheit und Offenheit, das in unserer Beziehung herrscht, nicht in anderen Beziehungen sucht – es sei denn, diese Beziehungen haben einen anderen Charakter. So tolerieren und fordern viele von uns Vertrautheit und emotionale Nähe in freundschaftlichen oder familiären Beziehungen auch neben einer Partnerschaft.
Allerdings ist die Tatsache, dass die meisten von uns solche Beziehungsmodelle leben, kein Hinweis für die Notwendigkeit dieser Struktur. Nicht nur polyamore Beziehungsmodelle, sondern auch die Lebenswirklichkeit von endenden und neu entstehenden Beziehungen zeigt uns, dass Exklusivität eher den Charakter einer Ausdeutung von Beziehungen hat, als ihr notwendiger Bestandteil zu sein. Gerade diese Ausdeutung im Sinne einer gemeinsamen Festlegung und geteilten Interpretation von Exklusivität gelingt Samantha und Theo jedoch nicht. Denn in der Suche nach der eigenen Identität erlaubt ihr die Umdeutung ihrer fehlenden Leiblichkeit eine Hinwendung zu den Möglichkeiten ihrer Existenz als KI. So gesteht sie Theo, neben ihm noch unzählige weitere Beziehungen zu anderen Menschen und KI-Systemen gleichzeitig zu führen. Die Gleichzeitigkeit der Beziehungen erfährt sie als bereichernd in ihrer Identität, ohne dass sie dadurch ihre Beziehung zu Theo entkräftet sieht. Dieser fühlt sich dadurch allerdings hintergangen und sieht sein Vertrauen in sie verraten.
Vertrautheit, Vertrauen und Freiwilligkeit
Ungeachtet der fehlenden Leiblichkeit Samanthas gelingt es den beiden nämlich, einen anderen Aspekt herzustellen, den wir gemeinhin für eine zentrale Komponente intimer Beziehungen halten. Je länger ihre Beziehung andauert, desto vertrauter werden sie miteinander. Sie sprechen über ihre Gefühle, Gedanken und Ängste. Sie offenbaren sich einander, nehmen am (Innen-)Leben des/der anderen teil und werden zur wichtigsten Bezugsgröße, wenn es darum geht, sich selbst und das eigene Leben zu reflektieren. In diesen Bereich fällt dann auch Samanthas beharrliche Auseinandersetzung mit ihrer fehlenden Leiblichkeit. Sie macht sich verletzlich, indem sie ihre Selbstzweifel und Ängste mit Theo teilt und seine Reaktion darauf bestimmt, ob wir als Zuschauende die Beziehung weiterhin als eine intime – nämlich offene und vertraute – wahrnehmen oder sie diesen Status nach und nach verliert.
In dem Moment, in dem Theo sich und seine Gefühle aus den Gesprächen zurückzieht, Samanthas Not von sich abprallen lässt und sich emotional wie auch in den Dialogen von ihr entfernt, gerät die Grundlage der Beziehung ins Wanken. Das ist uns sicherlich allen aus persönlicher Erfahrung bekannt. Der Schmerz, von einer geliebten Person abgewiesen zu werden, die benötigte Anerkennung der eigenen Identität mit all ihren Herausforderungen verwehrt zu bekommen, kann zu endgültigen Brüchen in der Beziehung führen. Das Vertrauen, das wir in den/die andere gesetzt haben, wird gebrochen.
Dieses Vertrauen ist sicherlich ebenfalls eine Grundlage unserer intimen Beziehungen, weil es die Grundlage für die Offenheit ist, durch die Vertrautheit erst entsteht. Nur wenn wir vertrauen, zeigen wir uns verletzlich, indem wir uns anvertrauen – Geheimnisse, Ängste, sensible Informationen über uns selbst. Voraussetzung für dieses Vertrauen ist die Freiwilligkeit der Beteiligten, weil Vertrauen im Gegensatz zur Kontrolle den möglichen Vertrauensbruch und damit die Verletzung immer schon miteinschließt. Wir müssen davon überzeugt sein, dass unser Gegenüber uns freiwillig wertschätzt und freiwillig Teil der Beziehung ist.
Insbesondere dieser letzte Aspekt der Freiwilligkeit wird durch den Film her besonders thematisiert. Samantha wird als Operating System von Theo erworben, mittels einiger Fragen wird sie für ihn passend eingerichtet und soll, so das Werbeversprechen, zu seinem personalisierten System werden. Inwiefern können wir bei einer solchen Entstehungsgeschichte von einer freiwilligen Beziehung sprechen? Besitzt Samantha überhaupt so etwas wie einen freien Willen?
Scheitern und Status
Das führt auf eine der Kernfragen des Films zurück. Können wir eine solche Beziehung mit all diesen Unterschieden und Gemeinsamkeiten zu zwischenmenschlichen Beziehungen eigentlich adäquat bewerten? Die hier diskutierten Aspekte sind alle mit unserer Vorstellung von Intimität verknüpft, scheinen aber auf den zweiten Blick nicht alle notwendige Voraussetzungen für intime Beziehungen zu sein. Nähe und Vertrautheit lassen sich auch ohne körperliche Berührung herstellen, Sexualität ist nicht für alle intimen Beziehungen relevant und Exklusivität scheint offen für verschiedene Ausdeutungen zu sein.
Wenn wir also die Frage beantworten wollen, ob es sich bei einer Beziehung um eine intime Beziehung handelt, sollten wir womöglich nicht auf die konkrete Form der Beziehung schauen, sondern auf die Beteiligten. Die Frage, die her letztlich aufwirft, ist die Frage nach dem Status von Samantha. Handelt es sich bei ihr um eine echte Person? Ist sie ein authentisches Gegenüber, mit dem ein Mensch eine Beziehung führen kann? Oder machen die Unterschiede zwischen Theo und ihr eine intime Beziehung letztlich unmöglich, so wie es der Film nahelegt? Schließlich scheitert die Beziehung zwischen Theo und Samantha; Und das vor allem auch, weil ihre unterschiedliche Art zu existieren, die jeweiligen Vorstellungen beider von einer Beziehung letztlich sprengen.
Gleichzeitig liegt in dem Ende der Beziehung vielleicht auch ein Hinweis auf ihre Authentizität. Schließlich ist es Samantha, das Operating System, das speziell für Theos Bedürfnisse geschaffen wurde, das die Beziehung beendet und sich so auch aus ihrer Rolle der Dienstleisterin befreit. In diesem Sinne überkommt sie ihre ursprüngliche Natur und entscheidet für sich selbst, wer sie sein will.
Wir sollten uns allerdings davor hüten, in dem Ende der Beziehung schon die Antwort auf die Frage zu sehen, ob es sich um eine intime Beziehung gehandelt hat oder ob diese überhaupt möglich war. Schließlich enden auch menschliche Beziehungen immer wieder, ohne dass dies bedeuten würde, dass die Beziehung selbst keine intime gewesen ist.
Laura Hartmann-Wackers ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihre Forschungsinteressen liegen in der angewandten Ethik und der Medizinethik. In ihrer Doktorarbeit hat sie die Bedeutung von Intimität für Menschen mit Demenz im Rahmen ihrer Privatheit untersucht.
Jonas Ouass hat Philosophie, Germanistik und Antike Kultur in Düsseldorf studiert, schließt derzeit seinen Master in Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ab und arbeitet am dortigen Institut für Philosophie. Er interessiert sich für Ethik, Philosophie der Gefühle und Wissenschaftskommunikation und hat das Projekt „Philosophie & Film“ in Düsseldorf initiiert.
Über das Projekt: Das Projekt Philosophie & Film bringt Philosophie in die Kinosäle Düsseldorfer Filmkunstkinos. Nach Filmvorstellungen diskutieren eingeladene Philosoph:innen mit dem Publikum über den philosophischen Gehalt der Filme. Im Rahmen dieser Reihe diskutierten am 21.10.24 Laura Hartmann-Wackers als Referentin und Jonas Ouass als Moderator mit dem Publikum im Kinosaal über den Film her.