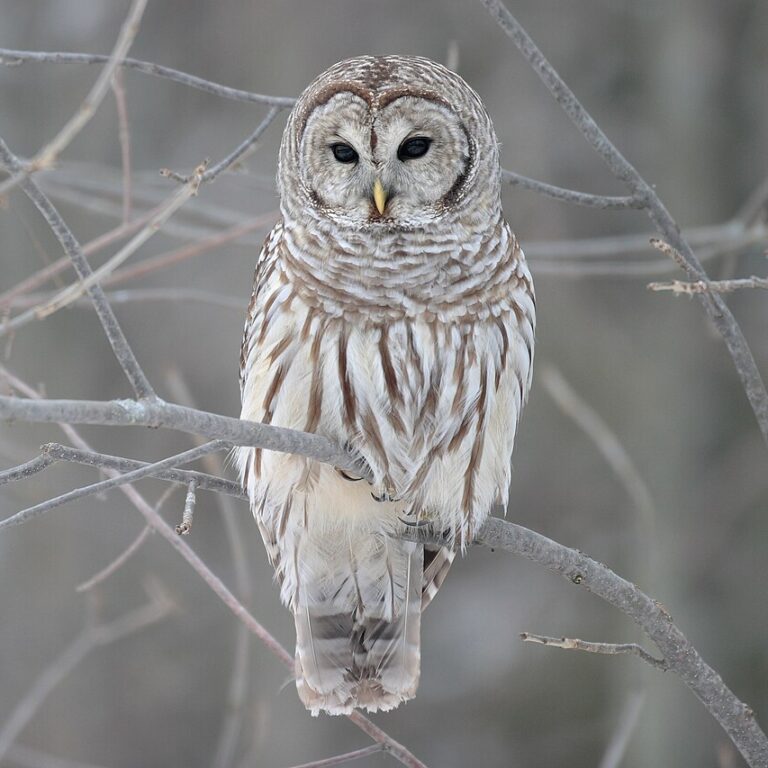History Matters – Der Wert der Philosophiegeschichte für die Frage danach, was Philosophie ist
Von Manuel Fasko (Basel)
Dieser Beitrag widmet sich nur indirekt der Frage, was Philosophie ist. Anstatt nämlich den Versuch zu unternehmen, diese diffizile Frage zu beantworten, möchte ich auf den Wert der Philosophiegeschichte zur Beantwortung dieser Frage hinweisen. In einem gewissen Sinne könnte man gar sagen, dass ich für die historische Situiertheit dieser Frage eine Lanze brechen möchte.
In concreto bedeutet dies, dass ich Folgendes darlegen werde: Die kanonische Geschichte der Philosophie spielt für die Frage, was Philosophie ist, eine wichtige Rolle, weil sie durch (implizite) Ausschlüsse und Diskriminierungen gekennzeichnet ist. Diese wiederum haben zu einer Verengung dessen geführt, was als Philosophie verstanden wird und wer als Philosoph*in gilt. Diese Wer-Frage spielt in der heutigen Debatte keine wichtige Rolle, ist aber – wenn wir die Geschichte in den Blick nehmen – sowohl brisant als auch relevant. Beide Punkte werde ich anhand des Beispiels des frühneuzeitlichen Kanons und mit Blick auf sexistische Ausschlüsse illustrieren (obschon man beinahe den gleichen Punkt mit Blick auf Ausschlüsse wegen Race, Klasse, u.v.m. machen könnte). Doch zunächst möchte ich einen Schritt zurückgehen und eine Vogelperspektive auf die metaphilosophische Debatte darüber, was Philosophie ist, einnehmen.
In der gegenwärtigen Debatte zu dieser Frage gibt es diverse umstrittene Punkte. So zum Beispiel diskutiert man über die (falls vorhanden) geeignete Methode für philosophische Untersuchungen, oder worum es in der Philosophie geht und was sie erreichen will. Während Philosophierende wie Goldman (1999) oder Williamson (2000, 2007) betonen, Wahrheit und Wissen seien die primären Ziele der Philosophie, argumentiert Elgin (2017) dafür, dass die Philosophie in erster Linie auf Verständnis und begriffliche Klärung ausgerichtet sei. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich Philosophierende wie Cavell (2005) oder Rorty (1979) auf nicht-epistemische Aspekte, wie die ‘therapeutische’ oder ‘praktische’ Dimension der Philosophie. Ein Ansatz, welcher Parallelen zu jenem von Nussbaum (2001) oder Kitcher (2011) aufweist, die beide die Bedeutung praktischer Weisheit und ethischen Verstehens hervorheben. Anders wiederum sind Denkende, wie Adorno (1966) oder Foucault (1975), davon überzeugt, dass die Kritik an der Gesellschaft oder der vorherrschenden Ideologie im Zentrum der Philosophie stehen sollte.
Der für meine Zwecke springende Punkt an dieser Debatte ist, dass trotz unterschiedlicher Ansichten über die Ziele etc. der Philosophie ein breiter Konsens darüber herrscht, dass die Geschichte der Philosophie ein wertvolles metaphilosophisches Werkzeug ist. Dies gilt insbesondere für Forschende wie MacIntyre (2013 [1981]) oder Taylor (1989). Diese stimmen alle darin überein, dass das Studium der Philosophie und deren Betreiben nicht von der Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte zu trennen ist.[1]
Trotz dieser Unterschiede würden viele Philosophierende darin übereinstimmen, dass eine sinnvolle Möglichkeit, die Frage danach, was Philosophie ist, zu beantworten, darin besteht, ihre Geschichte zu untersuchen und illustrative Beispiele im Sinne von „Philosophie ist das, was X, Y und Z getan haben“ zu identifizieren – und vielleicht einen gemeinsamen Nenner in ihren Aktivitäten zu finden (z.B. Antognazza 2015, Elgin 2017, Kitcher 2012, Nussbaum 1994, Saporiti 2017, Williamson 2007). Diese illustrativen Beispiele erfüllen eine Rolle ähnlich der Kuhnschen (1993 [1970], 23) Paradigmen – allgemein anerkannte Beispiele für vorbildliche Philosophie. So würden die meisten Metaphilosoph*innen trotz unterschiedlicher Ansichten wahrscheinlich zustimmen, dass gute Philosophie das ist, was Figuren wie Aristoteles, Kant oder Wittgenstein betrieben haben. Bei diesen Namen spricht man auch von “kanonischen Denkenden” – d.h., sie sind integraler Bestandteil des Kanons der Philosophie. Jedoch bedarf die Rede “des Kanons” einer Klärung.
Eine sinnvolle Möglichkeit, sich mit einer Disziplin wie der Philosophie vertraut zu machen, besteht darin, ihren Kanon zu untersuchen – d.i., ihren „internen Kern“, der auch die „äußeren Grenzen“ definiert und hilft sie von verwandten Forschungs- und Lehrfeldern abzugrenzen (Amarosa & Vergerio 2022, 472). In der Philosophie – wie könnte es auch anders sein – ist es umstritten, ob es einen einzigen Kanon gibt (Westphal 1993). Wie soll es denn auch den Kanon geben, wenn weder darüber Einigkeit herrscht, was Philosophie ist, worauf sie abzielt oder welcher Mittel sie sich bedienen soll. Es ist deshalb wohl präziser in der Philosophie von mehreren Kanones zu sprechen, welche an Epochen, Debatten, Themen oder Subdisziplinen gebunden sein können. Trotz dieser Pluralität dienen diese Kanones jedoch weiterhin als interner Kern. Dabei besteht so ein Kanon typischerweise aus einer Liste von Figuren und den von ihnen verfassten ‘Pflichtlektüren’, in welchen wir ihre Schlüsselargumente und Kernideen finden sollen (z.B. Copleston 2003 [1946–74], Garvey & Stangroom 2012, Stokes 2003). Mit anderen Worten, ein Kanon soll – zumindest dem Anspruch nach – die „Crème de la Crème“ (Waithe 2015, 22) einer bestimmten Epoche, Debatte oder Subdisziplin umfassen. Das heisst, es soll sich um „das Beste, was gedacht und gesagt wurde“, handeln, wie man in Anlehnung an Matthew Arnold (1960 [1869]) sagen könnte. Dabei legen diese Kanones in der Regel ein Augenmerk auf die Figuren selbst, womit eine grosse Ähnlichkeit zwischen einem solchen philosophischen Kanon und den literarischen Kanones vor den sogenannten „Kanonkriegen“ besteht: Es dominiert eine „grosse Männer“-Perspektive oder ein Heldennarrativ. (Im Nachgang der Kriege gab es in den Literaturwissenschaften übrigens einen Wechsel hin zu einem textzentrierten Ansatz vgl. z.B. Bloom 2014.)
Ein Kanon erfüllt verschiedene Funktionen. Für Philosophiehistoriker*innen bestimmt der Kanon bspw. wer und was sie zu bearbeiten haben. Für die Philosophie der Frühen Neuzeit sind das in erster Linie die „sieben Großen“: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume und Kant (vgl. z.B. Gottlieb 2000, Grayling 2019, Kenny 2012). Diese Figuren stehen im Mittelpunkt der frühneuzeitlichen Philosophie, wobei der Schwerpunkt von Forschenden zudem auf bestimmten Werken, Argumenten oder Ideen dieser Denker liegt, während andere Schriften, Gedanken oder Äusserungen vernachlässigt werden bzw. worden sind. Mit anderen Worten: Der frühneuzeitliche Kanon besteht aus einer Liste großer Denker, die bestimmte Werke (typischerweise desselben Genres) sowie Argumente und Ideen (konzentriert auf einen ähnlichen Fragenkatalog) als die zentralen philosophischen Meilensteine hervorheben, welche im Kontext der frühneuzeitlichen Philosophie einer Auseinandersetzung Wert sind.
Nehmen wir zur Illustration den Fall von George Berkeley (1685-1753). Bei Berkeley liegt der Forschungsfokus auf seinen zwei sogenannten ‘Hauptwerken’ den Prinzipien von 1710 und den Drei Dialogen von 1713 (beide werden 1734 von Berkeley überarbeitet und nochmals publiziert). Dabei interessiert man sich insbesondere für die in diesen Werken enthaltenen Argumente für Berkeleys Immaterialismus – d.h., Berkeleys These, dass es nur Immaterielles gibt, sprich Geister und Ideen. Alle anderen Schriften Berkeleys wie etwa Passive Obedience (1712), An Essay Towards Preventing the Ruin of Great Britain (1721), De Motu (1725,) Alciphron (1732), Querist (1737), Siris (1744), oder Maxims concerning Patriotism (1750), um nur einige zu nennen, finden dabei keine oder wenig Aufmerksamkeit von Forschenden. Und damit bleiben auch seine politischen, ethischen oder mathematischen Thesen und Positionen weitgehend unberücksichtigt (Blechl 2019). Es ist mitunter deshalb, dass der Umstand bis heute kaum Beachtung gefunden hat, dass Berkeley den transatlantischen Handel mit versklavten Personen in Theorie (Glasson 2010) und Praxis unterstützte und selbst versklavte Personen besass (Jones 2021, 232-42). (Als persönliche, aber dennoch illustrative, Anekdote mag hier der Hinweis genügen, dass ich von diesem Umstand erst 2021 erfuhr, nachdem ich über drei Jahre an einem Dissertationsprojekt zu Berkeley gearbeitet habe).
Lange Rede, kurzer Sinn: Der frühneuzeitliche Kanon führt dazu, dass man sich mit einer sehr engen Auswahl von Denkenden beschäftigt. Dabei wird der Fokus dadurch weiter verengt, dass von diesen wenigen Denkenden ausgewählte Schriften, Argumente etc. bevorzugt behandelt werden – während andere Aspekte ihrer Philosophie wenig beleuchtet werden oder gar gänzlich unbeleuchtet bleiben. Auf den ersten Blick mag diese Verengung auch nicht als weiter schlimm erscheinen. So scheint doch der Wunsch danach legitim, sich nur mit dem Besten befassen zu wollen, was die frühneuzeitliche Philosophie zu bieten hat. Insbesondere wenn man in der heutigen metaphilosophischen Debatte tätig ist, stellt sich doch die Frage, weshalb man die beschränkte Zeit, die zur Verfügung steht, für etwas weniger als das Allerbeste aufwenden sollte. Aber auf den zweiten Blick sollte die (implizite) normativ-präskriptive Kraft dieser Verengung nicht unterschätzt werden. So bestimmt der frühneuzeitliche Kanon für die gegenwärtige Metaphilosophie noch stärker, auf wen oder was man sich konzentrieren soll, wenn man aus der Philosophie der Frühen Neuzeit schöpfen möchte. Das ist insofern problematisch, als diese Verengung mit einer frappanten Homogenität einhergeht, sowohl was die Personen als auch die Themen betrifft. So sind alle Mitglieder des frühneuzeitlichen Kanons weiße Europäer. Mit Ausnahme von Spinoza wurden sie alle als Christen geboren, und mit Ausnahme von Berkeley waren sie alle ledig. Es handelt sich damit, wie es Hutton (2015) treffend bemerkt, um „Blue-eyed Philosophers Born on Wednesdays“.
Wenn man diese Liste ‘grosser Denker’ betrachtet, stellt sich bspw. zu Recht die Frage, ob es wirklich stimmt, dass in dieser Zeit keine Frauen Philosophie betrieben haben. Es zeugt dabei von der Wirkungsmacht des Kanons, dass diese Frage in der Forschung erst relativ spät aufgeworfen und durch Forschende, wie Atherton (1994) und O’Neill (1998), negativ beantwortet worden ist. Feministische Kritiker*innen des (frühneuzeitlichen) Kanons haben in der Folge nicht nur gezeigt, dass es in der Frühen Neuzeit (aber auch in jeder anderen Epoche) tatsächlich Philosophinnen gegeben hat, sondern auch, dass deren Ausschluss aus dem Kanon nicht auf deren mangelnden philosophischen Verdiensten oder der philosophischen Qualität (was immer das genau umfasst) beruhte. Vielmehr ist der Ausschluss von Frauen aus dem frühneuzeitlichen Kanon im 19. Jahrhundert in erster Linie auf hermeneutische Ungerechtigkeiten und Sexismus zurückzuführen. Denn nicht nur wurden bestimmte Themen wie bspw. Emotionen ‘feminisiert’ und als unphilosophisch betrachtet, sondern der Platz von Frauen in der Philosophie wurde sowohl von kanonischen Denkern wie Kant hinterfragt und von Architekten bzw. Trägern des Kanons wie Karl Joël explizit bestritten.
Als Reaktion darauf gab es in den letzten Jahrzehnten verstärkte Bemühungen, den frühneuzeitlichen Kanon zu erweitern und zu überarbeiten. Allgemein gesprochen bezieht sich die (feministische) Kanonerweiterung auf den Prozess, den traditionellen Kanon zu erweitern, um eine diversere Gruppe von Figuren, Werken, Argumenten und Ideen einzubeziehen – mit besonderem Schwerpunkt darauf, jene zu berücksichtigen, welche historisch marginalisiert oder ausgeschlossen worden sind (vgl. dazu auch Witt 2006, Shapiro 2016, Broad 2023, Ebbersmayer 2023).
Kurzum, wenn man die Entstehung des frühneuzeitlichen Kanons betrachtet, muss man sich von der Idee verabschieden, dass dieser daraus entstanden wäre, dass sich die besten Denker*innen, Ideen oder Argumente auf dem ‘Marktplatz der Ideen’ durchgesetzt hätten. Die philosophische Qualität von Descartes et al. soll damit nicht bestritten werden. Aber ein Blick auf die Historiographie dieses Kanons macht mehr als deutlich, dass der Sexismus (und andere Ideologien) seiner Architekten ebenfalls ein entscheidender Faktor ist (vgl. auch Braun 1973, Elberfeld 2023, Hartung 2023). Anders gesagt, der Umstand, dass wir im frühneuzeitlichen Kanon eine äusserst homogene Gruppe von Philosophen finden, hat nicht etwa damit zu tun, dass nur oder primär (ledige) europäische Christen gute Philosophie betrieben. Vielmehr wurde die Mehrheit von potentiellen Mitgliedern, nämlich quasi alle, die nicht zu dieser äussert homogenen Gruppe gehörten, im Vorhinein systematisch von der Betrachtung ausgeschlossen. Das heisst, die Verengung, welche der Kanon produziert, ist alles andere als das Resultat eines neutralen Selektionsprozesses des Besten, was die Frühe Neuzeit zu bieten hat. Vielmehr kam überhaupt nur eine bestimmte Art von Personen, Werken oder Argumenten überhaupt in Frage.
Betrachten wir deshalb nochmals den Ausschluss der Frauen aus der Geschichte der frühneuzeitlichen Philosophie. Aufgrund sexistischer (u.v.m.) Motive kommt es damit zu einer thematischen und personellen Verengung. Dabei mögen die dahinterstehenden Motive als überholt gelten, aber sie haben dennoch Auswirkungen auf die Philosophie und ihr Selbstverständnis. So ist das Erbe dieses sexistischen Ausschlusses bis heute spürbar, beispielsweise in Form des Gender-Gaps in der universitären Philosophie (z.B. Herfeld, Müller, von Allmen 2022, Nieswandt 2021, Thompson 2017). Wenn man sich diesem Ausschluss (und weiteren betreffend bspw. Klasse, Religion, Race, Spezies u.v.m.) bewusst ist, ist es zudem kaum verständlich, dass die Frage danach, wer Philosoph*in ist bzw. sein kann, in der gegenwärtigen metaphilosophischen Diskussion keine wesentliche Rolle spielt – gerade, weil die Philosophiegeschichte weitgehend als wertvolles metaphilosophisches Werkzeug anerkannt ist. Stattdessen scheint die Wer-Frage als trivial angesehen zu werden und die (oft implizite) Überlegung zu gelten: Wenn jemand Philosophie betreibt, zählt diese Person als Philosoph*in. Folglich fehlen oft Diskussionen der Wer-Frage in metaphilosophischen Überblicken wie z. B. in jenen von Overgaard, Gilbert und Burwood (2013) oder dem von Rescher (2014). Betrachtet man diese Wer-Frage durch die Linse der Forschungsresultate der frühneuzeitlichen Kanonerweiterung zeigt sich jedoch ihre (historische) Bedeutung und Brisanz. Die letzten Jahrzehnte haben nämlich gezeigt, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen der Frage, wer als Philosophierender gilt (d.i. hauptsächlich weiße Männer), und dem, was als Philosophie betrachtet wird (d.h. bestimmte Werke, Ideen und Argumente).
Als illustratives Beispiel für diese Verbindung mag hier ein Verweis auf Mary Midgelys Ausführungen genügen. Wie Ellie Robson (2025) kürzlich dargelegt hat, hat Midgely bereits darauf hingewiesen, dass die Art von Denkenden in der Philosophie einen wesentlichen Einfluss darauf gehabt hat, über was nachgedacht wird. So schreibt Midgely:
“Philosophers have generally talked for instance as though it were obvious that one consciousness went to one body, as though each person were a closed system which could only signal to another by external behaviour, and that behaviour had to be interpreted from previous experience. I wonder whether they would have said the same if they had been frequently pregnant and suckling, if they had been constantly faced with questions like, “What have you been eating to make him ill?”, […], if in a word they had got used to the idea that their bodies were by no means exclusively their own?” (Midgley “Rings and Books”)
In der zitierten Passage weist Midgely darauf hin, dass die Überzeugung, dass zu jedem Körper nur ein Bewusstsein gehört, nicht für jede Art von Person als selbstverständlich erscheint, dass sogar die Sollipsismus-Frage (d.h., die Frage danach, ob es ausser mir noch andere Wesen mit Bewusstsein gibt) – welche bis heute diskutiert wird – weitaus nicht für alle Arten von Personen gleichermassen drängend erscheint. Kurzum, Midgley will darauf hinaus, dass gewisse Fragen – welche in der Philosophie hohes Ansehen geniessen – nicht per se universell relevant sind. Sie könnten auch insofern kontigent sein, als ihre (scheinbare) Dringlichkeit (auch) von der Perspektive jener abhängt, welche diese Fragen stellen; einen ähnlichen Punkt macht Charles W. Mills (2015, 8-9) im übrigen mit Bezug auf den Aussenweltskeptizismus, welche aus der Sicht einer unterdrückten und diskriminierten Person schlicht als lächerlich erscheint, da ihre konstant negativen Erlbenisse mit der Aussenwelt wenig Zweifel an deren Echtheit zulassen.
Es gäbe hier natürlich noch vielmehr zu sagen, aber an dieser Stelle möchte ich mich mit dem Hinweis begnügen, dass weder Midgely oder Mills noch ich sagen möchten, dass das Solipsismus-Problem oder der Aussenweltskeptizismus keine philosophischen Probleme sind. Man mag zwar aus dem, was sie sagen, die Lehre ziehen, dass philosophische Probleme kontingent sind, aber diese Lehre ist keineswegs eine notwendige Konsequenz ihrer (oder meiner) Position. Zudem missversteht ein Augenmerk auf Kontingenz-Fragen den Punkt, den ich hier machen möchte. Denn was ich mit dem Verweis auf Midgely und Mills aufzeigen möchte, ist, dass die Philosophiegeschichte mitunter deshalb relevant ist, weil es sein kann, dass wir aufgrund der historischen Homogenität der Philosophie die Kontingenz gewisser Probleme übersehen haben oder auch gewisse Probleme nicht als philosophische erkannt haben.
Kurzum, wenn wir zur heutigen metaphilosophischen Debatte zurückkehren, lässt sich vor diesem Hintergrund festhalten, dass wir nicht ‘aus dem Vollen’ schöpfen, wenn nur kanonische Denker und Werke betrachtet werden. Eine (bzw. die bisherige) unkritische Nutzung der kanonischen Philosophiegeschichte in dieser Debatte kann nämlich dazu führen, dass man sich, zusammen mit den historischen Vorbildern, (implizite) Mechanismen der Diskriminierung einkauft. Und die damit einhergehende Verengung kann zu einer (ungebührlichen) Verengung des Philosophieverständnis führen und potentielle Kontingenzen in Fragestellungen und Antwortoptionen übersehen. Wenn aber zeitgenössische Metaphilosophierende die historischen Ausschlüsse im Zusammenhang mit der Wer-Frage berücksichtigen würden, hat dies das Potenzial ihre Antworten auf die Frage danach, was Philosophie ist, zu erweitern. Insbesondere dann, wenn sich durch das Berücksichtigen von historisch marginalisierten und anderen nicht-kanonischen Stimmen zeigen sollte, dass es gute Gründe zur Annahme gibt, dass einige (oder gar alle) der bisherigen Antworten auf diese Was-Frage kontingent sind – denn gerade dann eröffnet eine Vielfalt von Perspektiven einen neuen und innovativen Möglichkeitshorizont.
Im Sinne eines Fazits lässt sich damit festhalten, dass die Geschichte der Philosophie aus mindestens zwei Gründen relevant ist für die gegenwärtige Diskussion der Frage danach, was Philosophie ist. Zum einen trägt ein kritisches Bewusstsein für die kanonische Philosophiegeschichte dazu bei, sich der potenziellen Verengung der gegenwärtigen metaphilosophischen Debatte bewusst zu werden (inkl. der Kontingenzfrage). Zum anderen kann die Kanonerweiterung in der Geschichte der Philosophie neue Antworten auf diese Frage aufdecken, da sie bereits bezüglich dessen, wer als Philosoph*in gelten soll, den Möglichkeitshorizont geöffnet hat und damit implizit auch neue Antworten auf die Frage danach mitaufgedeckt hat, was als Philosophie gelten kann (von Inhalt über Werk – bis hin zu Argumentationstypen). Nun liegt es an den Teilnehmenden der zeitgenössischen Debatte zu prüfen, ob diese Antworten auch einen Erkenntnisgewinn erzielen.
Manuel Fasko ist Postdoc am Lehrstuhl für Theoretische Philosophie an der Universität Basel. Er interessiert sich für Debatten in frühneuzeitlicher Philosophie der Kanonkonstruktion und deren Auswirkungen auf heute.
[1] Es gibt jedoch auch Philosophierende wie Sorrell und Rogers (2005) oder solche, die Quine (2013 [1960]) folgen, in der Betonung der Kontinuität zwischen Philosophie und empirischer Wissenschaft. Das geht oftmals damit einher, dass die Geschichte eine untergeordnete Rolle spielt, da für diese Leute wichtig ist, was wir heute wissen und nicht, welchen Irrtümern wir mal aufgesessen sind
Literatur (Empfehlungen hervorgehoben)
Atherton, Margaret, ed. Women philosophers of the early modern period. Indianapolis/Cambridge: Hackett, 1994.
Adorno, Theodor W. Negative Dialektik. Surhkamp, 1966.
Amorosa, Paolo, and Claire Vergerio. “Canon-making in the history of international legal and political thought.” Leiden Journal of international law 35, no. 3 (2022): 469-478.
Antognazza, Maria Rosa. “The benefit to philosophy of the study of its history.” British Journal for the History of Philosophy 23, no. 1 (2015): 161-184.
Arnold, Matthew. Culture and Anarchy. Cambridge: Cambridge University Press, 1960.
Blechl, John Edward. Active Berkeleyanism: Containing an exposition of an improved methodology for Berkeleyan scholarship via a new unified interpretation of Berkeleyanism, with objections and replies. Diss. University of York, 2019.
Bloom, Harold. The western canon: The books and school of the ages. Houghton Mifflin Harcourt, 2014.
Braun, Lucien Histoire de l’histoire de la philosophie. Ophrys, 1973.
Broad, Jacqueline. “Recent Work in Early Modern Women’s Philosophy: Some Implications for the Canon.” Mind 132, no. 528 (2023): 1126-1141
Cavell, Stanley. Philosophy the Day After Tomorrow. Harvard University Press, 2005.
Copleston, Frederick. History of Philosophy Volume 1: Greece and Rome. A&C Black, 2003.
Ebbersmeyer, Sabrina. “From a ‘memorable place’ to ‘drops in the ocean’: on the marginalization of women philosophers in German historiography of philosophy.” Historiographies of Philosophy 1800–1950, edited by Mogens Lærke and Leo Catana: 12-32. Routledge, 2023.
Elberfeld, Rolf, ed. Philosophiegeschichtsschreibung in globaler Perspektive. Felix Meiner Verlag, 2017.
Elgin, Catherine. True Enough. MIT Press, 2017.
Foucault, Michel. Surveiller et punir. Vol. 1. Gallimard, 1975.
Garvey, James, and Jeremy Stangroom. The Story of Philosophy: A history of Western thought. Hachette, 2012.
Glasson, Travis. ““Baptism doth not bestow Freedom”: Missionary Anglicanism, Slavery, and the Yorke-Talbot Opinion, 1701-30.” William & Mary Quarterly 67, no. 2 (2010): 279-318
Goldman, Alvin. Knowledge in a Social World. Oxford University Press, 1999.
Gottlieb, Anthony. The dream of reason: a history of western philosophy from the Greeks to the Renaissance. WW Norton & Company, 2000.
Grayling, Anthony C. The history of philosophy. Penguin, 2019.
Hartung, Gerald. “Selbstkritische Philosophiegeschichtsschreibung als Arbeit am Kanon.” Deutsche Zeitschrift für Philosophie 71.2 (2023): 205-225.
Hutton, Sarah. “‘Blue-Eyed Philosophers Born on Wednesdays’: An Essay on Women and History of Philosophy.” The Monist 98, no. 1 (2015): 7- 20.
Herfeld, Catherine, Jan Müller, and Kathrin Von Allmen. “Why Do Women Philosophy Students Drop Out of Philosophy? Some Evidence from the Classroom at the Bachelor’s Level.” Ergo: An Open Access Journal of Philosophy 8, no. 51 (2022): 741-786.
Joël, Karl. Die Frauen in der Philosophie. Verlagsanstalt und Druckerei A.G., 1896.
Jones, Tom. George Berkeley: A Philosophical Life. Princeton University Press, 2021.
Kenny, Anthony. A new history of Western philosophy. Oxford University Press, 2012.
Kitcher, Philip. The ethical project. Harvard University Press, 2011.
Kitcher, Philip. Preludes to pragmatism: Toward a reconstruction of philosophy. Oxford University Press, 2012.
Kuhn, Thomas S. The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press, 1997.
Lærke, Mogens, and Leo Catana, eds. Historiographies of Philosophy 1800–1950. Taylor & Francis, 2023.
MacIntyre, Alasdair. After virtue. A&C Black, 2013.
Midgely, Mary. “Rings and Books”. 1950’s. https://ravenmagazine.org/magazine/rings-books/
Mills, Charles W. Blackness visible: Essays on philosophy and race. Cornell University Press, 2015.
Nieswandt, Katharina. “Gender Ratio in Philosophy: An Inferential-Statistical Model of Possible Determinants.” 2021: https://www.acpcpa.ca/blogs/gender-ratio-in-philosophy-an-inferential-statistical-model-of-possible-determinants
Nussbaum, Martha. The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton University Press 1994.
Nussbaum, Martha C. The fragility of goodness: Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy. Cambridge University Press, 2001.
O’Neill, Eileen. “History of Philosophy: Disappearing Ink: Early Modern Women Philosophers and Their Fate in History.” Philosophy in a Feminist Voice: Critiques and Reconstructions,edited by Janet A. Kourany: 17-62. Princeton University Press, 1998.
Overgaard, Søren, Paul Gilbert, and Stephen Burwood. An introduction to metaphilosophy. Cambridge University Press, 2013.
Quine, Willard Van Orman. Word and object. MIT press, 2013.
Rescher, Nicholas. Metaphilosophy: Philosophy in philosophical perspective. Lexington Books, 2014.
Robson, Ellie. “So many unmarried men.“ AEON (02.2025). https://aeon.co/essays/for-mary-midgley-philosophy-must-be-entangled-in-daily-life
Saporiti, Katia. “Wozu überhaupt Geschichte der Philosophie? Die Kontingenz philosophischer Probleme und der Nutzen der Philosophiegeschichte für die Philosophie.” Studia Philosophica 76 (2017): 115-136.
Shapiro, Lisa. “Revisiting the early modern philosophical canon.” Journal of the American Philosophical Association 2, no. 3 (2016): 365-383.
Shapiro, Lisa. “How to Change a Philosophical Canon.” In Historiography and the Formation of Philosophical Canons edited by Sandra Lapointe and Erich H. Reck: 52-71. Routledge, 2023.
Sorell, Tom, and G. Rogers. “On Saying No to History of Philosophy.” In Analytic Philosophy and History of Philosophy edited by Tom Sorell, and Graham Alan John Roger: 43-60. Clarendon Press, 2005.
Stokes, Philip Andrew. Philosophy, 100 essential thinkers. Enchanted Lion Books, 2003.
Taylor, Charles. Sources of the self: The making of the modern identity. Harvard University Press, 1989.
Thompson, Morgan. “Explanations of the gender gap in philosophy.” Philosophy Compass 12, no. 3 (2017): e12406.
Williamson, Timothy. Knowledge and Its Limits. Oxford University Press, 2000.
Williamson, Timothy. The Philosophy of Philosophy. Blackwell Publishing, 2007.
Waithe, Mary Ellen. “From Canon Fodder to Canon-Formation: How Do We Get There from Here?.” The Monist 98, no. 1 (2015): 21-33.
Witt, Charlotte. “Feminist interpretations of the philosophical canon.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 31, no. 2 (2006): 537-552.