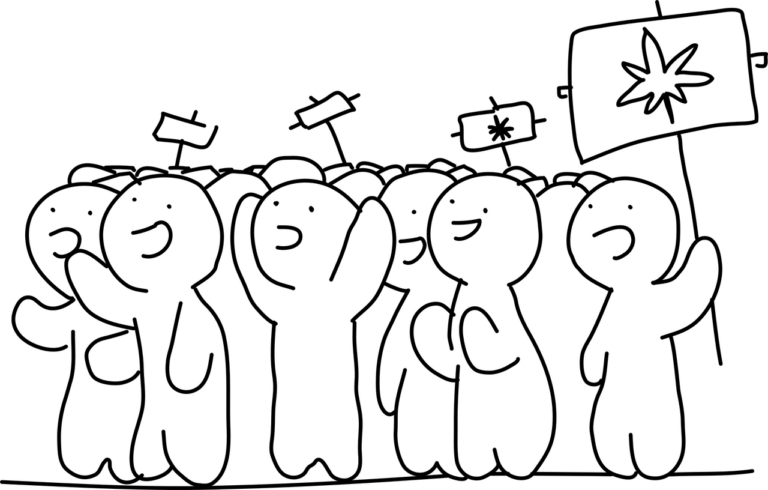Wissenschaftsfreiheit in der Demokratie oder Wozu ist das Gut der Wissenschaftsfreiheit gut?
Von Elif Özmen (Gießen)
Es ist kein Zufall, dass die Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre unter ein und denselben Art. 5 GG fallen mit der Freiheit der Meinung, Information, Presse und Kunst. Der Verbund dieser Kommunikationsgrundrechte dient dem Schutz einer kritischen Öffentlichkeit, die als unverzichtbar gilt für den Bestand und das Prosperieren der Demokratie. Zwar ist Wissenschaftsfreiheit kein universelles Menschen- oder Bürgerrecht. Aber ihre förderlichen Wirkungen entfaltet sie nicht nur innerhalb wissenschaftlicher Institutionen und Tätigkeitsfelder, sondern auch im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft.
Daher möchte ich vorschlagen, die aktuellen Debatten um eine zunehmende „Politisierung“ und „Moralisierung“ der Wissenschaft (auch) als Auseinandersetzungen zu verstehen über die Gelingensbedingungen der freien Wissenschaft in der freiheitlichen Demokratie. Das würde auch das große öffentliche Interesse erklären, das sich zuletzt an dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit entzündet hat. Bezüglich anderer Gefährdungen der freien Wissenschaft, Forschung und Lehre (wie die weltweite Zunahme staatlicher Zensur-, Regulierungs- und Verfolgungsmaßnahmen oder die Ökonomisierung und Bürokratisierung der Hochschulen) bleibt ein solches Interesse bislang ebenso aus wie eine lautstarke mediale Orchestrierung. Dabei zeigen die Warnungen vor den wissenschaftsschädlichen Wirkungen von political correctness, cancel culture oder chilling effects auffällige Parallelen zu einem anderen gesellschaftlichen Konfliktthema: den Gegenständen und Grenzen der Meinungsfreiheit. Auch deswegen hat sich die Debatte um Wissenschaftsfreiheit zu einer stetigen Ausweitung der Kampfzone entwickelt, deren Feind-Freund-Antagonismus bereits in früheren Beiträgen beklagt oder verteidigt wurde. Die allseits beschworene Wissenschaftsfreiheit scheint zu einem umkämpften Begriff geworden zu sein, der von verschiedenen Seiten (etwa: liberal vs. konservativ, links vs. rechts, woke vs. boomer) zu durchaus unterschiedlichen Zwecken vereinnahmt werden kann. Man könnte das als eine Politisierung und Moralisierung der Wissenschaftsfreiheit selbst bezeichnen.
Dabei ist Wissenschaftsfreiheit, zumal in der deutschen Verfassungstradition, ein spezifischer Rechtsbegriff, der sich solcher Vereinnahmungen widersetzt. Die Freiheit der Wissenschaft, Lehre und Forschung wird als defensives und konstitutives Individualrecht ohne Gesetzesvorbehalt im Grundgesetz garantiert. Als Wissenschaft gilt, was nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung von Wahrheit anzusehen ist, d.h. auch Mindermeinungen, fehlerhafte Forschungsansätze, unkonventionelle, unfruchtbare, erratische Hypothesen, Theorien und Positionen. Was oder wer den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit systematisch verfehlt, darf aber nicht rechtlich entschieden werden, sondern bleibt den Kontroll- und Sanktionsmechanismen der Wissenschaftsgemeinschaft überantwortet (hierzu BVerfGE 90, 1 (13)). Folglich können außerwissenschaftliche Sanktionen und Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit nur durch eine Kollision mit gleichwertigen Rechtsgütern begründet werden, namentlich Würde, Leben, körperliche Unversehrtheit, Gesundheit sowie Tier- und Umweltschutzgesetzen.
Wissenschaft folgt ihren eigenen Zwecken und ist in diesem Sinne frei von politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Finalisierungen zu halten. Das bedeutet aber nicht, dass sie neutral oder indifferent sei oder sich der Verantwortung für ihre möglichen Anwendungen und gesellschaftlichen Folgen entziehen könnte mit Verweis auf ihre Freiheit. So entbindet die Lehrfreiheit gerade nicht von der Verfassungstreue (eine Einschränkung, die für bloße Meinungsfreiheit nicht gilt). Zudem sind für verbeamtete Hochschullehr*innen weitere Freiheitseinschränkungen gegeben. Der Wissenschaftler als Beamter hat sich durch sein gesamtes, also auch privates Verhalten, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen, für deren Erhalt einzutreten und muss bei politischer Betätigung auch außerhalb der Hochschule Mäßigung und Zurückhaltung walten lassen. Somit sind Wissenschaft, Forschung und Lehre, die dem menschlichen Wohl oder den freiheitlich-demokratischen Werten zuwiderlaufen, wissenschaftsintern und -extern kritisch zu evaluieren. Wissenschaftsfreiheit ist ohne Verantwortung der Wissenschaft(ler*innen) nicht zu haben, vielmehr verpflichtet gerade die weitreichende Freiheit von Fremdbestimmung – und auch die für Deutschland nach wie vor übliche Finanzierung der Hochschulen durch die Gesamtgesellschaft – zu einer verantwortungsvollen Selbstbestimmung und Selbstkontrolle. Daher erschöpft sich das Gut der Wissenschaftsfreiheit auch nicht in seiner positiv-rechtlichen Satzung und juristischen Auslegung, sondern ist eingebettet in ein umfassenderes Normen- und Sanktionsgefüge der Wissenschaftsgemeinschaft.
Zu diesem Wissenschaftsethos gehört, dass die Freiheit der Wissenschaft unberührt davon bleibt, ob die konkreten wissenschaftlichen Meinungen, Theorien oder Personen krude, unliebsam, unbequem, bigott oder reaktionär sind, sich als unvernünftig, unbegründet oder abwegig erweisen lassen oder als beunruhigend, schockierend oder verletzend empfunden werden. Das ausgezeichnete Mittel der Kritik oder Zurückweisung einer solchen wissenschaftlichen Positionierung ist die Gegenrede, der Widerspruch, das argumentative Contra. Das Recht der Freiheit der Wissenschaft ist also, hier analog zur Meinungsfreiheit, ein Recht, das man auf eigenes Risiko wahrnimmt und das kein Recht auf Affirmation und Solidarität nach sich zieht. Aber zugleich bildet das Ethos der Wissenschaft mit seinen eigentümlichen epistemischen und ethischen Werten und Tugenden das normative Fundament, auf dem sich der wissenschaftliche Disput, die harte argumentative Auseinandersetzung, ja, der wilde Streit um die richtige Meinung, These und Theorie fruchtbar entfalten kann.
Die aktuellen Debatten um die Wissenschaftsfreiheit sind auch Debatten darüber, wie dieses normative Fundament auszubuchstabieren und ggf. zu erweitern wäre. Dabei ist die Häufung englischer Begrifflichkeiten augenfällig. In vielen US-amerikanischen Hochschulen bestimmen seit den späten 1980er Jahren progressive Reformen und emanzipative Normsetzungen im Zeichen von Gleichberechtigung, Diversität und Gerechtigkeit den akademischen Alltag. Zu diesem gehören auch konkrete (und weitgehend unübersetzbare) Forderungen nach speech codes, trigger-warnings, safe spaces, no-platforming ebenso wie die Bereitschaft, denjenigen, die diesen Forderungen nicht nachkommen – etwa, weil sie nicht einverstanden sind, weil sie verständnislos bleiben oder es ihnen an Zeit, Lust und Interesse fehlt – mit großer Härte zu begegnen. Dem Ideal der Wissenschaftsfreiheit werden also weitere Ideale – wie Gerechtigkeit, Gleichheit, Nicht-Diskriminierung, aber auch Anerkennung, Affirmation und Empowerment – zur Seite und fallweise auch vorangestellt. Das führt regelmäßig zu Interventionen und Protesten, die von Mitgliedern der Wissenschaftsgemeinschaft (wie Kolleg*innen, Studierenden und ihren Vertretungen, Hochschulleitungen) ebenso wie von Externen (sozialen Bewegungen, politischen oder weltanschaulichen Parteiungen, sozialmedialen Aktivisten) gegen bestimmte wissenschaftliche Inhalte, Texte, Fragestellungen, Denkfiguren oder Sprachverwendungen vorgebracht werden.
Ich sehe nicht, wie man das anders als eine Einschränkung – wenngleich mit einer mutmaßlich guten Absicht – der Denk- und Debattierräume der Hochschulen und Wissenschaftler*innen interpretieren kann. Mit Blick auf das Gut der freien Wissenschaft und der kritischen Universität scheint es mir daher prima facie zwingend, ein solches vermeintes Recht, akademische Freiheiten aus Gerechtigkeitsliebe zu opfern, zurückzuweisen. Immerhin gehören neue Perspektiven, unkonventionelle Thesen, kontrafaktische Annahmen, konfrontative Meinungen, zivilisierter Streit und unversöhnliche Dissense zur Essenz der Wissenschaft. Die Räume der Wissenschaft sind Räume der Gründe. Die rationalen Gütekriterien sind hoch; der wissenschaftlichen Rede folgt gemeinhin Kritik und Gegenrede; die Vorwegnahme der Gegenposition zur eigenen und deren ernsthafte Reflexion sind der wissenschaftliche Idealfall; die sachbezogene Beharrlichkeit (statt Ablenkung, Themenwechsel, bullshitting) der diskursive Standard.
Aber auf den zweiten Blick scheint mir ebenso unbestreitbar, dass ein gemeinsames wissenschaftliches Ethos und eine geteilte akademische Kultur den Rahmen für die Möglichkeit und den Bestand solcher epistemischer Freiräume bilden. Daher sollte man nicht bloß von den Abwehrrechten sprechen, die mit der Freiheit der Wissenschaft verbunden sind, sondern auch die Haltungen, Tugenden und Pflichten in den Blick nehmen, die sie flankieren und stützen. Welche Rolle spielen etwa intellektuelle Redlichkeit, Wohlwollen, Gelassenheit, Tapferkeit und Toleranz für die Praxis der freien Wissenschaft? Und wie ist demgegenüber ein Bedürfnis (oder auch die Forderung) nach epistemischer Gerechtigkeit, normativer Richtigkeit und politischer Verantwortbarkeit der eigenen wissenschaftlichen Beiträge bzw. ihrer wohlmöglich verstörenden, verletzenden oder politisch-ethisch unappetitlichen Wirkungen einzuordnen? Geraten hier wohlmöglich zwei Dimensionen der Wissenschaftsfreiheit in einen Konflikt, nämlich die epistemische Freiheit der Wissenschaftler*in, zu forschen, lehren, äußern und zu publizieren, was, wann und wo sie will, und die gerechte Freiheit aller, an der Wissenschaft zu partizipieren, ohne benachteiligt, beschämt und verachtet zu werden? Lassen sich solche Konflikte moderieren, indem die Akteure der Wissenschaft Handreichungen und Empfehlungen entwickeln? Oder stellen solche Selbstregulierungsversuche bereits Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit dar?
Dieses Bündel von Fragen will keine schlichte Ja/Nein-Antwort provozieren, sondern darauf aufmerksam machen, dass Wissenschaftsfreiheit ein Ideal darstellt, dessen Voraussetzungen, Probleme und Grenzen erst dann deutlich und diskutierbar werden, wenn sich das Ideal in einer institutionellen Praxis (der Forschung, Lehre, Hochschule) und in einem gesellschaftlichen Kontext (der freiheitlichen pluralistischen Demokratie) konkretisieren und bewähren muss. Deswegen sollten wir uns als Wissenschaftsgemeinschaft gründlicher über die Gelingensbedingungen der Wissenschaftsfreiheit und auch unsere individuelle und institutionelle Verantwortung hierfür verständigen. Ansonsten wäre nicht nur die Freiheit der Wissenschaft, sondern vorallem die herausragende Bedeutung der Universitäten in der und für die freiheitliche Demokratie in Gefahr.
Elif Özmen ist Professorin für Praktische Philosophie an der Universität Gießen. Gerade ist der von ihr herausgegebene Essayband erschienen Wissenschaftsfreiheit im Konflikt. Grundlagen, Herausforderungen und Grenzen, in dem sich auch eine längere Version dieses Beitrags mit bibliographischen Nachweisen findet.