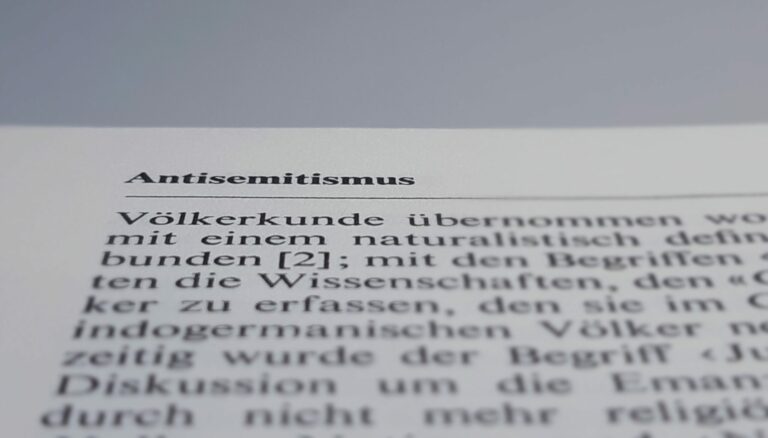Vom guten Leben und vom guten Tod: Ein postmodernes Dilemma
Podcast: Play in new window | Download
Von Fabian Hutmacher (Würzburg)
Dieser Blogbeitrag basiert auf einem Aufsatz, der in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift für Praktische Philosophie (ZfPP) erschienen ist. Der Aufsatz kann auf der Website der ZfPP kostenlos heruntergeladen werden.
Dieser Blogbeitrag kann auch als Podcast gehört und heruntergeladen werden:
Wir alle wünschen uns ein gutes Leben und einen guten Tod. Als gutes Leben gilt uns üblicherweise ein langes und erfülltes Leben. Und ein guter Tod ist ein Tod, der kein Übel mehr für uns darstellt, eben weil er nach einem solchen langen und erfüllten Leben eintritt. Die Verfasstheit postmoderner Gesellschaften steht – so meine These – dem guten Leben und dem guten Tod im Weg. Warum ist das so – und wie lässt sich damit umgehen?
Postmoderne Bestimmungen des guten Lebens
Beginnen wir mit dem guten Leben. Die Frage, was unser Leben zu einem guten Leben macht, ist eine sehr große und sehr schwierige Frage. Sie ist dementsprechend von unterschiedlichen Philosophen sehr unterschiedlich beantwortet worden. Das muss uns an dieser Stelle nicht weiter kümmern. Es soll hier nicht darum gehen, wie sich der einzelne Mensch zur Frage des guten Lebens verhalten sollte, sondern vielmehr darum, wie sich der postmodern-westliche Mensch de facto zu dieser Frage verhält. Oder genauer: Welches Verhalten die dominante kulturelle Logik dem Individuum nahelegt. Folgt man dem Soziologen Hartmut Rosa, gilt in unseren zeitgenössischen Gesellschaften ein Leben dann als ein gutes Leben, wenn es reich an Erfahrungen und ausgeschöpften Möglichkeiten ist. Das gute Leben ist ein Leben, in dem wir – beispielsweise – mit möglichst vielen interessanten Menschen gesprochen, in dem wir möglichst viele horizonterweiternde Bücher gelesen und möglichst viele Reisen an ferne Orte unternommen haben. Wo liegt das Problem mit diesem Ideal?
Kurz gesagt: Es gibt einfach zu viele Dinge, die es wert wären, getan und erlebt zu werden, als dass man sie wirklich alle tun und erleben könnte. Unser Leben ist zu kurz für all das Schöne und Interessante da draußen. Nun gut, mag manch einer denken: Das mag ja sein, aber geht es uns nicht dennoch ungleich besser als den Generationen vor uns? Sind durch den technologischen Fortschritt der vergangenen Jahre und Jahrzehnte nicht immer mehr Weltoptionen in unsere Reichweite gelangt? Durchaus. Allerdings liegt genau hier das Problem. Vergleicht man nämlich – so Rosa – das Verhältnis der in einem Leben realisierten zu den realisierbaren Weltoptionen, so wird man feststellen, dass der Ausschöpfungsgrad an Weltoptionen beständig abnimmt.
Wann ist genug genug? Verloren im unendlichen Ozean der Möglichkeiten
Noch vor wenigen Generationen zogen die meisten Menschen viel kleinere Lebenskreise. Für den durchschnittlichen Bürger war es noch bis weit ins zwanzigste Jahrhundert hinein schlechterdings unmöglich oder wenigstens unüblich, ausgedehnte Reisen zu unternehmen und Korrespondenzen mit Menschen auf der anderen Seite des Globus zu unterhalten. Die Gegenwart kennt in dieser Hinsicht zumindest für Mitglieder der westlichen Staatenwelt kaum noch Hindernisse.
Gleichzeitig aber stehen den genutzten Möglichkeiten immer mehr ungenutzte gegenüber. Reichweitenvergrößerung führt eben nicht nur dazu, dass wir Urlaub an exotischen Orten machen können, sondern auch dazu, dass es zahllose exotische Orte gibt, an die wir theoretisch reisen könnten, die wir praktisch aber nie zu Gesicht bekommen werden. Wessen Horizont nur bis zum nächsten Hügel reicht, der wird weniger Schwierigkeiten haben, all das zu erkunden, was innerhalb dieses Horizonts liegt, als jemand, dessen Horizont die Welt sein soll und dem es nur an der nötigen Zeit gebricht, alle Hügel und alle Täler des Planeten kennenzulernen.
Der Versuch, im Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten ein gutes Leben zu führen, droht deshalb ins Gegenteil umzuschlagen. Der Kampf um eine möglichst vollständige Ausschöpfung der Weltoptionen ist ein Kampf gegen Windmühlen. Er kennt kein natürliches Ende. Zugespitzt ausgedrückt kann es das lange und erfüllte Leben überhaupt nicht geben, denn egal wie lang ein Leben ist: Es hätte noch länger sein müssen, um der Vielzahl an Weltoptionen auch nur annähernd gerecht zu werden. Der Versuch, das gute Leben über das Ausschöpfen möglichst vieler Weltoptionen zu realisieren, verkehrt sich ins Gegenteil. In einem Satz: Das gelebte Ideal des guten Lebens verhindert gerade dieses gute Leben. Und, so meine These, es verhindert sogar noch mehr: Es verhindert auch den guten Tod.
Nachdenken über den guten Tod: Wann ist der Tod (k)ein Übel?
Was aber ist das: ein guter Tod? Eine berechtigte Frage, wird der Tod doch üblicherweise als ein Übel betrachtet. Das liegt daran, so argumentiert der Philosoph Bernard Williams, dass der Tod verhindert, dass unsere auf die Zukunft gerichteten Wünsche in Erfüllung gehen können. Wenn ich heute sterbe, kann ich morgen nicht mehr in den Urlaub fahren. Solange ein Mensch solche – wie Williams sie nennt – kategorischen Wünsche hat, stellt der Tod ein Übel für uns dar. Umgekehrt ausgedrückt: Wenn wir einen Punkt erreichen, an dem wir keine kategorischen Wünsche mehr hegen, ist der Tod auch kein Übel mehr für uns.
Ist ein völliges Fehlen kategorischer Wünsche vorstellbar? Williams bejaht diese Frage. Irgendwann, so argumentiert er sinngemäß, wäre in jedem Leben der Punkt erreicht, an dem man alles getan hat, was man tun möchte und in dem man sich gleichzeitig wünscht, nichts davon erneut tun zu müssen. Andere bestreiten diese These. Natürlich, so argumentieren sie, ist jeder Wunsch einmal erfüllt. Aber parallel dazu sind bereits wieder neue Wünsche entstanden, hat man bereits wieder Pläne für neue Projekte gefasst.
Lässt sich angesichts dieser unklaren Sachlage überhaupt etwas Definitives über den guten Tod sagen? Ich denke schon. Auch eine hundertjährige Person mag noch kategorische Wünsche haben, weshalb man ihren Tod als ein Übel betrachten kann. Gleichzeitig ist es nicht absurd, ihr Leben als ein erfülltes Leben zu betrachten, sofern die zentralen Daseinsmöglichkeiten dieses Lebens ausgeschöpft wurden. In diesem Sinne kann der Tod der hundertjährigen Person dann auch als ein guter Tod gelten, als ein Tod nämlich, der zu einem Zeitpunkt eingetreten ist, in dem es nichts mehr gab, was die Person noch unbedingt hätte tun wollen.
Die Unmöglichkeit des guten Todes in der Postmoderne
Versteht man den guten Tod als einen Tod, der erst dann eintritt, wenn wir die für uns wichtigen Daseinsmöglichkeiten hinreichend ausgeschöpft haben, wird ersichtlich, dass in der Postmoderne neben dem guten Leben auch der gute Tod unerreichbar zu werden droht. Gerade weil die Welt so viele erlebenswerte Dinge für uns bereithält, erscheint sie unerschöpflich. Und gerade deshalb rückt der Moment, in dem wir von uns sagen können, nun das getan und gesehen zu haben, was wir unbedingt tun und sehen wollten, in vage Ferne.
Wer sich an dieser Stelle an die dramatische Grundanordnung in Goethes Faust erinnert fühlt, liegt vielleicht nicht ganz falsch. „Werd ich zum Augenblicke sagen: / Verweile doch! du bist so schön! / Dann magst du mich in Fesseln schlagen, / Dann will ich gern zugrunde gehen!“, sagt Faust, als er seinen Pakt mit Mephisto schließt. Er sagt es in der subjektiven Gewissheit, dass dieser Augenblick niemals kommen und dass er immer das Bedürfnis verspüren wird, weiterzumachen und weiterzustreben. Faust ist ein rastlos Suchender, der gar nicht weiß, wonach er sucht, weil nichts von dem, was er findet, ihn jemals zufriedenstellen kann.
Faust ist damit gewissermaßen das Urbild des postmodernen Menschen, weil er sich das Ausschöpfen der existierenden Weltmöglichkeiten als Ideal eines guten Lebens setzt, weil er sich einen guten Tod ersehnt, der erst dann eintreten darf, wenn er diesem Lebensideal gerecht geworden ist und weil ihm dieses Ideal – trotz der Aufhebung der zeitlichen Beschränkungen durch seine Vereinbarung mit Mephisto – niemals zu dem Gefühl verhilft, nun ein gutes Leben zu führen. Das gute Leben bleibt für Faust stets ein Noch-nicht. Das eint ihn mit dem postmodernen Menschen. Was ihn von ihm trennt, ist die Möglichkeit, durch den Teufelspakt auch den Tod im Zustand des Noch-nicht zu halten. Uns als postmodernen Menschen dagegen muss der Tod als etwas Unwillkommenes erscheinen, als ein Ende, das stets zu früh eintreten wird.
Und jetzt? Von der schwierigen Suche nach einem Ausweg
Was aber fangen wir mit dieser Diagnose an? Oder anders: Wie könnte ein Ausweg aus dem skizzierten Dilemma aussehen, wie könnten gutes Leben und guter Tod wieder zur Deckung gebracht werden? Endgültige Antworten kann ich an dieser Stelle nicht bieten, möchte aber zumindest eine Option andiskutieren, die in Debatten über Konsumkultur und Postwachstumsgesellschaften mitunter gerne ins Spiel gebracht wird. Demnach würde der Schlüssel zu einem guten Leben gerade nicht in dem Versuch liegen, möglichst viele der vorhandenen Weltoptionen auszuschöpfen, sondern in dem Bemühen um eine suffizienzorientierte Lebensführung, die sich die Frage stellt, welche der vorhandenen Möglichkeiten man wirklich braucht, um das eigene Leben als ein gutes Leben zu erfahren. Demzufolge braucht das gute Leben Beschränkung, kann es per definitionem nicht darin bestehen, möglichst alle Seinsweisen auszuprobieren. Vielmehr verpasst das Wesentliche, wer Allem nachjagt.
So lebensklug und weise eine solche Selbstbeschränkung klingen mag, so schwer ist sie in der Realität umzusetzen – insbesondere in unserer postmodernen Realität, in der es nur so von Weltoptionen wimmelt, zwischen denen man eben immer noch zu wählen hat, selbst wenn man erkannt zu haben glaubt, dass uns das Sich-Entscheiden-Müssen an sich keine Kopfschmerzen bereiten sollte. Selbst wer bereit ist, sich zu beschränken, entkommt dem Moment der Wahl nicht, in dem er festlegen muss, worauf er sich beschränken möchte. Damit aber sind wir wieder bei der Grundfrage nach den Charakteristika eines guten Lebens angelangt. So, wie dies unsere gegenwärtigen westlichen Gesellschaften versuchen, scheinen sich diese Charakteristika nicht überzeugend bestimmen zu lassen. Grund genug, das postmoderne Ideal des guten Lebens auf den Prüfstand zu stellen. Zu welchen positiven Antworten eine solche Überprüfung führen kann, muss einstweilen offenbleiben.
Fabian Hutmacher hat Psychologie, Philosophie und Germanistik an der Universität Regensburg studiert und dort auch promoviert. Seit 2020 ist er Post-Doc am Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und Neue Medien an der Universität Würzburg. Neben seiner Forschung zu psychologischen Themen beschäftigt er sich auch intensiv mit interdisziplinären und philosophischen Fragestellungen.