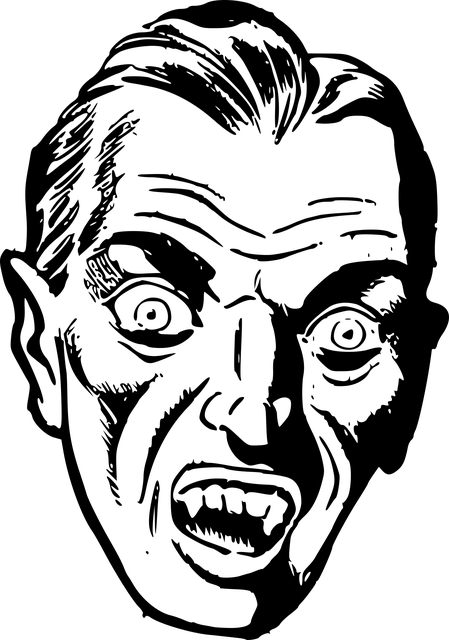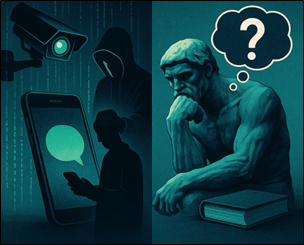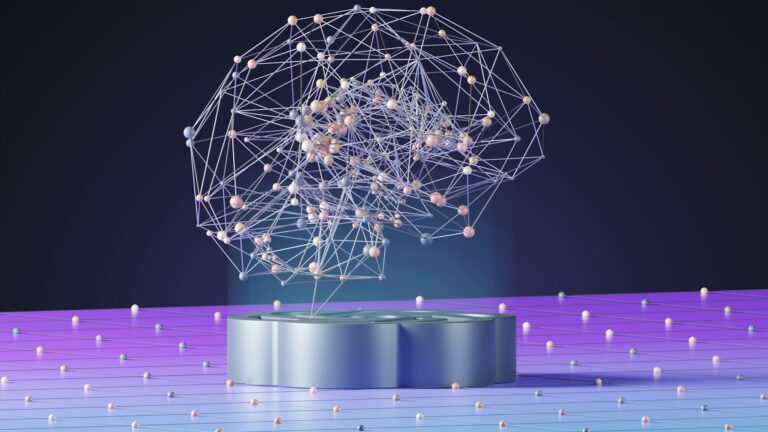Anarchy, State, and Utopia wird 50
Von Fabian Wendt (Blacksburg, Virginia)
Robert Nozicks Anarchy, State, and Utopia wird in diesem Jahr 50. In der akademischen politischen Philosophie hat das Buch den Ruf, ein Klassiker zu sein. Jeder kennt zumindest ein paar der Gedankenexperimente aus dem Buch, etwa die Geschichte von Wilt Chamberlain oder die „experience machine“. Für viele gilt das Buch als die Exposition einer libertären Position in der politischen Philosophie – und oft ist es die einzige, die überhaupt zur Kenntnis genommen wird. In Brian Leiters Umfrage von 2016 kam Nozick auf Platz 8 der bedeutendsten anglophonen Moral- und politischen Philosophen seit 1945.
Vor ein paar Jahren wurde mein Proposal für einen Band zu Anarchy, State, and Utopia in der bekannten Reihe „Klassiker auslegen“ allerdings abgelehnt. Grund dafür waren nicht die Details des Proposals, Grund war vielmehr, dass ein Band zu Nozicks Buch generell nicht gewollt wurde. Das ist natürlich eine legitime Entscheidung, zeugt aber von einer skeptischen Haltung gegenüber dem Buch, die wahrscheinlich nicht ganz ungewöhnlich ist. Im Folgenden trage ich ein paar Punkte zusammen, die diese Haltung möglicherweise erklären.
1. Manche scheinen Anarchy, State, and Utopia eher als „sekundären Klassiker“ zu sehen, als „libertäre Antwort auf John Rawls“. Und natürlich stimmt es, dass Nozicks Buch die libertäre Alternative zu Rawls in der akademischen Philosophie etablierte. Aber das Buch ist dennoch kein bloßer sekundärer Klassiker. Nur ca. 50 der 335 Seiten sind eine (direkte) Auseinandersetzung mit Rawls‘ drei Jahre früher erschienener Theory of Justice. Und neben Rawls ist es vor allem auch die Auseinandersetzung mit Murray Rothbards „Anarcho-Kapitalismus“, die Nozicks Buch motiviert.
Dies, zur Erinnerung, ist die Hauptargumentationslinie von Anarchy, State, and Utopia: Im ersten Teil möchte Nozick die Legitimität eines Minimalstaats aufzeigen. Er argumentiert, dass Personen sich in einem staatsfreien Naturzustand zu Schutzgemeinschaften zusammenschließen würden, welche sodann ohne individuelle Rechte zu verletzen in einem Prozess der unsichtbaren Hand eine Entwicklung hin zu einem Minimalstaat nehmen würden. Dieser hat ein Gewaltmonopol über ein bestimmtes geographisches Gebiet, schützt alle, die sich auf diesem Gebiet aufhalten, und verbietet legitimerweise Privatjustiz, da Privatjustiz ein zu hohes Risiko in sich birgt, individuelle Rechte zu verletzen. (Für eine interessante neue Interpretation dieses Teils des Buchs vgl. Bader 2017).
Im zweiten Teil werden Argumente für einen über den Minimalstaat hinausgehenden Staat diskutiert und zurückgewiesen, insbesondere solche, die sich auf Verteilungsgerechtigkeit beziehen. In diesem Teil skizziert Nozick auch seine eigene, libertäre Gerechtigkeitstheorie, die er „entitlement theory“ nennt. Nach der „entitlement theory“ ist eine Verteilung von Gütern dann gerecht, wenn sie auf gerechte Weise zustande gekommen ist. Ein Prinzip der gerechten Erstaneignung und ein Prinzip gerechten Transfers bestimmen, wann dies der Fall ist. Ein drittes Prinzip schließlich befasst sich mit der Wiedergutmachung von Unrecht. Die „entitlement theory“ ist indifferent gegenüber Ungleichheiten (oder anderen Strukturmerkmalen von Verteilungen), sofern diese nur auf gerechte Weise zustande gekommen sind.
Im dritten Teil von Anarchy, State, and Utopia schließlich soll gezeigt werden, dass die skizzierte Vision gesellschaftlicher Ordnung auch inspirierend ist – ein Utopia –, weil sie zulässt, dass auf freiwilliger Basis verschiedenste Lebensformen ausprobiert werden.
Nebenbei werden in dem Buch eine Vielzahl von anderen Themen behandelt, vom moralischen Status von Tieren über Theorien der Strafe bis hin zu Marxscher Ausbeutung.
2. Obwohl die Hauptargumentationslinie von Anarchy, State, and Utopia relativ klar ist, ist das Buch im Detail allerdings wenig systematisch; Gedanken werden angerissen, Argumente ausprobiert, genauere Analysen vertagt. Das kann manchmal unbefriedigend und frustrierend sein. Andererseits kann kaum bestritten werden, dass Nozicks explorativer Ansatz, seine Unerschrockenheit und seine Kreativität ungemein anregend und inspirierend sind. Man kann in dem Buch einem hellsichtigen Philosophen beim Philosophieren zusehen. Nozick schreibt:
One view about how to write a philosophy book holds that an author should think through all of the details of the view he presents, and its problems, polishing and refining his view to present to the world a finished, complete, and elegant whole. This is not my view. At any rate, I believe that there also is a place and a function in our ongoing intellectual life for a less complete work, containing unfinished presentations, conjectures, open questions and problems, leads, side connections, as well as a main line of argument. There is room for words on subjects other than last words.
(1974: xii)
3. Nach Erscheinen von Anarchy, State, und Utopia wandte sich Nozick anderen Themen der Philosophie zu und tat wenig, um das Buchgegen Kritik zu verteidigen, seine Theorie auszuarbeiten oder sie weiterzuentwickeln. Vielleicht auch deswegen hat sich weder in Harvard – wo Nozick seit 1969 lehrte – noch anderswo eine “Schule” des Nozickianismus in der politischen Philosophie entwickelt. (In den 2000er und 2010er Jahren hatte dagegen das PhD Programm an der University of Arizona den Ruf, regelmäßig talentierte libertär geneigte politische Philosophen zu produzieren, aber da lag Anarchy, State, and Utopia schon lange Zeit zurück und hatte nur noch einen indirekten Einfluss).
In seinem 15 Jahre später erschienenen Buch The Examined Life drückte Nozick übrigens selbst in einem paar kurzen Bemerkungen Zweifel an seiner libertären Position aus (1989: 286-287). In einem Interview ein Jahr vor seinem Tod 2002 stellte er allerdings klar: “What I was really saying in The Examined Life was that I was no longer as hardcore a libertarian as I had been before. But the rumors of my deviation (or apostasy!) from libertarianism were much exaggerated.”
4. Ein Vorurteil gegenüber Anarchy, State, and Utopia, das sich seit Thomas Nagels Review mit dem Titel „Libertarianism without Foundations“ (1975) beharrlich hält, lautet, dass Nozick dogmatisch und ohne weitere Begründung uneingeschränkt geltende Eigentumsrechte postuliert.
In der Tat beginnt das Buch bekanntlich mit dem Satz: „Individuals have rights, and there are things no person or group may do to them (without violating their rights). So strong and far-reaching are these rights that they raise the question of what, if anything, the state and its officials may do.” Es stimmt auch, dass Nozicks „entitlement theory“ nur der Form nach klar ist: Keines der oben genannten drei Prinzipien wird im Detail ausbuchstabiert.
Dennoch ist nicht richtig, dass Nozick libertäre Rechte einfach dogmatisch voraussetzt. Vielmehr skizziert er mehrere Argumente für als „side-constraints“ zu verstehende libertäre Rechte (1974: 30-35, 48-51, 228-230). Ein Kerngedanke lautet, dass diese Rechte Ausdruck der „Getrenntheit“ und Unverletzlichkeit von Personen sind:
Side constraints express the inviolability of other persons. But why may not one violate persons for the greater social good? Individually, we each sometimes choose to undergo some pain or sacrifice for a greater benefit or to avoid a greater harm […] But there is no social entity with a good that undergoes some sacrifice for its own good. There are only individual people, different individual people, with their own individual lives.
(1974: 32-33)
Rawls führt bekanntlich ganz ähnliche Erwägungen gegen den Utilitarismus ins Feld. Andererseits gibt Rawls zu „[that] the difference principle represents, in effect, an agreement to regard the distribution of natural talents as a common asset and to share in the benefits of this distribution whatever it turns out to be.” (1971: 101) Ist das kompatibel mit der Getrenntheit und Unverletzlichkeit von Personen? Peter Singer jedenfalls schreibt in seinem Beitrag zu einem alten Sammelband zu Anarchy, State, and Utopia: „The question we must face, then, is whether any conception of distributive justice that accepts individual rights, particularly the right to property, and prohibits absolutely treating one man as a means to the welfare of another can withstand the arguments Nozick has directed primarily against Rawls.“ (1975, 48, vgl. zur Diskussion Mack 2018, 41-55)
Es sollte auch nicht übersehen werden, dass viele einschlägige Argumente im zweiten Teil von Anarchy, State, and Utopia weder Nozicks „entitlement theory“ noch uneingeschränkt geltende Eigentumsrechte voraussetzen. Das Wilt Chamberlain-Argument zum Beispiel setzt vielmehr nur voraus, dass Personen zumindest einen gewissen Freiheitsspielraum haben sollten, der ihnen erlaubt, mit dem, was ihnen gemäß einer Theorie der Verteilungsgerechtigkeit zusteht, zu machen, was sie wollen. Wenn sie diese Freiheit haben, so werden Tausch- und Schenkungshandlungen Verteilungsstrukturen verändern, und eine Theorie der Verteilungsgerechtigkeit sollte dieser Freiheit Rechnung tragen, so die Pointe des Arguments. Nach Nozick muss eine Theorie der Verteilungsgerechtigkeit deswegen historisch sein und kann keine Verteilungsstruktur als Gebot der Gerechtigkeit vorschreiben.
5. Meine Vermutung ist, dass manche Anarchy, State, and Utopia vor allem deswegen wenig wohlwollend betrachten, weil ihnen die darin vertretenen politischen Positionen unakzeptabel erscheinen, insbesondere die Ablehnung wohlfahrtsstaatlicher Umverteilung. Unvergessen ist Brian Barrys Review von Anarchy, State, and Utopia, nach der Nozick,
from the lofty heights of a professorial chair, is proposing to starve or humiliate ten percent or so of his fellow citizens (if he recognizes the word) by eliminating all transfer payments through the state, leaving the sick, the old, the disabled, the mothers with young children and no breadwinner, and so on, to the tender mercies of private charity, given at the whim and pleasure of the donors and on any terms that they choose to impose.
(1975)
Es sollte allerdings festgehalten werden, dass Nozick wohlfahrtsstaatliche Institutionen nicht notwendigerweise ablehnen muss. Zwar verlangt nach Nozick in der Tat Verteilungsgerechtigkeit keine Umverteilung. Die Wiedergutmachung historischen Unrechts ist allerdings zentral für seine „entitlement theory“, und er schreibt, für den amerikanischen Kontext, „[that] past injustices might be so great as to make necessary in the short run a more extensive state in order to rectify them.“ (1974: 231) Auch Nozicks Variante eines Lockeschen Provisos (1974: 178-182), dem gemäß Aneignungen nur dann erlaubt sind, wenn durch sie niemand schlechter gestellt wird, kann möglicherweise Umverteilung legitimieren (vgl. zur Diskussion Wündisch 2014, Wendt 2018).
Wie dem auch sei. Allgemein ist es bedauerlich, dass die libertäre Tradition meist als „rechts“ eingeordnet wird. Tatsächlich gab und gibt es de facto natürlich Schulterschlüsse zwischen Libertären und Konservativen, doch gab und gibt es auch eine progressive und emanzipatorische Stoßrichtung libertären Denkens, die leider nicht immer wahrgenommen wird. Anders als Barry zu implizieren scheint, sind Staaten nach aller historischen Erfahrung schließlich keine wohlwollenden und weisen Institutionen, die zum Wohle der Ärmsten und Schwächsten regieren. Auch in Demokratien sind die vielfältigen Verquickungen zwischen politischen und wirtschaftlichen Eliten doch so tiefgreifend, dass libertäre Staatskritik klarerweise nicht den Interessen der Reichen und Mächtigen dient.
Der Untertitel von Matt Zwolinskis und John Tomasis großartiger Geschichte libertären Denkens trägt den sprechenden Untertitel Radicals, Reactionaries, and the Struggle for the Soul of Libertarianism (2023). Während libertäre Anarchisten des 19. Jahrhunderts Themen wie die Abschaffung der Sklaverei oder die Rechte von Frauen in den Mittelpunkt rückten, wurden Libertäre des 20. Jahrhunderts in erster Linie durch die Bedrohung durch den Kommunismus geprägt, so Zwolinski und Tomasi. Sie ordnen Anarchy, State, and Utopia wie folgt ein:
In concentrating narrowly on the two issues of political authority and distributive justice, Nozick’s book places questions about the relationship between the state and the economy at the core of libertarianism, to the exclusion of social issues of the sort that had concerned American libertarianism in the nineteenth century. … Even the one economic issue that had most concerned nineteenth-century American libertarians – the rights of laborers against politically privileged capitalists and landlords – is given scant attention in Nozick’s text. Thus, Nozick did little to challenge either the exclusive economic focus or the generally rightward drift of twentieth-century libertarian thought. Indeed, by setting the terms of the academic conversation about libertarianism for decades to come, Nozick arguably reinforced those qualities as definitive of libertarianism as such.
(2023: 62-63)
Fair enough. Andererseits kann man geltend machen, dass Anarchy, State, and Utopia erstens auch keine merklich kulturell-konservative Tonalität aufweist, und dass politische Autorität und Verteilungsgerechtigkeit zweitens eben als die für die analytische politische Philosophie grundlegendsten Themen begriffen werden (obwohl man das natürlich auch anders sehen kann).
Meines Erachtens kann es keinen Zweifel geben, dass Anarchy, State, and Utopia zu Recht als philosophischer Klassiker gilt. Radikal und innovativ, lebendig und voller Ideen – um dem Buch Respekt zollen zu können, muss man Nozicks inhaltliche Positionen nicht teilen. Mein eigenes Denken jedenfalls hat das Buch durchaus geprägt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Literatur:
Bader, Ralf 2017: Counterfactual Justifications of the State. In Oxford Studies in Political Philosophy Bd. 3, hg. D. Sobel, P. Vallentyne und S. Wall, 101-31. Oxford: Oxford University Press.
Barry, Brian 1975: Review of Anarchy, State, and Utopia. Political Theory 3: 331-336.
Nagel, Thomas 1975/1981: Libertarianism without Foundations. In: J. Paul (Hg.): Reading Nozick: Essays on Anarchy, State, and Utopia. Totowa: Rowman & Littlefield, 191-205.
Mack, Eric 2018: Libertarianism. Cambridge: Polity Press.
Nozick, Robert 1974: Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books.
Nozick, Robert 1989/2006: The Examined Life: Philosophical Meditations. New York: Simon & Schuster.
Rawls, John 1971: A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
Singer, Peter 1975/1981: The Right to Be Rich or Poor. In Reading Nozick: Essays on Anarchy, State, and Utopia, hg. J. Paul, 37-53. Totowa: Rowman & Littlefield.
Wendt, Fabian 2018: „Strukturelle Gerechtigkeit und das Lockesche Proviso“. In Der Minimalstaat: Zum Staatsverständnis von Robert Nozick, hg. B. Knoll, 103-21. Baden-Baden: Nomos.
Wündisch, Joachim 2014: Towards a Right-Libertarian Welfare State: An Analysis of Right-Libertarian Principles and Their Implications. Paderborn: Mentis.
Zwolinski, Matt und John Tomasi 2023: The Individualists: Radicals, Reactionaries, and the Struggle for the Soul of Libertarianism. Princeton: Princeton University Press.
Fabian Wendt ist seit 2021 Assistant Professor für Politikwissenschaft und Core Faculty am Kellogg Center for Philosophy, Politics, and Economics an der Virginia Tech in Blacksburg, Virginia. 2015 wurde er an der Universität Hamburg in Philosophie habilitiert.