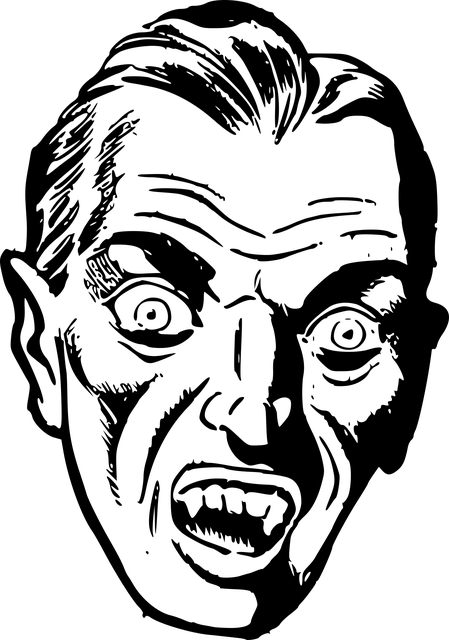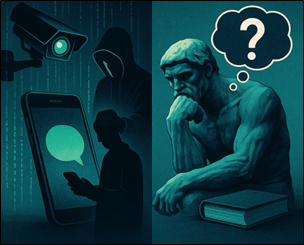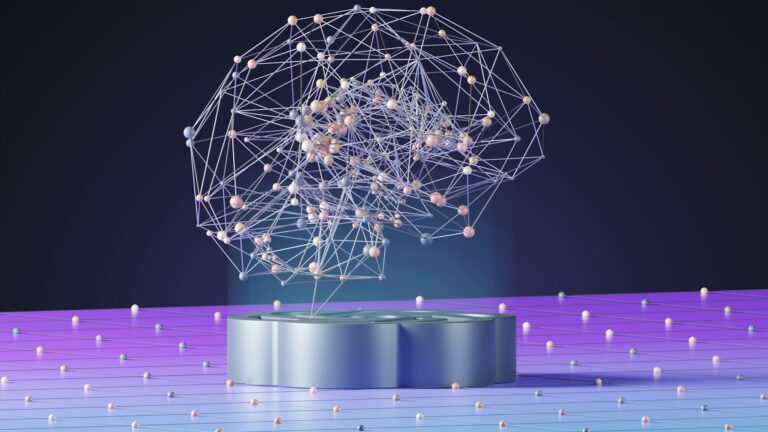Der Supreme Court und das liberale Loblied auf die höchste Instanz
Von Johannes Müller-Salo (Hannover)
In ihrer Sorge um den effektiven Schutz individueller Grundrechte verteidigen viele Liberale die Idee eines mit umfassenden Kompetenzen ausgestatteten Verfassungsgerichtshofs. Nicht selten werden höchste Gerichte zu Wächtern der Verfassung stilisiert. Die jüngsten Urteile des Supreme Courts zum Schwangerschaftsabbruch, zum Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit wie zu den Klimaschutzbefugnissen der US-Umweltbehörde geben allen Grund dazu, dieses wichtige Element liberaler Theoriebildung auf den Prüfstand zu stellen.
Wer einen kritischen Blick auf zentrale Elemente des politischen Liberalismus werfen möchte, beginnt am besten mit dem Werk von John Rawls. Die Parteien in Rawls‘ Gedankenexperiment, dem Urzustand, sehen sich vor folgendes Problem gestellt: Sie haben sich auf die berühmten beiden Grundsätze der Gerechtigkeit geeinigt und legen sich nun die Frage vor, wie diesen Grundsätzen in der realen Welt dauerhaft Geltung verschafft werden kann.
Zur Lösung dieses Problems lässt sich im Anschluss an Rawls ein Gedankengang in drei Schritten entwickeln: Erstens, zentrale Grund- und Freiheitsrechte der Individuen, wie sie sich vor allem aus dem ersten Grundsatz der Gerechtigkeit ergeben, sollen verfassungsrechtlich verankert werden. Zweitens, diese Elemente der Verfassung sollen vor späteren Veränderungen geschützt werden. Rawls spricht hier etwa davon, die „öffentliche Basis wechselseitigen Vertrauens [d. i. die Grundfreiheiten] […] durch eine Verfassung zu fundieren, die ein für allemal die gleichen Grundfreiheiten garantiert“ (Rawls 2006, 167). Die Verfassung lässt sich effektiv vor Veränderungen schützen, indem Verfahren zur Verfassungsänderung komplex ausgestaltet und mit hohen Hürden verbunden werden. So schreibt Rawls im Politischen Liberalismus:
„Wenn bestimmte Angelegenheiten von der politischen Tagesordnung genommen werden, werden sie nicht länger als angemessene Gegenstände für politische Entscheidungen nach der Mehrheitsregel oder einer anderen Abstimmungsregel betrachtet. […] Sie sind Teil der öffentlichen Gründungsurkunde einer konstitutionellen Ordnung und werden nicht als geeigneter Gegenstand laufender politischer Debatten und Gesetzgebungen betrachtet, so als ob sie durch die erforderlichen Mehrheiten in die eine oder andere Richtung geändert werden könnten.“
Rawls 1998, 240f., vgl. 335
Drittens, auch wenn bestimmte Grundrechte ein für allemal fixiert worden sind, können Konflikte entstehen, sei es durch offene Interpretationsfragen, sei es durch die Kollision verschiedener Grundrechte. An dieser Stelle bringt Rawls den obersten Gerichtshof ins Spiel. Im theoretischen Idealfall agiert ein Supreme Court als „exemplarische Instanz des öffentlichen Vernunftgebrauches“, ja als „institutionelle Einrichtung zum Schutz des höheren Rechts“, die verhindern soll, „daß dieses Recht […] durch organisierte und durchsetzungsfähige Interessen ausgehöhlt wird“ (Rawls 1998, 333, 336). Deutlicher lässt sich die Idee der höchsten richterlichen Instanz als Hüterin der Verfassung kaum formulieren.
Damit das funktioniert, müssen die Mitglieder des höchsten Gerichts ihre Urteile auf der richtigen Grundlage fällen. Dazu schreibt Rawls:
„Natürlich dürfen die Verfassungsrichter sich nicht auf ihre persönliche Moral berufen. […] Ebensowenig können sie sich auf ihre eigenen religiösen oder philosophischen Auffassungen oder die anderer Menschen stützen. Sie müssen sich vielmehr auf die politischen Werte berufen, von denen sie glauben, daß sie zum vernünftigsten Verständnis der öffentlichen Gerechtigkeitskonzeption und ihrer politischen Werte sowie des öffentlichen Vernunftgebrauchs gehören. Dies sind Werte, von denen sie in gutem Glauben vernünftigerweise annehmen […], daß alle Bürger ihnen als vernünftige und rationale Personen beipflichten können.“
Rawls 1998, 340
Soweit der theoretische Gedankengang, der sich in dieser oder vergleichbarer Form in vielen liberalen Positionen finden lässt. Um Missverständnissen direkt vorzubeugen: Rawls gibt in den hier erwähnten Überlegungen eine Antwort auf die Frage, welche Rolle einem Verfassungsgericht im Rahmen einer konstitutionellen Ordnung zukommen kann, die seiner politischen Theorie entspricht. Er liefert hier keine Rekonstruktion der tatsächlichen Arbeit des Supreme Court. Und selbstverständlich lässt sich seine Gerechtigkeitstheorie heranziehen, um scharfe inhaltliche Kritik an den jüngst ergangenen Urteilen zu üben. Ungeachtet dessen müssen im Lichte dieser Washingtoner Urteile mindestens zwei Elemente der hier skizzierten liberalen Position kritisch beleuchtet werden.
Erstens, Rawls schreibt: „Die Verfassung ist nicht das, was das Verfassungsgericht über sie sagt. Vielmehr ist sie das, was das Volk, indem es durch die anderen Zweige der Staatsgewalt im Einklang mit der Verfassung handelt, dem Gericht letzten Endes über die Verfassung zu sagen erlaubt.“ (Rawls 1998, 342). Was Rawls dabei unerwähnt lässt: Das von ihm befürwortete Verfassungsdesign hindert das Volk aktiv daran, dem Verfassungsgericht bestimmte Aussagen zu „erlauben“ und damit eben auch andere Aussagen zu „verbieten“. Seine Theorie fordert die schon erwähnten hohen prozeduralen Hürden für Verfassungsänderungen ein und erklärt sie zu einem Schlüsselelement des Grundrechtsschutzes. Was das für die Praxis heißt, zeigt sich in den USA in aller Deutlichkeit: Die Hürden für die Änderung der US-Verfassung sind so hoch, dass im Laufe ihres 230jährigen Bestehens gerade einmal 27 Änderungsverfahren (amendments) erfolgreich gewesen sind. Die in den USA allen Umfragen zufolge existierende Mehrheit zugunsten eines grundsätzlichen Rechts auf Schwangerschaftsabbruch etwa findet keinen Weg, ihren Willen als demokratische Mehrheit der Verfassung einzuschreiben.
Zweitens, Rawls weist selbst darauf hin, dass das Verfassungsgericht „unvermeidlich bei jeder großen legitimen oder nichtlegitimen Verfassungsänderung im Zentrum der Auseinandersetzungen“ stehe (Rawls 1998, 344). Umso überraschender ist es, dass er – und mit ihm viele andere Liberale – einem naheliegenden Problem von politischen Systemen, die über eine Verfassungsgerichtsbarkeit verfügen, kaum Aufmerksamkeit schenkt. Der US-Demokratietheoretiker Robert Dahl hat dieses Problem in seinem Hauptwerk Democracy and Its Critics schon 1989 präzise benannt:
„While defenders of nonmajoritarian systems sometimes gesture fearfully toward a specter of majority tyranny […], these advocates usually fail to notice the less visible indications of a second specter – minority tyranny. […] Nonmajoritarian democratic arrangements by themselves cannot prevent a minority from using its protected position to inflict harm on a majority.“
Dahl 1989, 155f.
Lässt sich nicht eben dies gerade in den USA beobachten? Eine – ganz vorwiegend weiße und in großen Teilen christlich-fundamentalistische – Minderheit nutzt im Bund mit dem Verfassungsgericht eine erstarrte Verfassung zu ihren Gunsten und gegen den Willen einer Mehrheit, die sich nicht demokratisch-rechtsetzend im System durchzusetzen vermag?
Eine Antwort auf diese Überlegungen könnte darin bestehen, die jüngste Entwicklung als Betriebsunfall der US-Geschichte in einer Zeit starker gesellschaftlicher Polarisierung abzutun. Diese Antwort greift sicherlich zu kurz – nicht zuletzt deswegen, weil sich systematisch vergleichbare Fragen etwa auch mit Blick auf das deutsche politische System stellen lassen. Liberale betonen: Nur ein von Vorgaben anderer politischer Organe und Gremien unabhängiges Verfassungsgericht kann Hüterin der konstitutionellen Ordnung sein. Aus der Unabhängigkeit des Gerichts folgt aber auch, dass seine Unparteilichkeit selbstverantwortet bleibt und damit instabil werden kann.
Nach meiner Auffassung sollten die Urteile des Supreme Court politischen Liberalen daher allen Grund dazu geben, sich drei Fragen zu stellen:
- Indem Verfassungen durch prozedurale Hürden vor Veränderungen geschützt werden, wird der Status quo privilegiert. In welchen Situationen dient ein solches Privileg wirklich effektiv dem Schutz von Grundrechten, den Rechten von Mehrheiten wie Minderheiten? Ließe sich dieser Schutz nicht auch auf anderem Wege erreichen?
- Wie kann sichergestellt werden, dass das Verfassungsgericht Hüterin der Verfassung und der durch sie verbrieften Rechte ist und nicht Teil des Versuches einer gesellschaftlichen Minderheit wird, der Mehrheit ihre Weltanschauung aufzudrängen?
- Wie kann der politische Liberalismus so weiterentwickelt werden, dass er demokratische Mehrheiten nicht, wie oft geschehen, nur kritisch als oftmals irrational, emotional und daher potentiell grundrechtsgefährdend wahrnimmt? Wie kann die (auch verfassungs-)gestalterische Kraft demokratischer Mehrheiten, die in einer lebendigen konstitutionellen Ordnung ihren fairen Platz haben muss, in liberalen Theorien breitere Anerkennung finden?
Am Ende sollten sich auch Liberale die Frage stellen, warum und in welchem Sinn es eine Hüterin der Verfassung wirklich braucht. Es könnte sogar möglich sein, dass eine engagierte, kritische Zivilgesellschaft eher dazu in der Lage ist, dieser Aufgabe nachzukommen, als ein Kreis von nur neun auf Lebenszeit gewählten Richterinnen und Richtern.
Hinweis
Ich greife in diesem Blogbeitrag teilweise auf Überlegungen zurück, die ich ausführlich in Diachrone Legitimität. Die Beständigkeit politischer Ordnungen als Herausforderung der Demokratie (Frankfurt a.M./New York: Campus 2021) entwickelt habe.
Literatur
Dahl, Robert (1989): Democracy and Its Critics. New Haven / London.
Rawls, John (1998): Politischer Liberalismus. Frankfurt am Main.
Rawls, John (2006): Gerechtigkeit als Fairness. Ein Neuentwurf. Frankfurt am Main.
Johannes Müller-Salo ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Leibniz Universität Hannover. Er forscht zu Fragen der politischen Philosophie, der Ethik und Ästhetik.