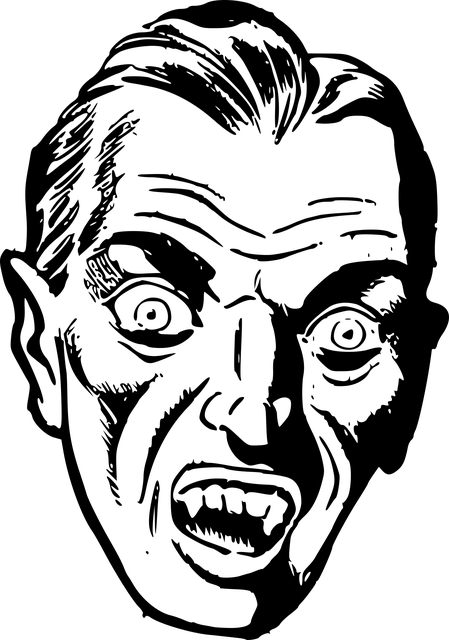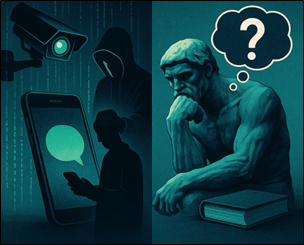Endlich kontroverse Ideen!?
Von Norbert Paulo (Graz/Salzburg)
Im Rahmen einer interessanten BBC-Radiodokumentation über politische Meinungsvielfalt an Universitäten hat Jeff McMahan, Professor für Moralphilosophie in Oxford, seine Initiative für eine neue Fachzeitschrift erläutert, die 2019 gegründet werden soll: The Journal of Controversial Ideas. Die grundsätzliche Idee dafür hat Peter Singer, der die Zeitschrift mit McMahan und Francesca Minerva (Gent) herausgeben wird, bereits 2017 in einem Interview angedeutet: In Zeiten extremer gesellschaftlicher Polarisierung könnten Autor_innen heute leichter als früher davon abgehalten werden, Ideen zu veröffentlichen, die in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen unpopulär sind oder außerhalb dessen liegen, was (mehrheits-)gesellschaftlich akzeptabel erscheint.
Singer hat langjährige Erfahrung mit gesellschaftlichen Reaktionen auf kontroverse Ideen (man lese nur das Nachwort zur deutschsprachigen Ausgabe seines Buchs Praktische Ethik). In geringerem Ausmaß gilt das auch für McMahan und Minerva (siehe hier). Die neue Zeitschrift nun soll es ermöglichen, unter Pseudonym zu veröffentlichen. (Eine verlässliche Zuordenbarkeit der Autor_innen zu den Texten soll für bestimmte Institutionen möglich sein, um die Texte nicht für die Autor_innen selbst „wertlos“ zu machen. So sollen etwa universitäre Kommissionen, die über Beförderungen entscheiden, bei der Zeitschrift den Klarnamen der Autor_in erfahren können. Die Zeitschrift soll im Übrigen Texte open access und nur nach erfolgreich durchlaufenem Peer-review-Prozess veröffentlichen.)
McMahan nennt als Beispiele für die Relevanz einer neuen Zeitschrift vor allem Aufsätze zu moralischen Fragen: Welche Waffentechnologien sollen wie erforscht werden? Sind Tierversuche unter bestimmten Umständen moralisch gerechtfertigt? Gibt es moralisch erlaubte Formen von Eugenik? Die bloße Suche nach den besten Argumenten sei in Bezug auf solche gesellschaftlich hoch umstrittenen bzw. fast einhellig abgelehnten Ideen kaum mehr möglich.
Justin Weinberg kritisiert auf dem Blog Daily Nous zurecht, dass McMahan bisher lediglich stipuliere, dass eine Notwendigkeit für anonyme Veröffentlichungen bestehe, dafür aber keine Nachweise biete. McMahan verweise lediglich grob auf zwei Phänomene: Einerseits Angriffe auf die Wissenschaft von der politischen Rechten. Andererseits überschüssige Tendenzen politisch linker Ideale, vor allem ein stärker werdendes Verlangen nach der Universität als safe space, also als einen Ort, an dem man maximal geschützt ist. Letzteres scheint in den USA inzwischen bedenkliche Dimensionen anzunehmen, etwa wenn Studierende sich bereits angegriffen fühlen, wenn heute als anachronistisch angesehene Ideen klassischer Autor_innen überhaupt thematisiert werden (hierzu das neue Buch von Greg Lukianoff und Jonathan Haidt).
Beide Phänomene können, so McMahans Befürchtung, gerade unter noch nicht etablierten (und mit einer sicheren, dauerhaften Anstellung versehenen) Wissenschaftler_innen zu Selbstzensur führen. Und beide Phänomene können auch Wechselwirkungen entwickeln. Man denke nur an die Kritik – meist von der politischen Rechten formuliert – an den Gender Studies und die (unter Pseudonymen) veröffentlichten Hoax-Aufsätze von politisch eher linken Autor_innen, die damit die Qualitätsstandards, die in den Gender Studies (und verwandten Disziplinen) zu herrschen scheinen, kritisieren wollten (was ihnen nicht sehr gut gelungen ist, siehe nur Gottfried Schweigers Beitrag dazu).
Auch auf diesem Blog wurde übrigens schon unter Pseudonym veröffentlicht. Es kann für Pseudonyme verschiedene Gründe geben. Dazu zählen diese:
- Man möchte nicht in der falschen Rolle schreiben: Fachaufsätze (und Beiträge auf quasi-akademischen Blogs wie diesem hier) schreiben meist Autor_innen mit akademischen Titeln und Anstellungen an Universitäten. Solche Titel und Jobs bringen einen gewissen Hauch von fachlicher Autorität mit sich, den man gerade bei eher gesellschaftlichen Interventionen vermeiden möchte. Frei nach Max Weber sollte man unterscheiden zwischen den Äußerungen, die man als Akademiker_in und denen, die man als Bürger_in tätigt. Man vermeidet so die Gefahr bloßer Autoritätsargumente und eines falschen Elitismus.
- Der Klarname würde das wissenschaftliche Ziel gefährden: Aus dem gleichen Grund aus dem Restauranttester_innen anonym auftreten, haben die Autor_innen der Hoax-Aufsätze in den Gender Studies die Aufsätze unter Pseudonymen geschrieben. So wie die Küchenchefs nicht wissen sollen, dass eine Testerin auf ihr Essen wartet, sollten die Herausgeber_innen der entsprechenden Zeitschriften nicht wissen, dass mit dem Aufsatz ihre Qualitätsstandards „getestet“ werden.
- Man hat Angst vor den Folgen der Veröffentlichung: Eine Veröffentlichung unter eigenem Namen kann unerwünschte wissenschaftliche Konsequenzen haben. Kolleg_innen oder mögliche künftige Arbeitgeber_innen könnten jemanden wissenschaftlich marginalisieren (bspw. nicht mehr zu Workshops einladen, Kooperationen meiden) oder schlicht nicht einstellen, der oder die kontroverse Ideen veröffentlicht hat. In gesellschaftlicher Hinsicht drohen etwa Shitstorms in sozialen Medien, die Störung von Vorträgen, der Verlust des sozialen Reputation, die akademische Titel und Anstellungen mit sich bringen, usw. Auch ist es möglich, dass eine wissenschaftliche Erkenntnis unerwünschte Anwendungsmöglichkeiten hat. Auch in einem solchen Fall könnte man als Wissenschaftler_in die Erkenntnis veröffentlichen wollen, ohne mit den evtl. später entwickelten Anwendungen im Zusammenhang gebracht zu werden (ja, hier lauert ein wissenschaftsethisches Problem).
Die ersten beiden Gründe für Pseudonyme sind grundsätzlich unabhängig vom Thema des Aufsatzes. Der Text kann konform oder kontrovers sein, man kann ihn in beiden Fällen aus guten Gründen anonym veröffentlichen wollen. Lediglich die unerwünschten wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, die auch Singer und McMahan anführen, hängen von der Kontroversität des Aufsatzes ab. Braucht man dafür aber gleich eine neue Zeitschrift? Die Initiative für The Journal of Controversial Ideas legt jedenfalls nahe, dass einige Ideen bisher, also ohne die neue Zeitschrift, gar nicht veröffentlicht werden, obwohl sie wissenschaftlichen Wert haben. Das ist zwar möglich, aber auch nicht offensichtlich. Und dass es heutzutage in dieser Hinsicht eine Schieflage gibt, die es früher so nicht gab, ist auch nicht offensichtlich. Ich stimme Justin Weinberg zu, dass die Initiatoren der neuen Zeitschrift diese Zusammenhänge plausibilisieren sollten. Dies auch nicht zuletzt deswegen, weil der Name des Projekts impliziert, dass andere Journals keine kontroversen Ideen veröffentlichen würden, was zumindest in der Philosophie aus meiner Sicht nicht der Fall ist. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Vielleicht bin ich selbst blind für diese Art von Verzerrung im akademischen Betrieb.
Auf ein Problem sei noch hingewiesen: Mit dem Fokus auf kontroverse Ideen dürfte diese prominent beworbene neue Zeitschrift viele Einreichungen bekommen, deren Qualität nur schwer verlässlich zu beurteilen sind. Viele, die sich seit jeher vom Mainstream missverstanden fühlen, könnten ihre Hoffnung, endlich verstanden zu werden, in die neue Zeitschrift stecken. Die bisher zu Unrecht von den zu Recht wissenschaftlich Ignorierten zu unterscheiden, dürfte schwierig werden, zumal die Zeitschrift zwar durch die Herausgeber_innen auf die Geisteswissenschaften ausgerichtet ist, aber keine disziplinären Grenzen gesetzt werden. Ein solches Projekt wissenschaftlich seriös zu organisieren ist eine beachtliche Herausforderung. Ebenso, es nicht unter dem Deckmantel der Kontroversität zu einem politisch reaktionären Projekt verkommen zu lassen. Frei nach dem Motto: „Das wird man doch noch sagen dürfen.“ Ich bin jedenfalls gespannt.