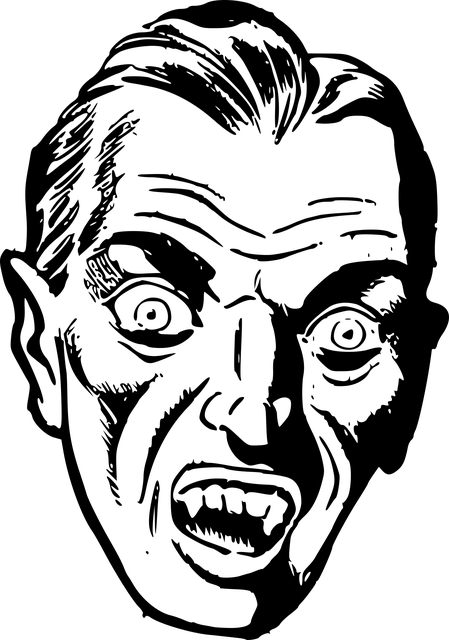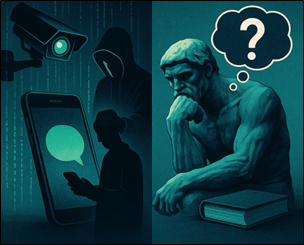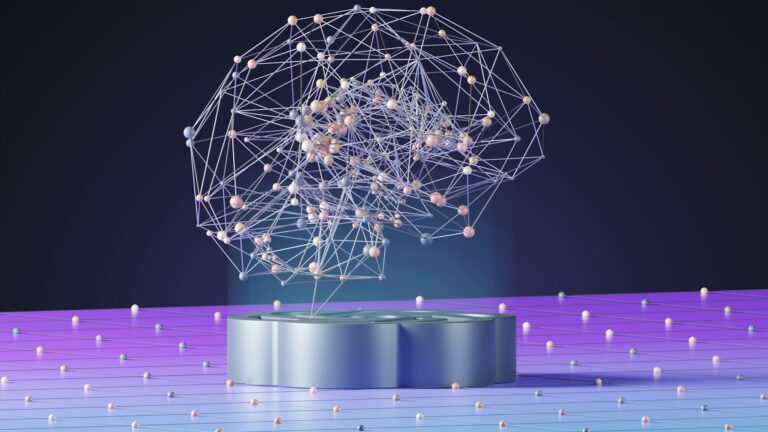Kommunale Online-Partizipation: Fehlende Grenzen, fehlende Legitimität
von Jonathan Seim (Düsseldorf)
Dieser Blogbeitrag basiert auf einem Aufsatz, der in einem Schwerpunkt zur Philosophie der Stadt in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift für Praktische Philosophie (ZfPP) erschienen ist. Der Aufsatz kann auf der Website der ZfPP kostenlos heruntergeladen werden.
Innerhalb der letzten Jahrzehnte wurde immer wieder eine Krise repräsentativer Demokratien diagnostiziert. Als ein Ausweg aus dieser Krise wird oftmals eine stärkere Einbindung der Bürger:innen in politische Beratungs- und Entscheidungsprozesse verstanden. In diesem Kontext erfreuen sich internetgestützte Verfahren der Bürger:innenbeteiligung insbesondere auf kommunaler Ebene zunehmender Beliebtheit. Die Frage, wer sich an solchen Verfahren beteiligen können sollte, ist bisher allerdings nur unzureichend thematisiert worden.
Seit der griechischen Polis war die Stadt lange Zeit der natürliche Ort der Demokratie und noch Rousseau schrieb Ende des 18. Jahrhunderts, dass sich die Demokratie nur in überschaubaren Gemeinschaften verwirklichen lasse. Im Zuge der US-amerikanischen Verfassungsdebatte argumentierten die Föderalisten hingegen für einen starken demokratischen Bundesstaat und legten damit den theoretischen Grundstein für die repräsentative Demokratie moderner Nationalstaaten. Nun muss man sicherlich kein Anhänger vormoderner Ideale des griechischen Stadtstaates sein, um die Reduzierung der staatsbürgerlichen Rolle auf den Akt der Wahl nationaler Parlamente zu bedauern.
In Anknüpfung an die partizipative Demokratietheorie wird in dem Mangel an effektiven Beteiligungsmöglichkeiten oftmals sogar eine wichtige Ursache für die Krise repräsentativer Demokratien gesehen. Die Entfremdung der Bürger:innen von der Politik sei nicht weiter verwunderlich, da Bürger:innen erst durch eine unmittelbare Beteiligung an Prozessen politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung zu einer Wertschätzung demokratischer Prozesse gelangen würden. Somit liege die Antwort auf die Krise der Demokratie in einem Mehr an Demokratie und der Ergänzung repräsentativer Strukturen um unmittelbare Teilhabemöglichkeiten für Bürger:innen.
Im Kontext solcher partizipativen Bestrebungen fungiert gerade der politische Raum der Stadt als bevorzugte Arena demokratischer Innovationen: Beispielsweise sei auf der kommunalen Ebene die Verbindung zwischen den eigenen Interessen und politischen Entscheidungen und ihren Konsequenzen für die Individuen deutlicher. Zudem seien Bürger:innen über das nahe Lebensumfeld tendenziell informierter als bei Sachfragen auf übergeordneten politischen Ebenen. Zuletzt sei die individuelle Stimme auf kommunaler Ebene zumindest relativ zur Länder- oder Bundesebene von größerem politischem Gewicht, weshalb auch die Motivation zur Partizipation höher sei. Somit verschwindet die Stadt im modernen Nationalstaat keineswegs von der politischen Landkarte, sondern gewinnt als Keimzelle der Demokratie sogar zunehmend an Bedeutung.
Daran hat auch das Internet nicht prinzipiell etwas geändert. Zwar transzendiert das Internet räumliche Beschränkungen und erleichtert die Konstituierung überregionaler Gemeinschaften, doch vielfach wird es gerade dazu eingesetzt, die lokale Demokratie zu stärken. Schon von Beginn an sah man im Internet die Möglichkeit, Partizipationsangebote zu erweitern und zu vertiefen. Beispielsweise werden klassische Hürden und Kosten der politischen Information und Partizipation abgebaut beziehungsweise gesenkt, sodass die Beteiligung der Bürger:innen erleichtert wird und zumindest das Potenzial besteht, zuvor nur unzureichend berücksichtigte Personengruppen in staatliche Beratungs- und Entscheidungsprozesse zu integrieren. Zudem ermöglichen internetgestützte Beteiligungsformate einen Grad an Interaktivität und Dialog, welcher klassischen Massenmedien nicht zukommt, sodass die Beziehung zwischen Repräsentant:innen und Repräsentierten intensiviert werden könnte.
Tatsächlich bekennen sich viele Städte und Kommunen Deutschlands beispielsweise in Form kommunaler Leitlinien zur Bürger:innenbeteiligung zu einer stärkeren politischen Integration der Bürger:innen. Zu diesem Zweck werden in zunehmender Anzahl internetgestützte Beteiligungsverfahren eingesetzt. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie von den Kommunen selbst initiiert werden, sie individuelle Bürger:innen und nicht etwa Experten oder organisierte Interessen adressieren, sie sich nicht auf eine reine Information der Teilnehmenden beschränken und ihre Ergebnisse formal unverbindlich sind, die Entscheidungskompetenz also bei staatlicher Stelle verbleibt.
Internetgestützte Beteiligungsverfahren sehen sich mit vielen Fragen politischer Legitimität konfrontiert. Eine Frage, mit der sich bisher noch nicht ausreichend beschäftigt wurde, betrifft die Frage nach der Verteilung von Partizipationsrechten: Wer sollte sich an solchen Verfahren beteiligen dürfen? Ein Blick in die politische Praxis zeigt, dass der Zugang zu solchen Beteiligungsverfahren oftmals nicht ausreichend geregelt oder kontrolliert wird. So könnte sich beispielsweise eine Australierin am Online-Bürger:innenhaushalt einer deutschen Kommune beteiligen.
Der Einsatz virtueller Verfahren ist ambivalent, insofern der Abbau räumlicher Hürden nicht nur die Beteiligung berechtigter Personen, sondern auch die Beteiligung nicht berechtigter Personen erleichtert oder sogar erst ermöglicht. Während in der Vergangenheit in der Regel die Exklusion von eigentlich berechtigten Personen (Über-Exklusivität) – zum Beispiel Frauen, Besitzlose und Schwarze – Anlass für legitimitätstheoretische Kritik war, müssen Online-Beteiligungsverfahren, welche auf eine Beschränkung des Zugangs verzichten, für die Inklusion eigentlich nicht berechtigter Personen (Über-Inklusivität) kritisiert werden. Die Schwierigkeit an dieser Stelle besteht darin, dass der korrekte Zuschnitt des Demos und damit auch die Kritik von über-exklusiven und über-inklusiven Demoi offenkundig von der gewählten Theorie politischer Legitimität abhängt. Sind beispielsweise politische Entscheidungen umso legitimer, desto höher ihre inhaltliche Qualität ist, müssen Partizipationsrechte prima facie so verteilt werden, dass die Qualität der Entscheidung möglichst hoch ist. Wird hingegen der Wert politischer Selbstbestimmung in den Mittelpunkt gerückt, müssen Partizipationsrechte beispielsweise anhand der Betroffenheit oder der Mitgliedschaft in der jeweiligen politischen Gemeinschaft vergeben werden.
Ohne sich auf eine bestimmte Theorie politische Legitimität festzulegen, lässt sich festhalten, dass der Verzicht auf eine Beschränkung des Zugangs internetgestützter Beteiligungsverfahren stets legitimationstheoretisch problematisch ist. Denn so können sich beispielsweise auch Personen beteiligen, die weder vom Gegenstand des Verfahrens betroffen sind oder der jeweiligen politischen Gemeinschaft angehören noch zur Qualität der Entscheidungsfindung beitragen können. Gegen diese These lassen sich drei Einwände einbringen, die im Folgenden zu überprüfen sind.
1) Der epistemische Einwand weist darauf hin, dass eine Beschränkung des Zugangs nicht zulässig sei, da so relevante Gesichtspunkte und Perspektiven, welche der Qualität der Entscheidungsfindung zuträglich sind, ausgeschlossen würden. Die prinzipielle Offenheit der Beteiligungsverfahren stelle somit keinen Fall von Über-Inklusivität dar, da diese nicht nur zulässig, sondern sogar anzustreben ist, um zu möglichst sachgerechten Entscheidungen zu gelangen. Dieser Einwand vermag nicht zu überzeugen, da bereits fraglich ist, ob eine Australierin ohne Ortskenntnisse tatsächlich einen sinnvollen Beitrag zum Online-Bürger:innenhaushalt einer deutschen Kommune leisten kann. Zudem haben es rationale Argumente in einem deliberativen Forum schwerer sich durchzusetzen, wenn sachfremde und uniformierte Beiträge einen breiten Raum einnehmen. Schlussendlich ist eine Qualitätsverbesserung durch einen Verzicht auf eine Beschränkung des Zugangs und einen möglichst inklusiven Diskurs nicht zu erwarten. Ganz im Gegenteil würde dies die Qualität der Diskussion eher unterminieren.
2) Der Indifferenzeinwand wiederum geht davon aus, dass Partizipationsrechte anhand des Kriteriums der Betroffenheit verteilt werden sollten. Die Inklusion nicht betroffener Personen sei zwar ein Fall von Über-Inklusivität, aber gleichzeitig nicht weiter problematisch. Denn Personen, deren Interessen von dem Verfahren nicht im Geringsten betroffen sind, würden willkürlich abstimmen, was zu einer statistischen Gleichverteilung ihrer Voten führe und somit keinen Einfluss auf das Ergebnis des Verfahrens habe. Dem Einwand lässt sich zweierlei entgegenhalten. Zum einen widerspricht die Notwendigkeit, die Voten nicht betroffener Personen zu berücksichtigen, dem Grundgedanken kollektiver Autonomie, selbst wenn sich die Voten gegenseitig aufheben sollten. Zum anderen ist mehr als fraglich, ob es tatsächlich zu einer Gleichverteilung der Voten kommt. Beispielsweise können bereits die Eingängigkeit eines Slogans oder die physische Attraktivität politischer Akteure verzerrend wirken, selbst wenn keine eigenen Interesse betroffen sind.
3) Der dritte Einwand führt die Unverbindlichkeit der Verfahren an, um in Frage zu stellen, ob die Zusammensetzung des Demos überhaupt legitimationstheoretisch relevant ist. Immerhin verbleibt die Entscheidungskompetenz bei gegenwärtigen Beteiligungsverfahren formal bei staatlicher Stelle, sodass die Demoi der Verfahren selbst keine allgemeinverbindlichen Entscheidungen treffen. Für die Legitimität der Entscheidung reiche somit die Legitimität des Stadtrates aus, welche durch die demokratische Wahl gegeben sei. Dem lässt sich entgegnen, dass die Verfahren trotz der formalen Unverbindlichkeit de facto oftmals einen gewissen Einfluss auf die staatliche Entscheidungsfindung ausüben. Dies entspricht ihrer Zielsetzung, die Akzeptanz und Legitimität staatlicher Entscheidungen durch eine Mitwirkung der Bürger:innen zu verbessern. Ein potenzieller Einfluss wird beispielsweise auch in den einschlägigen kommunalen Leitlinien zur Bürger:innenbeteiligung in Aussicht gestellt. Zuletzt verstehen sich einerseits Repräsentant:innen in diesem Kontext oftmals als responsive Entscheidungsträger:innen, welche die Ergebnisse der Verfahren, sofern dies sinnvoll und möglich ist, auch umsetzen. Andererseits wird von Repräsentant:innen erwartet, dass sie sich responsiv verhalten, weshalb der politische Druck eine Missachtung der Ergebnisse zumindest erschwert.
Damit hat der vorliegende Beitrag begründet, dass der Verzicht auf eine Beschränkung des Zugangs kommunaler Online-Beteiligungsverfahren legitimationstheoretisch problematisch ist. Nach welchen Kriterien nun Partizipationsrechte in diesem Kontext verteilt werden müssen, bleibt Gegenstand weiterer Arbeiten.
Jonathan Seim ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Düsseldorfer Institut für Internet und Demokratie (DIID) und im Projekt Digitale Ethik am Center for Advanced Internet Studies (CAIS), welches von der Mercator-Stiftung gefördert wird. Im Fach Philosophie promoviert er zu Verteilung von Partizipationsrechten bei internetgestützten Bürgerbeteiligungsverfahren. Sein Twitterprofil.