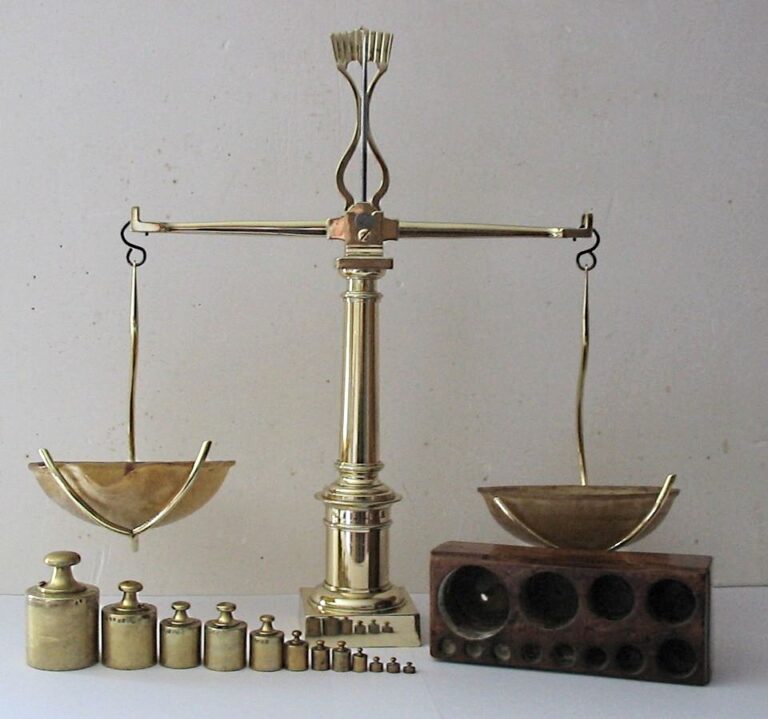Trump und die ‚woke Sprachpolizei‘: Alles nur Sprachmagie?
Steffen Koch (Universität Bielefeld)
„Minorität“, „Identität“, „Hassrede“, „Aktivismus“, „Klimakrise“, „anti-rassistisch“ und „Frau“ – dies sind nur sieben aus insgesamt über 200 Wörtern, die laut einer Recherche der New York Times der staatlichen Zensur durch die Trump-Administration zum Opfer gefallen sind. Die Zensur beinhaltet die Streichung dieser Ausdrücke von allen staatlichen Webseiten und Bildungsmaterialien, sowie eine neuerliche Prüfung von Anträgen und Verträgen, in denen sie auftauchen. Sie ist damit Ausdruck einer versuchten „Säuberung“ aller bundesstaatlichen Behörden von „woken“ Initiativen, denen an der Förderung von Diversität, Gleichheit und Inklusion (engl. DEI) gelegen ist, und zu deren Zweck die Trump-Administration auch über diese Zensur hinaus mit Massenentlassungen und massiven Geldkürzungen für Aufsehen sorgt.
Im Kommentariat um diese beispiellose Zensur dauerte es nicht lange, bis großzügige Parallelen zu als „woke“ bezeichneter Sprachkritik gezogen wurden. In der ZEIT war zu lesen, es würde nun die „linke Gesinnungspolizei“ durch eine rechte ersetzt, indem „das Mittel der Sprachregelung“ – der „heilige Gral der woken Bewegung“ – neuerdings von „rechten Kulturkriegern in Anspruch genommen“ werde; im Spiegel wurde kommentiert, der rechte Angriff auf die Kultur gleiche einer „Konterrevolution“ (man beachte die Präsupposition einer vorausgegangenen linken Revolution), durch welche „die Kontrolle und Sanktionierung von Sprache“ nun gegen deren eigentliche Verfechter eingesetzt würde; und im Deutschlandfunk war in der Sendung Sein und Streit von Philipp Hübl zu hören, die Trump-Administration „verfalle derselben Sprachmagie wie die progressiven Sprachpuristen, die sie kritisieren“.
Richtig ist, dass die Nutzung von Sprachinterventionen – der gezielten Einflussnahme auf die von einer Gruppe genutzten Ausdrucksweisen – zur Erreichung politischer Ziele nicht neu ist. Sie wurde weder von der Trump-Administration noch von der „woken Bewegung“, mit der sie momentan so gerne verglichen wird, erfunden, sondern hat einen festen Platz in den verschiedensten politischen Lagern von so ziemlich allen modernen Gesellschaften. Historische Beispiele dafür liefern etwa die von Nazis geprägten Ausdrücke wie „Volksgemeinschaft“, „Lebensraum“ oder „entartete Kunst“; die bolschewistische Vereinnahmung von „Klassenfeind“, „konterrevolutionär“, oder „Kulak“; die während der chinesischen Kulturrevolution geprägte Rede vom „neuen Menschen“; die Anfang der 90er Jahre maßgeblich von Queer Nation vorangetriebene Re-appropriation des Ausdrucks „Queer“; der von Feministinnen wie Dale Spender, Adrienne Rich oder Mary Daly anvisierte Kampf um eine „Sprache für alle“; oder die von politischen Strategen wie Frank Luntz forcierte Umbenennung der Erbschaftssteuer in die „Todessteuer“ (death tax).
Die möglichen Folgen von Sprachinterventionen werden indes kontrovers diskutiert. Während die einen, häufig mit Bezug auf George Orwells ‚Neusprech‘, sagen, es handele sich um eine hochgefährliche Form der Gedankenkontrolle, sehen andere darin nicht mehr als den naiven und höchstens lächerlichen Versuch, sich die Welt durch eine Veränderung der Art, wie man über sie redet, zurechtzubiegen. Dies ist die von Philipp Hübl so bezeichnete „Sprachmagie“: Wenn wir manche Wörter einfach nicht mehr verwenden, so das unterstellte Kalkül, dann existieren auch die unliebsamen Phänomene nicht mehr, die durch sie bezeichnet werden; und wenn wir die Erbschaftssteuer jetzt konsequent Todessteuer nennen, dann werden auch die eingefleischtesten Demokraten bald merken, wie ungerecht sie ist.
Tatsächlich ist jedoch nicht davon auszugehen, dass progressive wie reaktionäre Sprachinterventionisten einer Sprachmagie erliegen. Sprachinterventionen erhalten ihre Rechtfertigung vielmehr durch den plausiblen Gedanken, dass eine Veränderung der Sprache, die wir sprechen, zu Veränderungen in unserem Denken führt, was sich dann mittelbar auch in Verhaltensänderungen und somit in einer Veränderung der realen Umstände niederschlägt. Dieser Gedanke ist streitbar und bedarf eingehender Prüfung; mit Magie hat er allerdings wenig zu tun. Stattdessen fußt er auf einer langen Tradition wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Sprache und Denken.
Zwar ist die lange Zeit speziell in geisteswissenschaftlich interessierten Zirkeln populäre Sapir-Whorf Hypothese von der unhintergehbaren Determination unseres Denkens durch die Sprache – filmisch inszeniert etwa in „Arrival“ – inzwischen in Misskredit geraten. Dennoch liefert uns die Psycholinguistik inzwischen gute Belege für einen handfesten Einfluss von Sprache auf unser Denken. Dieser besteht nicht, wie von Whorf angenommen, darin, dass unsere Sprache uns den Raum des überhaupt Denkbaren vorstrukturiert. Stattdessen sorgt das Vokabular unserer Sprache für eine Art Habitualisierung unserer Denkprozesse: welche Einzeldinge wir etwa als ähnlich betrachten, wie wahrscheinlich es ist, dass wir uns an etwas erinnern, oder in welcher Richtung wir nach einer Lösung für ein uns gestelltes Problem suchen.[1] Haben wir einen Ausdruck für ein Phänomen, dann neigen wir dazu, diesem Phänomen eine größere Bedeutung zu schenken. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass wenn uns ein Ausdruck abhandenkommt, das durch ihn bezeichnete Phänomen für uns an Wichtigkeit verliert.
Der Kampf um Wörter ist vor diesem Hintergrund auch als ein Kampf um unsere gewohnheitsmäßigen Denkungsarten zu verstehen. Auf dem Spiel steht dabei, welche relative Wichtigkeit wir einem Phänomen zuweisen und welche Rolle es in unserem Denken spielt. Dabei mögen die Effekte von Sprachinterventionen tatsächlich weniger gravierend sein, als etwa in Orwell’s 1984 oder auch von den frühen Verfechtern der Sapir-Whorf Hypothese angenommen; andererseits ist aber sicher kein magisches Denken nötig, um sich über die Auswirkungen von Sprachzensurprogrammen Sorgen zu machen.
Doch auch die Gleichsetzung der staatlich verordneten Zensur der Trump-Administration mit linken bzw. „woken“ Sprachinterventionen ist irreführend, denn tatsächlich handelt es sich hier um zwei völlig verschiedene Projekte. Durch Einflussnahme auf unsere Sprachpraxis ein Umdenken herbeiführen zu wollen, ist eine Sache. Aber anhand von einer Liste von Wörtern einen politischen Gegner zu identifizieren und durch teilweise verfassungswidrige Machtausübung zu bekämpfen, ist eine ganz andere. Die „woke“ Sprachkritik – man mag über sie denken, was man möchte – ist dem ersten Projekt verpflichtet, genauso übrigens die Bemühungen rechter „Sprachzauberer“ wie Frank Luntz während der 90er Jahre oder Trump-naher Medien wie Fox News, die während des Wahlkampfes die Rede von „migrant crime“ prägten und nun den „Golf von Amerika“ feiern. Für dieses Projekt ist Sprache zentral, geht es doch im Kern darum, durch gezielte Sprachinterventionen Einfluss auf die politische Meinungsbildung zu nehmen.
Trumps Sprachzensur ist hingegen nur vordergründig ein auf Sprache gerichteter Eingriff. Tatsächlich geht es dabei weniger darum, wie Menschen miteinander sprechen, als vielmehr darum, wer in Zukunft noch an Universitäten oder in staatlichen Agenturen beschäftigt sein wird, welche Forschung noch mit welchen finanziellen Mitteln unterstützt wird, welche Inhalte an Schulen unterrichtet werden dürfen bzw. sollen, und vieles mehr. Diese weitreichenden Einschnitte in die Zivilgesellschaft als eine Art umgedreht-wokistische Sprachregulierung aufzufassen, ist sachlich unrichtig und läuft auf Verharmlosung hinaus. Wenn wir schon eine historische Analogie zu Trumps Zensurprogramm bemühen wollen, dann sollten hier die Gleischaltungsprogramme der totalitären Regime des 20. Jhdts als Bezugspunkt gelten, anstatt die „woke“ Sprachkritik der letzten Jahrzehnte.
Zum Autor:
Steffen Koch ist akademischer Rat auf Zeit an der Abteilung Philosophie der Universität Bielefeld, wo er aktuell ein DFG-gefördertes Forschungsprojekt zu sprachlichen Interventionen leitet. Mehr zu seiner Arbeit erfahren Sie auf www.steffenkoch.org
[1] Vgl. z.B. Zettersten, M. & Lupyan, G. (2020). Finding categories through words: More nameable features improve category learning. Cognition, 196, 104135. doi: 10.1016/j.cognition.2019.104135. und Lupyan, G., & Zettersten, M. (2021). Does Vocabulary Help Structure the Mind? Minnesota Symposia on Child Psychology, 160–199. doi: 10.1002/9781119684527.ch6