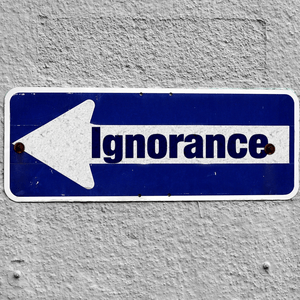
Das Recht auf Nichtwissen in der Medizin
Von Joachim Boldt (Freiburg) & Franziska Krause (Heidelberg)
Habe ich ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Altersdemenz? Oder für eine andere genetisch bedingte Erkrankung? Wer will, kann sein Genom bei kommerziellen Online-Anbietern auf solche Erkrankungen hin analysieren und auswerten lassen. Das kostet nicht viel und es geht schnell. Was macht man aber dann, wenn das Ergebnis tatsächlich ein erhöhtes Risiko angibt? Was, wenn sich der Krankheit nicht vorbeugen lässt und sie nicht zu therapieren ist?
Unter anderem damit man sich diese Fragen nicht erst nach einer Genanalyse stellt, sind derartige Direct-to-Consumer-Tests in Deutschland verboten und für Gentests, die vor dem Auftreten einer Erkrankung durchgeführt werden (sogenannte prädiktive Tests), ist ein humangenetisches Beratungsgespräch vorgeschrieben. Diese gesetzlichen Regelungen gehen unter anderem auf die schon länger andauernde medizinethische Diskussion um Gentests und um ein Recht auf Nichtwissen in diesem Bereich zurück. Konsens war und ist, dass jemand, der einen prädiktiven Gentest durchführen lässt, dies nicht schlecht informiert oder mit falschen Erwartungen tun soll. Deshalb ist im Fall der prädiktiven genetischen Untersuchung das Beratungsgespräch bei einer Ärztin oder einem Arzt gesetzlich festgeschriebene Pflicht. Umgekehrt ist auch Konsens, dass es keine Pflicht zur genetischen Diagnostik gibt. Wer sich nicht genetisch testen lassen möchte, muss dies auch nicht tun. Das ist das vielbeschworene Recht auf Nichtwissen im Bereich der genetischen Diagnostik.
Wissen besitzt traditionell einen guten Leumund, nicht nur in der Philosophie. Mit aller Vorsicht gegenüber solchen Pauschalisierungen wird man das wohl behaupten können. Sokrates stellt seinen besorgten Freunden gegenüber klar, dass er als Philosoph dem Tod ruhig entgegensehen könne, weil nach dem Tod, und erst nach dem Tod, das wahre Wissen zu erlangen sei, zu dem es den Philosophierenden auch im Leben immer schon ziehe. Kant verlangt nicht nur von den Philosophinnen und Philosophen, sondern von allen Menschen, dass sie den Zustand der Unmündigkeit verlassen und sich ihres Verstandes bedienen mögen, um so als Wissende handeln zu können. Aus dieser Sicht muss es merkwürdig, ja rückständig und rückfällig anmuten, von einem Recht auf Nichtwissen zu sprechen. Nun geht es aber bei den rechtlichen und ethischen Vorbehalten nicht darum, generell den Wert der Uninformiertheit hochzuhalten, sondern darum, für einen ganz bestimmten begrenzten Kontext festzuhalten, dass man nicht alles wissen muss, was man wissen kann. Dieser Kontext ist Wissen, das die eigene gesundheitliche Zukunft betrifft. Werfen wir also einen genaueren Blick auf diesen Kontext: Welche Zielsetzungen werden mit genetischer Diagnostik in der medizinischen Praxis verfolgt? Wie hängt das Recht auf Nichtwissen in der Medizin mit dem Recht auf Selbstbestimmung zusammen? Und welche Herausforderungen stellen sich für die Betroffenen im Umgang mit genetischem Wissen?
Zielsetzungen genetischer Diagnostik
Genetische Tests auf Krankheiten lassen sich erstens durchführen, wenn sich bereits Symptome einer Erkrankung zeigen und man in Erfahrung bringen möchte, ob man es mit einer bestimmten genetisch bedingten Erkrankung zu tun hat, um dann, wenn möglich, passende Therapien anbieten zu können, oder zumindest besser prognostizieren zu können, wie der Krankheitsverlauf sein wird. Kinder, die mit spinaler Muskelatrophie geboren werden, zeigen zum Beispiel von Geburt an Symptome von Muskelschwäche, die auch die Atemmuskulatur betreffen. Diese Kinder haben eine sehr verkürzte Lebenserwartung. Viele sterben schon vor Ablauf des zweiten Lebensjahres. Mit Hilfe der genetischen Diagnostik kann die Symptomatik auf eine spezifische genetische Variation zurückgeführt und eine Prognose zum Krankheitsverlauf gestellt werden. Dann lassen sich begleitende leidenslindernde Therapien verschiedener Art und pflegerische und soziale Unterstützungsmaßnahmen für das betroffene Kind und die Familie planen. Bei einer bestimmten Unterform der spinalen Muskelatrophie ist es darüber hinaus seit Kurzem möglich auch eine Therapie einzuleiten, die den Ausfall der relevanten genetischen Funktion soweit kompensiert, dass ein Fortschreiten der Erkrankung weitgehend verhindert wird. In diesen Fällen ergänzt die genetische Diagnostik das bereits bestehende Wissen, dass eine schwere Erkrankung vorliegt. Die genetische Testung liefert Details zur Art der Erkrankung und möglichen lindernden Maßnahmen oder kurativen Therapien. Die Diagnostik modifiziert bereits bestehendes Wissen über die Zukunft des Betroffenen und sie hat einen Wert für alle die, die am Wohlergehen der Betroffenen interessiert sind.
Es ist zweitens aber auch möglich, genetisch zu testen, bevor sich Symptome einer Erkrankung zeigen. Im Fall der Huntington-Erkrankung kann das Ergebnis einer solchen prädiktiven Diagnostik beispielsweise sein, dass ein gesund erscheinender und sich gesund fühlender Mensch mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit im Alter von etwa vierzig Jahren eine schwere, zum Tod führende Erkrankung bekommen wird, die nicht therapierbar ist. Huntington ist eine monogenetische Erkrankung, die unter anderem zu Sprech- und Schluckstörungen, Unbeweglichkeit und kognitivem Abbau führt. Die meisten Patienten sterben innerhalb von 15 Jahren nach dem Auftreten der ersten Symptome. Leidenslindernd ausgerichtete therapeutische Maßnahmen und pflegerische und soziale Unterstützung tragen dazu bei, dass sich die Lebenserwartung erhöht und die Lebensqualität verbessert, eine den genetisch bedingten neurologischen Abbauprozess verhindernde oder stoppende Therapie gibt es aber nicht.
Ein drittes Beispiel des Einsatzes genetischer Tests ist die Frühdiagnostik der Alzheimer-Demenz (siehe auch Text zu Demenz von Martina Schmidhuber). Diese Frühdiagnostik besteht aus der Kombination von genetischen Analysen mit Analysen weiterer, nicht-genetischer Biomarker, die mit dem Auftreten der Demenz korreliert sind. Die Diagnostik kann beim Auftreten erster, noch unspezifischer Symptome erfolgen und ermöglicht dann Aussagen darüber, ob und um welchen Faktor die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Erkrankung bei dem Betroffenen gegenüber der Normalbevölkerung erhöht ist. Es ist keine Therapie bekannt, die das Auftreten der Alzheimer-Demenz verhindern könnte.
Schließlich kann die prädiktive Diagnostik viertens auch schon vor der Geburt zum Einsatz kommen. Dies kann nach In-Vitro-Fertilisation vor dem Einsetzen des Embryos in die Gebärmutter geschehen. Zu diesem Zeitpunkt besteht der Embryo aus wenigen Zellen, von denen eine entnommen und untersucht wird. Weist der Embryo die gesuchte genetische Auffälligkeit nicht auf, wird er in den Uterus eingesetzt, andernfalls wird er verworfen. Für die Präimplantationsdiagnostik gibt es in Deutschland rechtliche Vorgaben, die regeln, auf welche genetisch bedingten Erkrankungen getestet werden darf. Im Rahmen der Pränatalmedizin kann auch ohne In-Vitro-Fertilisation vorgeburtlich genetisch getestet werden. Bei Entwicklungsauffälligkeiten des Fötus, die im Ultraschall entdeckt werden, kann Fruchtwasser entnommen und die darin enthaltene fetale DNA untersucht werden oder es kann inzwischen auch DNA des Kindes im Blut der Mutter isoliert und analysiert werden. Bei diesen Untersuchungen wird auf die chromosomalen Fehlbildungen Trisomie 13, 18 und 21 getestet. Trisomie 13 und 18 sind mit schweren Organschäden verbunden und die betroffenen Kinder sterben meist innerhalb des ersten Lebensjahres. Kinder mit Trisomie 21 dagegen können je nach Grad der Beeinträchtigung ein langes und auch selbständiges Leben führen. Therapien für die genannten Trisomien gibt es nicht. Eltern von Kindern, bei denen vorgeburtlich eine Trisomie festgestellt wird, entscheiden sich häufig für einen Abbruch der Schwangerschaft. Es ist zu erwarten, dass sich das Spektrum der genetischen Erkrankungen, auf das pränataldiagnostisch getestet werden kann, in Zukunft erweitern wird.
Die Beispiele verdeutlichen die Bandbreite des Einsatzes genetischer Diagnostik, die auch für die medizinethische Diskussion von Relevanz ist. Die vorgestellten Fälle unterscheiden sich dabei hinsichtlich der folgenden Dimensionen: die erste Dimension betrifft den Zeitpunkt der Untersuchung. Die Diagnostik kann symptomgeleitet, beim Auftreten unspezifischer erster Symptome, oder auch lange vor Beginn der ersten Symptome, dann als sogenannte prädiktive Diagnostik eingesetzt werden. Die prädiktive Diagnostik kann auch bereits vorgeburtlich stattfinden. Dann kann nicht mit der potentiell oder faktisch erkrankten Person über den Wert der Diagnostik und mögliche Konsequenzen beraten werden, sondern es wird für und über das untersuchte Individuum entschieden. Ethisch diskutiert wird vor allem die frühe und prädiktive Diagnostik.
Die zweite Dimension betrifft die Frage der Sicherheit der Voraussage. Früh und prädiktiv eingesetzt kann die genetische Untersuchung zur Diagnose von Erkrankungen führen, deren Auftreten unausweichlich ist oder deren Auftreten um eine bestimmte Wahrscheinlichkeit gegenüber dem Risiko der Normalbevölkerung erhöht ist. Auch die Ausprägung der Erkrankung kann variieren und die Voraussage der Ausprägung mit mehr oder weniger großer Unsicherheit behaftet sein.
Die dritte Dimension betrifft die Möglichkeit der Therapie. Diagnostiziert werden können Erkrankungen, bei denen es eingeführte Therapien gibt, und andere, bei denen leidenslindernd begleitet, der Ausbruch der Krankheit aber nicht verhindert beziehungsweise der Krankheitsprozess nicht gestoppt oder verlangsamt werden kann. Bei der Pränataldiagnostik kann die Reaktion auf eine positive Diagnostik im Verwerfen des Embryos beziehungsweise im Abbruch der Schwangerschaft bestehen.
Ethisch besonders diskussionswürdig sind diejenigen Tests, die vor Ausbruch einer Erkrankung stattfinden, bei denen keine Therapieoption besteht oder bei denen der Schweregrad der genetisch bedingten Krankheit unterschiedlich sein kann und schwer vorherzusagen ist. In diesen Fällen bietet das Recht auf Nichtwissen Schutz: Zu wissen, dass man an Huntington erkranken wird, ohne etwas daran ändern zu können, kann eine Hilfe sein, wenn man sein Leben bis zum Ausbruch der Erkrankung entsprechend gestalten kann und will. Es kann aber auch eine große Belastung sein, die das ganze Leben bis zum Ausbruch der Erkrankung überschattet. Das Recht auf Nichtwissen schützt vor dieser Belastung. Zu wissen, dass das Ungeborene geistige oder körperliche Einschränkungen haben wird, kann helfen, wenn man sich ein Leben mit einem behinderten Kind nicht vorstellen kann und wenn man bereit ist, die Schwangerschaft abzubrechen. Es kann auch helfen, wenn man sich auf das Leben mit einem behinderten Kind vorbereiten möchte. Es kann aber auch als Verunsicherung wahrgenommen werden, wenn man sich doch eigentlich zum Austragen des Kindes entschieden hatte, egal ob es eine Behinderung haben wird oder nicht, und mit dem positiven Test die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch nun konkret im Raum steht. Hier schützt das Recht auf Nichtwissen davor, in einen Automatismus vermeintlich naheliegender Schritte zur Testung und zum Schwangerschaftsabbruch zu geraten, wenn man diesen Weg für sich ausschließt.
Recht auf Nichtwissen und Selbstbestimmung
Das Recht auf Nichtwissen in der Medizin schützt davor, wie gesehen, in eine Situation zu geraten, die man als belastend empfinden würde und ist deshalb eng verbunden mit dem Recht auf Selbstbestimmung. Das Recht auf Selbstbestimmung ist in der Medizin in erster Linie ein Abwehrrecht. Patienten müssen vor jeder geplanten Behandlung über die Art des Eingriffs, den Nutzen und die Risiken aufgeklärt werden und der Eingriff darf nur dann erfolgen, wenn die Patientin diesem zustimmt. Bedingung dieser informierten Zustimmung (auch als ‚informed consent‘ bekannt) ist, dass der Patient frei von Zwang und adäquat informiert seiner Behandlung zustimmt. Unabhängig davon, als für wie nützlich die Behandlung medizinisch erachtet wird, haben Patientinnen immer das Recht, einem Eingriff nicht zuzustimmen. Ganz analog haben sie das Recht, auf Diagnostik zu verzichten, und sie haben im Übrigen auch das Recht von einem Untersuchungsergebnis nicht zu erfahren, wenn dies zum Beispiel unerwartet als Nebenbefund einer mit Zustimmung durchgeführten Diagnostik zustande gekommen ist. Hier konstituiert sich das Recht auf Nichtwissen.
Dieses Recht zur Selbstbestimmung bezieht sich wiederum auf die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, in der medizinethischen Literatur häufig auch als Autonomiefähigkeit bezeichnet. Wer diese Fähigkeit besitzt, bei dem begründet sie das Recht, autonom zu entscheiden und zu handeln. Neuere Diskussionen zum Autonomiebegriff in der Medizinethik betonen, dass individuelle Wertvorstellungen nicht losgelöst von sozialen Beziehungen, Konzepten des guten Lebens und situativen Kontexten gedacht werden können. Diese unter dem Stichwort der relationalen Autonomie verhandelten Ansätze haben gemeinsam, dass sie das Individuum in einen intersubjektiven, kulturell-historischen und sozialen Kontext einbinden und Selbstbestimmung nicht nur unter dem Aspekt des Rechts des Einzelnen begreifen, Entscheidungen frei von äußeren Zwängen und im Sinne des eigenen Lebensentwurfs zu treffen, sondern auch betonen, dass individuelle Entscheidungsfindung und Lebensentwürfe sozial und kulturell eingebettet sind. Ein solches Verständnis von Autonomie zeichnet sich beispielsweise in den Anforderungen für Beratungsgespräche im Rahmen der genetischen Diagnostik ab. Hier sollen neben den medizinischen Aspekten auch mögliche psychische und soziale Fragen erörtert werden (GenDG §10 (3)), um eine umfänglich informierte Entscheidungsfindung der Betroffenen zu ermöglichen. Angesichts der hohen Schwangerschaftsabbruchraten bei der Diagnose Trisomie 21 wird in diesem Zusammenhang aber auch diskutiert, ob die Präferenz zum Abbruch nicht wesentlich im Mangel gesellschaftlicher Akzeptanz behinderten Lebens und fehlender sozialer Unterstützung von Familien mit besonderen Bedarfen begründet ist. Was zunächst als individuelle, private Entscheidung erscheint, kann mit dem Konzept der relationalen Autonomie als ein Produkt sozialer Gegebenheiten gelesen werden, die die Entscheidung bspw. nach einem auffälligen Ergebnis bei der Pränataldiagnostik für oder gegen einen Abbruch bewusst oder unbewusst mitbestimmen.
Schon die Entscheidung für die Durchführung der Pränataldiagnostik (PND) sollte nicht ungeachtet des Kontextes betrachtet werden: Eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA 2006) hat ergeben, dass 52% der befragten Frauen angaben, die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde Arzt hätten einen großen Einfluss auf die Durchführung der PND gehabt, ein Viertel habe sogar nur auf Wunsch der Ärztin oder des Arztes die Maßnahmen durchführen lassen. Sie gaben darüber hinaus an, sehr viel weniger über die Möglichkeiten des Vorgehens bei einem auffälligen Ergebnis oder über die Möglichkeiten der psychosozialen Beratung aufgeklärt worden zu sein als über die medizinischen Aspekte. 71% empfanden die Beratung hinsichtlich der Vorbereitung auf ein Leben mit einem behinderten Kind als schlecht, 40% der Befragten sogar als sehr schlecht (BZgA, S. 10–11).
Erfahrungsberichte zum Erleben der Pränataldiagnostik und zum Leben mit einem behinderten Kind legen den Zwiespalt zwischen Wissen-Wollen und Umgang mit dem Wissen offen: „Aber was machen wir mit den Informationen und was machen die Informationen mit uns? Wir erhoffen uns von Wissen Klarheit. In vielen gesellschaftlichen Bereichen stimmt diese Gleichung. Bei Schwangerschaft und Geburt geht sie aber nicht auf. Diese Tests suggerieren eine Sicherheit, die es nicht gibt.“ (Kaiser 2019) Denn auch das Wissen um die Diagnose bedeutet noch nicht zu wissen, welchen Schwergrad die Symptome erreichen werden, wozu das Kind mit welcher Förderung fähig sein wird oder wie es ist, mit einem behinderten Kind zu leben. Letztlich wird ein Wissen geschaffen, das in relevanter Hinsicht „nicht schlauer macht.“ (Schulz 2017, S. 109)
Umgang mit genetischen Diagnosen und prognostischer Unsicherheit
Das Wissen, das eine genetische Diagnostik liefert, allein kann deshalb „nicht schlauer“ machen, weil es nicht nur mit Unsicherheiten behaftet ist, sondern auch weil es Wissen über Sachverhalte ist und damit die Frage, welche Werte und Überzeugungen ein gutes Leben anleiten können, systematisch offenlässt. Wer mit einer medizinischen Diagnose konfrontiert wird, dem stellt sich, generell gesprochen, immer das Problem, dieses Urteil, das aus der Dritten-Person-Perspektive der wissenschaftlichen Analyse gefällt wird, in Lebenswirklichkeit und Lebenspraxis und damit in die Erste-Person-Perspektive eines zu lebenden Lebens zu überführen. Das ist bei Krankheiten, die nur leichte oder vorübergehende Beschwerden machen oder gut zu therapieren sind, keine allzu große Herausforderung. Wenn aber die Beeinträchtigungen spürbarer sind, sich zeitlich länger erstrecken oder nicht gut zu behandeln sind, dann wird die Frage, wie medizinisches Wissen in ein einzelnes, zu gestaltendes und von normativen Überzeugungen angeleitetes Leben integriert werden kann, zunehmend relevant.
Der Philosoph und Arzt Karl Jaspers ist der Diskrepanz dieser Perspektiven im Band „Existenzerhellung“, dem zweiten Band seines dreibändigen Werks zur Philosophie, nachgegangen (Jaspers 1973). Die Überlegungen von Jaspers werden in der aktuellen medizinethischen Debatte kaum zu Rate gezogen, bieten aber gerade für die Frage des Umgangs mit medizinischem Wissen interessante und fruchtbare Denkanstöße (vgl. Boldt 2016). Jaspers nutzt zur Beschreibung der Diskrepanz die Begriffspaare von Wahrnehmung und Verantwortung, Distanz und Bedeutung, regelhafter Wechselwirkung und geschichtlicher Kommunikation sowie Quantität und Rang. Was in der Diagnose zunächst als Faktum erscheint, muss in der Perspektive des Betroffenen gedeutet werden als ein Geschehen, zu dem es sich zu verhalten gilt. Für dieses Verhalten und für die Gestaltung ist dann Verantwortung zu tragen. Welches Verhalten angemessen ist, ist aus der diagnostischen Perspektive nicht zu beantworten. Ist die Diagnose ein Schicksalsschlag, der passiv erduldet werden muss? Oder eher eine Herausforderung, die zu bestehen ist? In Bezug auf diese Fragen ist die wissenschaftliche Medizin sprachlos, und wenn sie sich diesen Fragen nähert, dann werden die verschiedenen Verhaltensoptionen schnell psychologisiert und so wieder aus dem Bereich des Zu-Verantwortenden und Zu-Gestaltenden herausgenommen und in den Bereich regelhafter Wechselwirkung re-transferiert.
Eine besondere Gefahr dieser Sprachlosigkeit liegt darin, dass medizinisch-institutionelle oder gesellschaftlich verbreitete Werthaltungen unreflektiert als selbstverständlich zu übernehmende Haltungen vorausgesetzt werden. Das kann im Fall einer Erkrankung, der sich vorbeugen lässt, die Überzeugung sein, dass der Wert des Gesundseins gegenüber anderen Werten vorrangig ist, weshalb auf eine solche Krankheit unbedingt getestet werden solle und das Leben bei positivem Resultat entsprechend anzupassen sei. Es kann auch die Haltung sein, dass die Unterstützung, die ein Kind mit Behinderung braucht, hinter anderen Lebensinhalten zurückstehen sollte. Nicht nur die pränatale genetische Diagnostik erscheint dann als Selbstverständlichkeit, sondern auch der Schwangerschaftsabbruch.
Auch das Verbleiben in der Perspektive des wissenschaftlichen Feststellens kann allerdings in bestimmten Situationen und Kontexten als angemessenes und zu verantwortendes Verhalten begriffen werden. Bei genetischer Diagnostik, die zur genaueren Abklärung schon vorhandener Symptome durchgeführt wird, kann die Diagnose, die das Krankheitsgeschehen objektiviert und vom Betroffenen distanziert erfasst, als Erleichterung erfahren werden, selbst dann, wenn keine Therapie zur Verfügung steht. Die Distanzierung wird dann zu einem Modus des Betroffenseins, in dem ich als Betroffener nicht untergehe, sondern in dem ich mir das Krankheitsgeschehen wie eine von mir unabhängig existierende Entität vorstellen und so von mir weghalten kann. Insofern sollte man die Begriffspaare, die Jaspers zur Beschreibung des Verhältnisses von der wissenschaftlichen Perspektive zur Perspektive des zu lebenden Lebens anbietet, nicht als Gegensatzpaare auffassen, bei denen es darauf ankommt, die wissenschaftliche Perspektive zu verlassen, sondern eher als Beschreibung eines Spektrums von Haltungen, bei denen die wissenschaftliche Perspektive selbst als eine zu verantwortende Haltung verstanden werden kann, die einzunehmen in bestimmten Situationen sinnvoll erscheinen kann.
Fazit
Das Recht auf Nichtwissen, bezogen auf Gendiagnostik, ist ein zentrales Thema der Medizinethik der letzten Jahrzehnte. Die ethische Diskussion verläuft dabei parallel zum juristischen Diskurs und wird durch rechtliche Regelungen beeinflusst. In Deutschland ist hier insbesondere das Gendiagnostikgesetz zu nennen. Das Recht auf Nichtwissen wird dabei verstanden als Teil eines umfassenderen Rechts zur informationellen Selbstbestimmung. Damit ist die Analogie zum Recht auf Selbstbestimmung generell, so wie es im Bereich der Medizin verstanden wird, gesetzt: So wie jeder das Recht hat, medizinische Eingriffe in den eigenen Körper abzulehnen, egal wie sinnvoll oder notwendig sie aus medizinischer Sicht erscheinen mögen, so hat auch jeder das Recht, genetische Diagnostik abzulehnen, auch dann, wenn es für die Krankheit, auf die getestet werden soll, präventive Maßnahmen gibt.
Mit dem Recht auf Nichtwissen wird letztlich die Möglichkeit für jeden einzelnen geschützt, sein Leben nach eigenen Maßstäben zu leben. Gesundheit hat für viele von uns einen hohen Wert. Es muss aber nicht der einzige und nicht der höchste Wert für ein gutes Leben sein. Der Sinn eines genetischen Tests besteht zwar nicht ausschließlich, aber doch vor allem darin, zur Bewahrung der Gesundheit beizutragen. Manchmal kann ein Test diese Aufgabe schon allein deshalb nicht erfüllen, weil die Krankheit schicksalhaften Charakter hat und nicht abzuwenden ist, wie bei der Huntington-Krankheit. Manchmal, wenn ein Test eine erhöhte Eintrittswahrscheinlichkeit für eine Krankheit angibt, stellt sich die Frage, ob und ab welcher Wahrscheinlichkeitsschwelle man bereit ist, sein Leben präventiv umzustellen. Und im Fall der genetischen Pränataldiagnostik kann der Gewinn eines Tests auf zum Beispiel Trisomie 21 für Eltern darin bestehen, sich auf das Leben mit einem behinderten Kind vorzubereiten. Gleichzeitig eröffnet der Test als weitere Maßnahme auch die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs. Wer diese Option für sich ausschließt, für den hat der Test nur begrenzten Wert. Das Recht auf Nichtwissen bewahrt so in allen diesen Fällen Freiheitsräume dort, wo Gesundheit nicht alleiniges oder oberstes Ziel der Lebensgestaltung sein soll.
Franziska Krause ist Referentin am Zentrum für Seltene Erkrankungen des Universitätsklinikums Heidelberg. Zuvor arbeitete sie am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin Freiburg und forschte zu den Themen Care-Ethik und Reproduktionsmedizin.
Joachim Boldt ist stellvertretender Direktor am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universität Freiburg. Aktuelle Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich Ethik der Biowissenschaften und der Digitalisierung in der Medizin.
Literatur
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.) (2006): Schwangerschaftserleben und Pränataldiagnostik. Repräsentative Befragung Schwangerer zum Thema Pränataldiagnostik. Fachheftreihe Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und Familienplanung. Köln, https://publikationen.sexualaufklaerung.de/fileadmin/redakteur/publikationen/dokumente/13319200.pdf, aufgerufen 3.01.2020.
Boldt, J. (2016). Genetik, Epigenetik und Formen des Handelns. Zur ethischen Ambivalenz epigenetischen Wissens. In: Reinhard Heil, Stefanie B Seitz, Harald König, Jürgen Robienski (Hg.). Epigenetik. Ethische, rechtliche und soziale Aspekte. Springer VS, S. 75–88.
Jaspers, K. (1973). Philosophie II. Existenzerhellung. Berlin: Springer.
Kaiser, M.: Kaiserinnenreich. Wieviel Wissen tut uns gut?, http://kaiserinnenreich.de/2019/02/03/wie-viel-wissen-tut-uns-gut/#more-5206, aufgerufen 16.12.2019.
Schulz, S. (2017): Das Kind hat so viele Fehler. Die Geschichte einer Entscheidung aus Liebe, Hamburg: Rowohlt.


