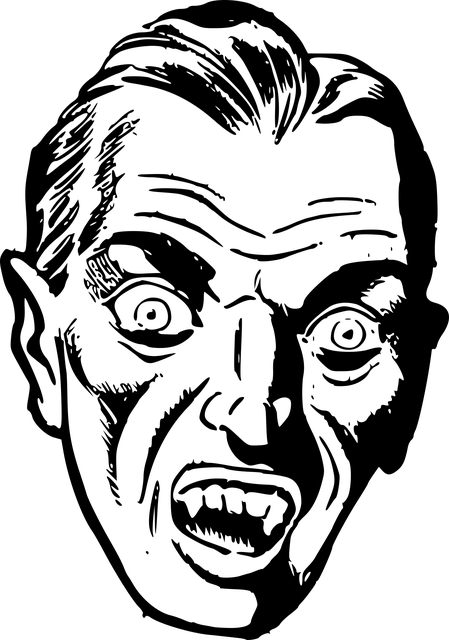Philosophie und Computerspiele
Von Sebastian Ostritsch (Stuttgart)
Computerspiele haben sich von einem nerdigen Nischenhobby zu einem Massenphänomen der Populärkultur entwickelt. Aber auch das Nerdsein gehört inzwischen zum Mainstream und es wäre eine interessante soziologische Frage, ob der Nerd die Games oder die Games den Nerd populär gemacht haben. Der Nerdigkeit des Mediums entsprechend scheuen Computerspiele auch vor philosophischen Themen nicht zurück. Neben moralischen Dilemmata (etwa in The Walking Dead, 2012-2019) wird in Games auffallend häufig der Zusammenhang von Determinismus und Freiheit ausgelotet, so etwa im genialen The Stanley Parable (2011) oder auch im Rätselspiel The Talos Principle (2014), in dem auch noch die Möglichkeit und der Wert Künstlicher Intelligenz thematisiert werden. In umgekehrter Richtung hat sich in den letzten Jahren auch die Philosophie der Computerspiele angenommen. Diese haben sich dabei in gleich mehrfacher Hinsicht als bedenkenswert erwiesen.
Zunächst ist da die urphilosophische Frage nach dem Wesen einer Sache. Ludwig Wittgenstein war in seinen Philosophischen Untersuchungen (1953) der Ansicht, dass den vielfältigen Phänomenen, die wir jeweils als „Spiel“ bezeichnen, kein gemeinsames Wesen zugrunde liegt, weshalb auch der Begriff des Spiels keine einheitliche Bedeutung habe. Stattdessen ließe sich nur eine Familienähnlichkeit zwischen den verschiedenen, „Spiel“ genannten Tätigkeiten feststellen. Dagegen verteidigte der Philosoph Berrnard Suits in seinem viel zu wenig rezipierten Buch The Grasshopper: Games, Life, and Utopia (1978) die gegenteilige These. Der Begriff des Spiels lässt sich Suits zufolge sehr wohl definieren; „ein Spiel zu spielen“, sei seinem Wesen nach schlicht „der freiwillige Versuch, unnötige Hindernisse zu überwinden“.
Computerspiele sind zum einen ein neuer Probierstein für die Thesen von Wittgenstein und Suits. Zum anderen stellt sich bei Games aber selbst die Frage nach dem Wesen. Was – wenn überhaupt etwas – haben Computerschach, Tetris, Sportsimulationen wie FIFA, Strategie- und Aufbauspiele wie Die Siedler, Shooter wie Wolfenstein und Story-Open-World-Games wie Grand Theft Auto gemeinsam? Welche Rolle spielen dabei kontingente technologische Faktoren wie Hardware, Software und bestimmte Ausgabegeräte? Zumindest der Bildschirm scheint so wichtig zu sein, dass sich „Videospiel“ als nahezu gleichbedeutender Ausdruck zu „Computerspiel“ etabliert hat.
Ohne hier näher auf die Gründe dafür eingehen zu können, halte ich selbst die folgende Ansicht für richtig: Das Spiel ist, wie der Kulturtheoretiker Johan Huizinga in seinem Klassiker Homo Ludens (1938) schrieb, eine „unbedingt primäre Lebenskategorie“, und wie alle unsere Kategorien ist es derart grundlegend, dass wir es nicht ohne Zirkel definieren können. Das aber heißt nicht, dass wir es nicht erhellend explizieren könnten! Vieles spricht für folgende Wesenserläuterung: Das Spiel ist eine überflüssige Tätigkeit, die ihren Sinn (Zweck) primär in sich selbst hat, und die im Kontrast zu einer nicht-spielerischen Normalität steht. Computerspiele wiederum sind eine historisch gewachsene, in sich diverse Klasse von Spielen, die auf bestimmten Computertechnologien beruhen. Von Computerspielen lässt sich daher nur ein empirischer, aber kein apriorischer Begriff bilden. Damit ist aber nicht gesagt, dass die Beschäftigung mit Computerspielen über die Wesen- bzw. Definitionsfrage hinaus philosophisch uninteressant wäre. Vielmehr ist es sowohl in ästhetischer als auch in kunsttheoretischer sowie in ethischer Hinsicht höchst lohnend, sich mit Computerspielen auseinanderzusetzen.
Wie Daniel Martin Feige in seinem Buch Computerspiele. Eine Ästhetik (2015) gezeigt hat, lassen sich Computerspiele als ästhetische Gegenstände beschreiben, ohne unterstellen zu müssen, dass alle Computerspiele deswegen auch schon Kunst sind. Wie auch bei Film und Literatur gilt: Manches ist Kunst, manches bloße Unterhaltung, und die Grenzen sind nicht immer klar zu ziehen. Das Besondere an der Ästhetik von Computerspielen ist einerseits ihre Multimedialität – die Tatsache, dass sie in der Regel über visuelle, akustische und zunehmend auch haptische Zeichen (z. B. feinstufiges Vibrationsverhalten des Controllers) verfügen – sowie ihre besondere Interaktivität andererseits. Zwar lässt sich etwa im Anschluss an die Fiktionalitätstheorie von Kendall Walton (Mimesis as Make-Believe, 1990) dafür argumentieren, dass alle Werke, die Repräsentationen beinhalten, in einem gewissen Sinne interaktiv sind, weil sie stets eine imaginative Aktivität auf Seiten des Rezipienten voraussetzen. Aber die Interaktivität von Computerspielen ist von besonderer Art, insofern der Spieler nämlich in einer Spielwelt handelt, oder auf einer anderen, abstrakteren Eben formuliert: Der Spieler bestimmt über seinen Input selbst mit, welchen Zeichenoutput er zu sehen, hören und zu fühlen bekommt. Philosophisch interessant – und erhellend in Samuel Ulbrichts Ethik des Computerspielens (2020) behandelt – ist dabei insbesondere der ontologische Status von Computerspielhandlungen. Diese sind einerseits in der außerspielerischen Realität beheimatet (auf der Couch sitzen, Knöpfe drücken), können andererseits aber zugleich eine fiktive Dimension annehmen (als Super Mario die Herrscherin des Pilzkönigreichs, Prinzessin Peach, retten, oder als Doom-Marine Dämonen auf dem Mars niedermetzeln).
Einem Gedanken Feiges folgend sind Computerspiele insbesondere dann von künstlerischem Wert, wenn sie das, was sie auf der inhaltlichen Ebene darstellen, zugleich auf eine genuin spielerische Art und Weise zum Ausdruck bringen, wenn also das Was und das Wie eines Games organisch miteinander verbunden sind. Ein besonders gelungenes Beispiel dafür ist etwa Brothers: A Tale of Two Sons (2013). Ohne zu viel verraten zu wollen, erfährt der Spieler in Brothers auf der Ebene des Gameplays, das heißt auf spielerische Weise, wie es ist, ein geradezu symbiotisches Verhältnis zu einem anderen Menschen zu haben und diesen Menschen dann zu verlieren.
Im Umstand, dass Computerspiele im Medium spielerischen Handelns vorführen können, wie es ist, etwas zu tun oder jemand zu sein, liegt auch ein besonderes ethisches Potential. Wie beispielsweise Martha Nussbaum in Love’s Knowledge (1990) gezeigt hat, kann Literatur ethisches Wissen vermitteln, weil wir bei der Lektüre vieler Texte unsere ethischen Sensibilitäten und unsere praktische Vernunft mobilisieren müssen, um überhaupt die Geschichte und die Charaktere zu verstehen. Dasselbe gilt natürlich auch für Computerspiele, die von ethisch relevanten Themen handeln. Bei Games kommt aber noch hinzu, dass sie uns im Modus des spielerischen Tuns erfahren lassen, wie es ist, mitfühlend und heroisch, aber auch verbrecherisch und abgründig böse zu handeln.
Gerade letztgenannte Möglichkeit sorgt in den Teilen der Öffentlichkeit, die keine Affinität zu Games haben, immer wieder für die Skandalisierung des Mediums. Während sowohl der gesunde Menschenverstand als auch die empirische Forschung der platten Killerspiele-These, Computerspiele seien kausal für reale Gewaltverbrechen verantwortlich, widerspricht, stellt sich philosophisch sehr wohl die Frage, ob Computerspiele und Spieler grundsätzlich gegen moralische Kritik gefeit sind. Ein spielbezogener Amoralismus – das heißt die These, dass das Computerspielen jenseits moralischer Bewertungen steht – erweist sich bei genauerem Nachdenken als unhaltbar. Computerspiele können nämlich ebenso wie Filme und Literatur moralisch relevante Einstellungen über die Wirklichkeit zum Ausdruck bringen und diese Einstellungen dem Spieler dabei zugleich zur Übernahme nahelegen. Umgekehrt können auch Gamer an sich tadellose Computerspiele nutzen – oder besser gesagt: missbrauchen –, um unmoralische Gefühle und Haltungen zu nähren. Gerade weil Computerspiele ein ästhetisch wie künstlerisch ernst zu nehmendes Kulturgut sind, können sie auch zu Recht Gegenstand ethischer Kritik sein.
Diese kurze Tour de Force durch die noch junge Philosophie der Computerspiele konnte nur einige der zentralen Themen benennen und sie in ihrem Problemcharakter umreißen. Gezeigt hat sich dabei aber hoffentlich, dass Computerspiele – sofern man sie denn nicht von vornherein als belangloses, kindisches Spielzeug abtut – ein philosophisch höchst anregendes und ebenso reflexionswürdiges wie reflexionsbedürftiges Phänomen darstellen.
Sebastian Ostritsch ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Stuttgart.