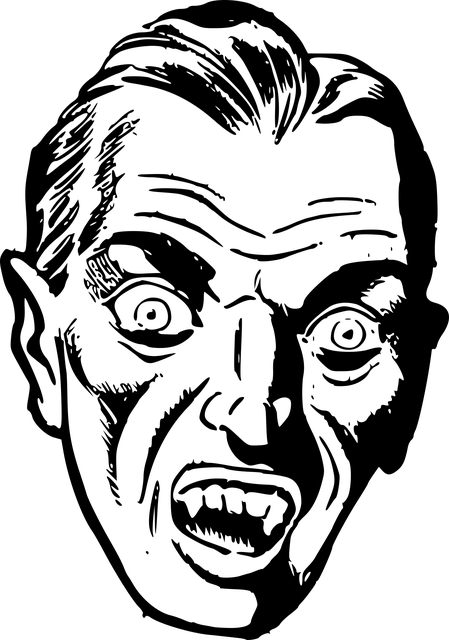Ein bisschen Frieden? – Eine uneigentliche Philosophie des Schlagers
von Florian Arnold (HfG Offenbach)
Als Nicole beim Eurovision Song Contest 1982 einer der erfolgreichsten deutschen Schlager performte, wusste sie nicht, was sie damit anrichten sollte. Nicht nur gewann die erst 17-jährige den ersten Preis und erlebte einen kometenhaften Aufstieg in die obersten Klangsphären des Schlagerkosmos, sondern sie verlieh der buchstäblichen „Eurovision“ zugleich eine Deutung, die heute, nach 40 Jahren, leider wieder an Aktualität gewonnen hat, denkt man etwa an den Ukraine-Russland-Krieg oder Fridays for Future. In einem Jahr des Falkland- und ersten Libanonkriegs, des Regierungswechsels Schmidt-Kohl per Misstrauensvotum und des NATO-Gipfels in Bonn machte sich die noch junge Friedensbewegung seinerzeit Luft gegen die Angst vor weiterer Aufrüstung und einer sich abzeichnenden ökologischen Krise. Und als weithin sichtbarer Ausdruck dieses Umdenkens muss man auch Nicoles Beitrag werten.
Im Rückblick interessant jedoch scheint weniger diese Tatsache selbst, als die Art und Weise, der Ton, durch den sie sich Gehör verschaffte. So lautet die zweite Strophe:
„Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel.
Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt.
Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind,
der spürt, dass der Sturm beginnt.“
Dieser Ergebenheitston zwischen Aufgabe und Hingabe, die daraus sprechende Bescheidenheit und Aufrichtigkeit, seien sie auch nur gut gemimt, haben auch heute noch etwas Entwaffnendes und zugleich Furchteinflößendes. Dabei zeugte der Auftritt durchaus von einer anderen Schüchternheit als die aus sich herausträllernde einer Lena Meyer-Landrut und ihrem umhertänzelnden Satellite knapp 20 Jahre später; vielmehr saß Nicole (Hohloch mit bürgerlichem Namen) im schwarzen, steinbesetzen Spitzenkragenkleid in sich gefasst, nahezu unbeweglich auf einem Barhocker, während sie ihre Playbackgitarre auf dem Schoß mit abwesenden Händen streifte und lediglich ihren von einer wallenden Föhnfrisur gehaltenen Kopf nach der Kamera ausrichtete. Man hat Vermutungen darüber angestellt, wie dieses musikalische Bettelstück um ein bisschen Frieden und Sonne, Freude und Träumen eine solche Durchschlagskraft hatte entfalten können und fand doch immer nur den ersten Eindruck bestätigt, der auch heute keine Zweifel zurücklässt (wie unzählige Kommentare der letzten Wochen auf YouTube belegen), wenn es diffus um die Gesamtsituation der Welt und ihre Gemütslage geht:
„Dann seh’ ich die Wolken, die über uns sind,
und höre die Schreie der Vögel im Wind.
Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied
und hoffe, dass nichts geschieht.“
Aus dieser Vision spricht eine gekonnte Mischung aus Katastrophismus und Romantik, fatalistischer Naturverbundenheit, verschreckter Naivität und einem zärtlichen Nihilismus.[1] Hier weht einen unvermutet etwas an von der german angst aus dem Märchenwald, es packt einen die heimelige Angstlust. – Aber vielleicht nähme man die Fiktionalität dieses ‚Kunstprodukts‘ damit noch allzu ernst und unterschätze gerade den Identifikationswillen der Betroffenen und die Identifikationskraft dieser künstlerisch eher bescheidenen Worte. Stattdessen könnte man auch von einer Heimsuchung der ‚Heimat‘ sprechen, jenes Ur-Topos des Schlagerdiskurses,[2] und zwar durch die düstere Ahnung ihrer vollständigen Vernichtung. Es ist schon keine Geborgenheit mehr, nur noch ein Sich-Bergen vor einer abermals heraufziehenden Nacht, von der niemand weiß, ob sie die letzte sein könnte; einer Nacht also, in der auch Kunst und Wirklichkeit keinen Unterschied mehr machen und in dasselbe Nichts umschlagen.
I. Schlagerphilosophie?
Soll es hier nicht bei bloßen Andeutungen bleiben, stellt sich spätestens an dieser Stelle die Frage, was dieses Schlagerphänomen oder überhaupt der Schlager als Phänomen mit Philosophie zu tun haben könnte. Gibt es eine Philosophie des Schlagers? Die erste Antwort wäre wohl ein Nein. Es sei denn, man versteht unter einer ‚Philosophie des Schlagers‘ in etwa das, was auch Unternehmen unter ihrer eigenen „Philosophie“ verstehen: eine letztlich unverbindliche Selbstverpflichtung auf die gerade gängigen Buzzwords, irgendetwas zwischen deklamiertem Glaubensbekenntnis und reklamierbarer Willenserklärung, letztlich ein ‚Markenethos‘, das weniger die Ethik eines Unternehmens definiert als ein bestimmtes Ethos für Eigenwerbung vereinnahmt und es als Markenbestandteil etabliert. Versteht man Philosophie auf diese Weise, dann kann man wohl tatsächlich von einer ‚Philosophie des Schlagers‘ sprechen. Aber wäre das nicht gerade ein Missverständnis, wenn nicht noch schlimmer gar eine naive oder zynische Pervertierung jeder eigentlichen Philosophie?
Diese Fragen wird uns im Folgenden beschäftigen, wenn wir dem nachgehen, was es mit einer uneigentlichen Philosophie auf sich haben könnte und zwar nicht im Sinne der klassischen Konkurrenzunternehmen von Sophistik und Rhetorik, sondern als glücklich-verunglückende Lebensform oder, im Andenken an Heideggers Begriffsprägung: als entschlossene Verfallenheit an die temperierten Schicksalsschläge von jedermann. Der Schlager – dergestalt als Softcover des Schicksals aufgefasst – wird uns hierfür den Leitfaden an die Hand geben, den wir bei Nicole bereits angeknüpft haben und der uns im Herzen der labyrinthischen Schlagerindustrie von gestern und heute noch auf Heintje führen wird. Dabei soll der Intuition gefolgt werden, dass es nicht allein die Pop-Kultur, sondern insbesondere der Schlager ist, der mit einer schamlosen Direktheit, ja gemeinmachenden Dreistigkeit das Äußerlichste und Intimste, das Wichtigste und Belangloseste, das Wahrhaftigste und Falscheste zum Dialog nötigt. Das macht seine eigentliche Uneigentlichkeit aus, seine post-ironische Authentizität. Dieser nicht einmal mehr zynischen Vereinnahmung durch normierte Gemeinsamkeiten kann sich zuletzt auch der Dauerverdacht nicht entziehen, es hierbei eigentlich mit dem Inbegriff kapitalistischer Ausbeutung und Abrichtung im trügerischen Zeichen allgemeiner Verständigung, gar Völkerverständigung zu tun zu haben. Diese Kritiken, gerade wo sie berechtigt scheinen, haben ihrerseits schon Schlagerqualität erlangt.
Zunächst aber sorgen wir noch für eine bessere Orientierung, indem wir kurz die Entstehungsgeschichte des Schlagers rekapitulieren, die an ihn gerichtete Hauptanklage in Erinnerung rufen und uns um eine weitere Klärung seines Verhältnisses zur Pop-Musik und Popkultur bemühen. Wie wir sehen werden, kommt dabei dem deutschen Schlager eine besondere Funktion zu, die man im Unterschied zur anglo-amerikanischen popular culture und ihren Ablegern auch als die eines Soundtrack des nachkriegsdeutschen Wohlfahrtstaates bezeichnen könnte.
II. Erfolgsgeschichte Schlager
„Als Erfolgsbegriff steht die Bezeichnung Schlager in ihrer musikbezogenen Bedeutung in unmittelbarem Zusammenhang mit der im 19. Jh. rasch voranschreitenden Kommerzialisierung des Musikbetriebs. […] Allerdings waren die Bezeichnungen zwischen der wirtschaftlich-merkantilen und der musikalisch-kulturellen Seite dieses Prozesses noch lange Zeit zunächst rein äußerlicher Natur. Ob Tanzmelodien wie Walzer, Polka [etc…], aber auch Opernarien und Sätze aus sinfonischen Werken […] – Erfolg konnte prinzipiell alles haben und entsprechend unspezifisch findet der Begriff bis Ende des 19. Jhs. auch Verwendung.“[3]
Dieser Schlagerbegriff, den man kurzerhand als ‚durchschlagenden Erfolg‘ x-beliebiger Musikstücke oder Melodien erläutern könnte, wandelt sich zu dem eines Genres erst gegen Ende 19. Jahrhunderts und zwar dergestalt, dass der Erfolg – gleichsam die Folge dieses Durchschlagprinzips – sich zusehends in Abklatschen abzeichnet, als Klischees im Wortsinn, die zunächst ungewollte, bald professionell hergestellt werden:
„Erst als die Komponisten dazu übergingen, ihre Kompositionen an den einmal zu Erfolg gekommenen Stücken zu orientieren, und ihre Verleger begannen, ihre Produkte gleich von vorneherein mit dem Erfolgsprädikat ‚Schlager‘ zu versehen, um damit als Kaufanreiz für die Notendrucke jene Popularität zu suggerieren, die diese Lieder ja eigentlich erst einzulösen hatten, verwandelte sich der kommerzielle Begriff in eine musikalische Gattungsbezeichnung. Um die Jahrhundertwende beginnt sich der Begriffsgebrauch auf jene Form des populären Liedes zu verengen, die sich im Zusammenhang mit der nun auch kulturell, musikalisch und ästhetisch durchgesetzten Erfolgsorientierung herausgebildet hat. Das allerdings ist eine auf den deutschen Sprachraum begrenzte Besonderheit.“[4]
Dass diese Ausdifferenzierung zu einem eigenen Genre vor allem im deutschsprachigen Raum stattgefunden hat, dürfte nicht unwesentlich mit der bildungsbürgerlichen Musikkultur der damaligen Zeit zu tun haben. Während der Fortgang der Wiener Klassik bis zur Neuen Musik dem Schema eines Komplexitätsanstiegs folgt, verlocken zunächst die Operettennummern und später der Jazz zu entspannteren Abzweigungen im Sinne eingängigerer Kompositionen, die als solche und zwar in Abgrenzung zu der nicht weniger populären Musikkultur der ‚Klassikverehrer‘ auch wahrgenommen und bezeichnet werden. Diese Ablösung passiert spätestens mit den heute ihrerseits ‚klassischen Schlagern‘ der Weimarer Zwischenkriegsjahre. Und damit scheint dann auch in Deutschland jene Bahn beschritten, die abseits von Volksliedgut, Kammermusik und Konzerthallen, stattdessen über die diversen Bühnen von Nachtclubs, Varietés, Tanzlokalitäten und auf den Wellen des jungen Rundfunks reitend geradewegs in die vier Wände von Jedermann führte. Die erste Pop-Musik war so gesehen der Schlager als doppeldeutiges ‚Erfolgsgenre‘, als professionelle U-Musik. Der Schlager, insbesondere der deutsche, als kombinier- und kompositionsfreudige Musikerscheinung der 1920er Jahre, erfüllte die Vorreiterrolle der internationalen Pop-Industrie der Nachkriegsjahre. Und dementsprechend ließ auch die Kritik von Seiten der selbsternannten E-Musikfreude nicht lange auf sich warten.
III. Adornos Kritikschlager
Die im Kern auch heute noch maßgebliche, ja ihrerseits klassisch zu nennende Kritik des Schlagers hat Theodor W. Adorno formuliert. Über sein Œuvre verstreut, doch am prägnantesten in seiner Vorlesung Einleitung in die Musiksoziologie setzt Adorno gleichsam einen neuen Standard, auf den sich ihrerseits die üblichen Verdammungsurteile seiner zahlreichen Nachfolger berufen. Dies geschieht jedoch nicht selten selbst in der Weise eines Klischees, eines Schlagers, den jeder von ferne schon im Ohr zu haben meint, sobald der kritische Ton in der Sache anhebt. Im Rückgriff auf die musikalischen Anfänge in der Operette heißt es bei Adorno etwa:
„Die orgiastische Erinnerungsspur auf dem Grunde der Offenbachischen Can-Cans oder selbst der Verbrüderungsszene der Fledermaus ist nicht mehr zu fürchten. Der verwaltete und veranstaltete Rausch hört auf, einer zu sein. Was immerzu als exzeptionell sich anpreist, stumpft ab: die Feste, zu welchen die leichte Musik ihre Anhänger unter dem Namen des Ohrenschmauses permanent einlädt, sind der triste Alltag. In den fortgeschrittenen Industrieländern wird sie definiert von Standardisierung: ihr Prototyp ist der Schlager. Ein populäres amerikanisches Lehrbuch, wie man Schlager schreiben und verkaufen könne, hat das bereits vor zwanzig Jahren mit entwaffnender Werbekraft gebeichtet. Der Hauptunterschied zwischen einem Schlager und einem ernsten oder, in der schönen Paradoxie der Sprache jener Autoren, einem Standardlied sei, daß Melodie und Gedicht eines Schlagers innerhalb eines unerbittlich strikten Schemas sich zu halten hätten, während ernste Lieder dem Komponisten freie, autonome Gestaltung gestatten.“[5]
Was hier als Schlager noch eher unter den Erfolgsbegriff fällt denn den eines eigenen Genres, weist jedoch schon deutlich voraus auf die Absetzung des industriellen Fabrikats vom autonomen Kunstlied. „Schema“ und „Standarisierung“ bilden dabei die Stichworte für die Machenschaften einer Kulturindustrie, deren Tendenzen zur Normierung und Gleichschaltung das Bewusstsein der zu Konsumenten erniedrigten Hörer in Beschlag nehmen sollen. Das Exzeptionelle, das Epochemachende einer einschneidenden, bisweilen traumatischen Erfahrung im Sinne avantgardistischer Ästhetiken, wie es Walter Benjamin Jahrzehnte zuvor schon exemplarisch an Baudelaires Schock-Lyrik herausgearbeitet hatte, wird demnach im Zuge der Hochindustrialisierung Teil einer seriellen Massenproduktion für ein Massenpublikum und stumpft ab. Nicht mehr der Schnitt, der die Hörer von ihren Vorurteilen löst, sondern der dumpfe, kalkulierte Schlag trifft und prägt eine Erwartungshaltung, die nunmehr umgekehrt an einer regelkonformen Konditionierung mitarbeitet, ohne der eigentlichen Verarbeitung der Widerfahrnisse noch Zeit und Raum zu lassen.
Rückblickend mag man diese Kritik selbst zu den gern variierten Standards der Kapitalismuskritik zählen, aufhorchen lässt im vorliegenden Kontext jedoch die deutliche Markierung gerade des Schlagers als des „Prototyps“ einer allzu „leichten Musik“. Mustergültig im Sinne der erlenbaren Mache oder Masche scheint dabei nicht allein die „Werbekraft“ schon der Anleitung, sondern im gleichen Maße die des Schlagers selbst. Er macht gewissermaßen Werbung für das Werbeformat als solches.[6] Er ist der Standardfall einer allgemeinen Standardisierung, das Schematisierungsschema absorbierter Individualität in der Absicht, auch noch den letzten zaghaften Vorschein eines Nicht-Identischen in den Kunstwerken letztlich künstlich zu reproduzieren. In diesem Sinne deutet die Rede einer „Paradoxie“ an dieser Stelle bereits an, was Adorno, die Spannung zwischen Regel und Ausnahme ins Extrem steigernd, an späterer Stelle als inhärenten „Widerspruch“ des Schlagers beschreiben wird:
„Auf der einen Seite muß sie [die leichte Musik; Anm. FA] die Aufmerksamkeit des Hörers aufstacheln, von anderen Schlagern sich unterscheiden, wenn sie sich verkaufen lassen, den Hörer überhaupt erreichen will. Andererseits darf sie über das Gewohnte nicht hinausgehen, wenn sie ihn nicht zurückstoßen will […]. Die Schwierigkeit, vor welcher der Hersteller leichter Musik steht, ist die, jenen Widerspruch auszugleichen, etwas zu schreiben, was einprägsam ist und allbekannt-banal zugleich.“[7]
Was Adorno anhand des Schlagers noch als singuläres Problem reformuliert, findet sich bei einem der erfolgreichsten Designer des 20. Jahrhunderts, dem Großmeister des streamlining, Raymond Loewy, durch sein berühmtes MAYA-Prinzip schon als massenkompatible Lösung präsentiert: „Most Advanced Yet Acceptable“. Seine umfassenden Entwürfe seit den 1920er Jahren für diverse Zuglinien, Alltagswaren, aber auch die Air Force One und NASA standen schon früh in der Kritik, bloßes Styling aus Vermarktungszwecken zu sein. Zunächst nichts Neues also. Die tatsächliche und auch heute noch zukunftsweisende ‚Lösung‘ jedoch, die Adorno selbst ein paar Sätze weiter im Schlagerformat zu erkennen meint, reicht dagegen bis in die post-industrielle Epoche der Vergesellschaftung und lautet: „Pseudo-Individualisierung“. Zum Ausgleich des benannten Widerspruchs hilft demnach,
„das altmodisch individualistische Moment, das im Produktionsverfahren, willentlich oder unwillentlich, geschont wird. Es entspricht ebenso dem Bedürfnis nach dem jäh Auffallenden wie dem, die allherrschende Standardisierung, das Konfektionierte von Form und Gefühl, dem Hörer zu verbergen, der unablässig sich behandelt fühlen soll, als gelte das Massenprodukt ihm persönlich.“[8]
Erst ab dem geschichtlichen Augenblick, in dem der aerodynamisch-glatte Fortschrittsdrang sich anschickte, in abstrakte Sphären zu entgleiten, meldete sich zugleich der Ballast altbürgerlicher Individualisierungswünsche und bremste den Take off aus. Mag ein solches Pseudo-Individuum auch fortan keinen Fuß mehr auf heimatlichen Boden setzen können, so scheint doch die bloße Sehnsucht schon Erdung genug, um den Höhenflügen der NASA oder der Neuen Musik innerlich zu entsagen und sich stattdessen in einem beschränkteren Horizont einzurichten, der sich am Mittelmaß schlechthin ausrichtet: dem Alltagsmenschlichen. Von Adorno noch als bloße Konservierung von Vergangenem verstanden, lässt sich hieran vielmehr das rekursive Entwicklungsmodell, insbesondere digitalisierter Lebensläufe innerhalb einer ‚Gesellschaft der Singularitäten‘ studieren. Es legt sich nahe, Adornos „Pseudo-Individualisierung“ mit dem heutigen Customizing diverser Lifestyles zu übersetzen und damit zugleich überzusetzen in die zeitgenössische Welt der Popkultur. Ihr Dauer-Hit heißt Selbstdesign.
IV. Meta-Popup-Shop
Wenden wir uns nun dem ‚Adorno der Popkultur‘, Diedrich Diederichsen, zu, dann zunächst in der Absicht, uns auf einen ‚Narzissmus der kleinen Differenzen‘ einzulassen, aus dem heraus sich eine entscheidende Unterscheidung zwischen einer ‚eigentlichen‘ (= Pop-Musik) und einer ‚uneigentlichen‘ (= Schlager, Volksmusik) Populärkultur aufdrängt:
„Das, was alle angeht, nimmt kulturell die Gestalt des Populären an. […] Pop-Musik ist die Aufkündigung einer solchen Gemeinschaft aller mit den Mitteln, mit denen sich Gemeinschaften sonst symbolisch herstellen: Klänge, Abzeichen, Auftrittsformen, Verhaltensregeln. Im Gegensatz zu einer Elite und ihrer sich abgrenzenden Hochkultur, trennt sich die Pop-Musik von der populären Kultur auf deren Terrain und mit deren Mitteln. […] Pop-Musik führt die Möglichkeit der Nonkonformität in eine Kultur ein, deren Grundlage und deren Darstellungsmittel auf Konformität und Zustimmung angelegt sind.“[9]
Indem Diederichsen „Pop-Musik“ (umfassender verstanden als community building) dergestalt von Hochkultur einerseits und Populärkultur anderseits absetzt, artikuliert er eine Art Intensivierung der Populärkultur, quasi deren immanenten Eigentlichkeitsmodus (versus den immanenten Uneigentlichkeitsmodus); wohingegen die Hochkultur gewissermaßen als ein transzendentes Außen aufgefasst wird. Das erinnert nicht nur an einen systemtheoretischen Re-Entry der Umwelt/System-Differenz alla Luhmann, sondern ist als solcher auch gemeint:
„Historisch trennt Pop-Musik als ein Einspruch diejenigen, die ihn hören und ernst nehmen wollen, von denen, die das nicht wollen. Sie agiert ja mitten im Einzugsgebiet des großen Konsensus der westlichen Nachkriegsgesellschaften und des fordistischen Kompromisses zwischen den Klassen. Sie wird zum Re-Entry der großen Klassendifferenz und der Unterscheidung populär/elitär in einem größer gewordenen Feld des Populären.“[10]
Kommen wir vor diesem Hintergrund, in den sich die Unterscheidung einzeichnet, nochmals genauer auf „die Möglichkeit der Nonkonformität“ zu sprechen, die durch die Pop-Musik in das Destinktionsfeld des Populären eingetragen werden soll, müsste man der inhärenten Systemlogik folgend daran vor allem die Möglichkeit zur (diskriminierenden) Negation wiedererkennen: Nach Luhmann, dem Anti-Adorno der westlichen Nachkriegsgesellschaft, ist sie nämlich schlicht immer und überall möglich innerhalb eines Systems. Streng genommen – und das ist schon die ganze, ebenso affirmative wie kritische Pointe[11] – beschreibt diese Möglichkeit zur Negation damit jedoch gerade nichts anderes als das Verfahren einer systemimmanenten Ausdifferenzierung. Wirklich kritisch im Sinne einer radikalen Systemveränderung ist daran freilich gar nichts, im Gegenteil. Radikal kritisiert wird dadurch allein das Konzept einer radikalen Ideologiekritik als solcher: Ideologie – unter diesen Prämissen – ist ihre Kritik, der Glaube an einen undurchdringlichen Verblendungszusammenhang die eigentliche Verblendung oder – heute wieder populär – die halböffentlich kolportierte Verschwörungstheorie schon die Verschwörung selbst.
Dass es sich dabei jedoch nicht allein um den unendlich variierbaren Klassiker einer narzisstischen Projektion (bei gleichzeitiger Identifikation mit den eigenen Vorbildern oder Ich-Idealen, den Stars)[12] handelt, sondern um das eigentliche Wunschdenken der „Pop-Musik“, exklusiv integrierend zu sein und doch irgendwie etwas ganz anderes als jedes Modephänomen seit Menschengedenken gemäß seiner Logik von In und Out, – das macht die im Grunde nicht weniger ironische als zynische Kritikpose der Pop-Musik aus. Entsprechend gerät auch das Sampling von Adorno-Motiven geradewegs zum Schlager, wenn es etwa heißt:
„Was die Standardisierung als schlechte instrumentelle Abstraktion von populärer Musik wäre, wäre die heute mögliche digitale Verfügung über fertige Aufnahmen, eingespielte Tonfolgen und Klangfarben aller Art als totale Abstraktion vom konkreten Klangereignis und seiner Rückkehr auf einer anderen Ebene (die natürlich auch eine noch grässlichere Instrumentalisierung und Erniedrigung des Musikalischen darstellen könnte).“[13]
Was hier lieber eingeklammert wird, ist lediglich die andere Seite einer konstitutiven Ambivalenz der Pop-Musik (im Sinne Diederichsen) als nimmermüde Avantgarde der Popkultur. Diese Ambivalenz stellt sich immer erst nachträglich als solche heraus, wenn wieder einmal Veraltetes durch Neueres hervorgebracht wird; dann also, wenn dieses andauernde Sich-Freikämpfen-Müssen als die eigentliche Erniedrigung, als die trostlose Instrumentalisierung im Dienst überholter Fortschrittsvorstellungen für einen Augenblick zu Tage tritt: Je weiter sich der Tross ausdehnt, desto weniger fällt auf, dass die Pop-Musik zumeist im Kreis läuft und die Vorhut eigentlich immer nur die eigene Nachhut überwältigt – um sich darauf verwundert im Hauptfeld wiederzufinden.
Die Wahrheit des Ganzen ist demnach auch keine ironische mehr – etwa als letzte Reminiszenz an eine romantische Subjektivität. Sieht man stattdessen der Tatsache ins Auge, dass auch dieser Rückgriff nur noch als Retropose derselben Inszenierung folgte, dann bleibt wohl kaum noch anderes übrig als mit Adornos „Pseudo-Individualisierung“ ernst zu machen. Diese Einsicht könnte nur die post-ironische sein, dass der Schlager (und zwar gerade nicht der postmodern-selbstironische eines Guildo Horn oder Dieter Thomas Kuhn) kritischer ist als die Pop-Musik. Als der Uneigentlichkeitsmodus der Populärkultur, als entschlossene Verfallenheit an Konformismus und Standardisierung müsste man ihm zumindest zugutehalten, dass er das Spiel nicht immer wieder neu eröffnet, sondern vielmehr zu einem Ende bringt, das jede falsche Hoffnung auf eine mehr als modische Selbstverwirklichung, ein nicht-narzisstisches Selbstdesign oder gar tatsächliche Selbstüberwindung im Keim erstickt und stattdessen die post-industrielle Lage in ihrer ernüchternden Unausweichlichkeit zu konfrontieren nötigt: Die Populärkultur seit ihren Anfängen hat gerade alles dafür getan und dabei als Fortschritt verbucht, dass das Leben einer Hitparade aus mediokren Coverversionen und verirrten Samplings gleicht, die jeder mitsingen kann. Auch Adornos Neue Musik lässt sich in diesen Breiten freilich entweder nur als patriarchal-elitär abtun oder als weitere Subkultur alter weißer Männer begrüßen und integrieren. Doch durchgehend bleibt das Frischhalte-Pathos eines Forever young dasselbe; man meint es schallen zu hören durch den digitalen Super-, Hyper-, Metamarché:
„Es war keine Rebellion gegen die Ware und die Leere ihrer Versprechen, sondern eine Rebellion, die mit der Ware kooperierte, nur mit den neuen Pop-Waren denkbar war, aber in der Nähe zu ihnen zugleich ein Gegenmodell entwickelte. Sie konnte erst an der verfügbaren, aber enttäuschenden Ware erfahren, was es heißt, mehr zu wollen. Das vielleicht zentrale RockʼnʼRoll-Gefühl. Nicht mehr von demselben, sondern mehr als das, was die Ware zu geben bereit war. Das, was da mal war, als noch eine Seele im Teddy war.“[14]
Was hätte ‚Teddy‘ Adorno wohl dazu gesagt? – Doch der letzte Satz lässt auch so vernehmbar werden, inwiefern den End- und Ausgangspunkt einer pleonektischen Pop-Musik nicht nur der Warenfetischismus bildet, sondern ihre Verfechter ihn zugleich mit einer Nostalgie, einem Heimweh, mit einem Kinderglaube an eine paradiesische Unschuld zu verbrämen wissen, die der Schlager in seiner dröhnenden Verinnerlichung (statt affirmativ-kritischen Intensivierung) direkter, besser, eigentlicher zu bedienen versteht. – Kommen wir endlich zu Heintje und seinen Mama-Erfolgen.
V. Ohh Mama!
„Tage der Jugend vergehen,
schnell wird der Jüngling ein Mann.
Träume der Jugend verwehen,
dann fängt das Leben erst an.
Mama, ich will keine Träne sehen,
wenn ich von dir dann muß gehen!“
Heintje landete mit Mama einen der größten Hits der Schlägergeschichte. Bei der ZDF-Sendung „Goldener Schuß“ am 21. Dezember 1967 setzte er sich zugleich selbst ein Denkmal, indem der auf eine Minute gestauchte Song dennoch zielsicher den Puls der Zeit traf und einen schieren Kaufrausch auslöste (200 000 abgesetzte Singles in der ersten Woche). Während um den Globus die Studentenproteste der sogenannten ‚68er‘ ein neues Zeitalter einläuten sollten, feierte dagegen ein 12-jähriger Holländer, nach einem kurzen Vorlauf in seinem Heimatland, seinen internationalen Durchspruch auf dem deutschen Musikmarkt mit einer ödipalen Schnulze, die ihn schlagartig zum Millionär, Rekordhalter in Verkaufszahlen und illustren Wunderkind machen sollte (mit dem etwa Elvis Presley nur darum keinen Duett aufgenommen hatte, weil es der Terminplan von Heintje nicht zuließ). Aber das sind eher Äußerlichkeiten, zu denen sich leicht weitere Anekdoten gesellen lassen, wie der tatsächliche Bau eines Schlosses bzw. einer Villa, das einer seiner Lieder bereits angekündigt hatte oder die freudigen Altenheimbesuche des „kleinen Seelentröster[s]“[15], der ‚doch mal sehen wolle, für wen er singe‘.
Schockierend im besten post-ironischen Sinne geben sich dagegen spätere Aussagen des schon durch den Stimmbruch gegangenen Tierfreundes und Ponyhofbesitzers wie die folgende: „Progressive Songs liegen mir nicht und Protestsongs singe ich nicht, weil man doch nicht auf das Establishment schimpfen kann, wenn man selber Millionär ist.“[16] – Ja, geradezu post-avantgardistisch „schockierend“, wie sich darin eine Verweigerung der geläufigen Verweigerungshaltungen bekundet, die sogar die besagte popkulturelle Ambivalenz mit einem Schlag in einer reinen Affirmation des Bestehenden auflöst. Man meint sich an das Humorverständnis Kants erinnert,[17] an jenen Umschlag einer gespannten Erwartung in Nichts, über das zuletzt jedoch nur noch die Realität zu lachen vermag, statt ihrer Kritiker.
Wenn das aber keine Progression mehr sein will, was ist es dann? – Etwa eine ödipale Regression, als munteres alltagsweises Wanderliedchen quasi unterwegs zum Schoß, von dem alles seinen Ausgang nahm? Wahrscheinlich macht man es sich zu einfach, hierin nur „den Tiefpunkt der Text- und Musikqualität des deutschen Schlagers“ erkennen zu wollen, wodurch „der jugendliche Hörer an die Popmusik verloren“ gegangen sei.[18] Zugestanden: Das auch. Aber vielmehr noch drückt sich hierin die eigentliche Wahrheit des Schlagers selbst aus, eine bis dato und seither nicht mehr erreichte Naivität, die noch durch ihre Vermarktung von Seiten des Managements und die sentimentale Sehnsucht auf Seiten der Rezipienten hindurch zum Vorschein kommt – eine Naivität, nicht verstanden als irgendeine Natur oder Unnatur im Kontrast zu Kultur und Kunst, sondern als die banale, ‚uneigentliche‘ Nicht-Unterscheidung dieser Sphären in unserem Lebensalltag.
Was in der Pop-Musik noch als Erbe der Kindheit in Verheißungen eines möglicherweise glückenden Selbstdesigns gegen die Konformität von heute reinvestiert wird, um morgen selber schon Konvention zu werden, offenbart sich bei Heintje in seinem Wesen als adoleszenter Schwebezustand, als wankelmütige Pose eines andauernden Neuanfangs, dessen Ende in Form einer trauernden Versöhnung dagegen in Zeilen wie diesen bereits vorweggenommen wird:
„Mama,
Du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen!
Mama,
einst wird das Schicksal wieder uns vereinen!
Ich werdʼ es nie vergessen,
was ich an dir habʼ besessen;
dass es auf Erden nur Eine gibt,
die mich so heiß hat geliebt.“
Das hier Kriegsdramen einer verheizten Falkhelfer-Generation wachgerufen wurden oder der wachsende Unmut der Elterngeneration gegenüber einer jugendlichen Counter-Culture bei diesem Schutzengel verständiger Duldsamkeit Trost finden mochte, dürfte den durchschlagenden Erfolg erklären, greift aber zu kurz, wenn es um das (Un-)Wesen des Schlagers geht, das sich hier als Ende und Vollendung eines immer gleichen, standardisierten, instrumentalisierten Hoffens selbst besingt: Auf den Fortgang kommen die Tränen, wenn sie getrocknet sind, bleibt nur das Andenken, während weiterer „Kummer und Schmerz“ den Alltag bereitet. Oder in kindlicheren Worten: Der Teddy hatte nie eine Seele, jedoch die Seele hat hinfort einen Teddy…
Nehmen wir diesen unsäglichen Ausklang zum Anlass, um noch einmal den Bogen zu schlagen: Bettelte Nicole um ein bisschen Frieden, letztlich um eine neue Heimat in einer zusehends unwirtlichen Welt, gewährt auch Heintje seinen Hörern keinen Halt, im Gegenteil: Selbst auf der Grenze verweilend, der kleine Engel, vertreibt er sie vielmehr aus dem Paradies kindlicher Unschuld, verweist sie stattdessen auf eine rückhaltlose Verinnerlichung bloßer Erinnerungen. Es gibt kein Zurück mehr, noch weniger ein Vorwärts ins Zurückliegende, allein eine Versöhnung mit der Verfallenheit nach dem Fall.
Diese Entschlossenheit zur Trauer, zu den ebenso kleinen Toden wie Geburten des Alltags, verspricht nichts mehr, sondern bewahrt allein die Einsicht auf als ein Andenken, dass vor und nach der „Möglichkeit der Nonkonformität“ eine Wirklichkeit des Erduldens wartet, kaum des Jasagens. Dieses Erdulden ist ein leiderprobtes Können und unerfragtes Wissen, die uneigentliche Lebenskunst, bisweilen gut sein zu lassen, was im Grunde niemals besser werden wird: Liebe, Verlust, Trauer, Versöhnung sind in diesem Sinne selbst Standards, sie verlaufen mit leichten Variationen nach einem durchschaubaren Schema und gewähren, wie jeder wahre Schlager, weder gänzliche Erfüllung noch Leere, sondern im Durchschnitt ein glücklich-verunglücktes Sich-Bescheiden mit dem bisschen Frieden auf Erden. Am Ende sind es wohl diese altbekannten, kaum erfundenen, eher wiedergefundenen Standards, ihr vertrauter Ton, ihre vertraute Melodie, ein Schema, das sie und den Rest überhaupt erträglich macht – so beschissen es auch klingt:
„Sing mit mir ein kleines Lied,
dass die Welt in Frieden lebt.“
Florian Arnold ist Akademischer Mitarbeiter für Philosophie und Ästhetik in der Fachgruppe Design an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und vertritt derzeit die Professur für Designtheorie an der HfG Offenbach.
[1] Vgl. auch André Port le roi: Schlager lügen nicht. Deutscher Schlager und Politik in ihrer Zeit, Essen 1998, S. 206f.
[2] Vgl. die dezidiert diskursanalytische Untersuchung von Julio Mendívil: Ein musikalisches Stück Heimat. Ethnologische Beobachtungen zum deutschen Schlager, Bielefeld 2008.
[3] Peter Wicke: „Schlager“, in: Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil, Bd. 8: Quer–Swi, Kassel/Basel/London/New York/Prag/Metzler/Stuttgart/Weimar 1998, S. 1064
[4] Ebd.
[5] Theodor W. Adorno: Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen, Frankfurt a.M. 1962, S. 36.
[6] Vgl. etwa Theodor W. Adorno: Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt, Göttingen 1956, S. 19: „[U]ngezählte Schlagertexte preisen den Schlager selber an, dessen Titel sie in Majuskeln wiederholen.“
[7] Adorno, Musiksoziologie, a.a.O., S. 42.
[8] Ebd.
[9] Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik, Köln 2014, XIIf.
[10] Ebd. XIII
[11] Schön auch das Lavieren mit dieser konstitutiven Ambivalenz kurz zuvor: „Sie [die Pop-Musik; Anm. FA] ist affirmativ, sie sagt Ja. Und will doch Nein sagen. I canʼt get no. It ainʼt me. Dieses Nein, das für das Publikum als Ja rüberkommt, ist eine große Stärke der Pop-Musik. Wenn es denn rüberkommt. Eine freudige und daher ermutigende, freundliche Verneinung des Bestehenden zugunsten der Umstehenden.“ (Ebd.)
[12] Vgl. Adorno, Einleitung, a.a.O., S. 37f.: „Sie [Schlager; Anm. FA] beliefern die zwischen Betrieb und Reproduktion der Arbeitskraft Eingespannten mit Ersatz für Gefühle überhaupt, von denen ihr zeitgemäß revidiertes Ich-Ideal ihnen sagt, sie müßten sie haben.“
[13] Diederichsen: Über Pop-Musik, a.a.O., S. 227.
[14] Ebd., S. 243.
[15] André Port le roi: Schlager lügen nicht, a.a.O., S. 127.
[16] Zitiert nach ebd., S. 128.
[17] Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, §54.
[18] André Port le roi: Schlager lügen nicht, a.a.O., S. 128.