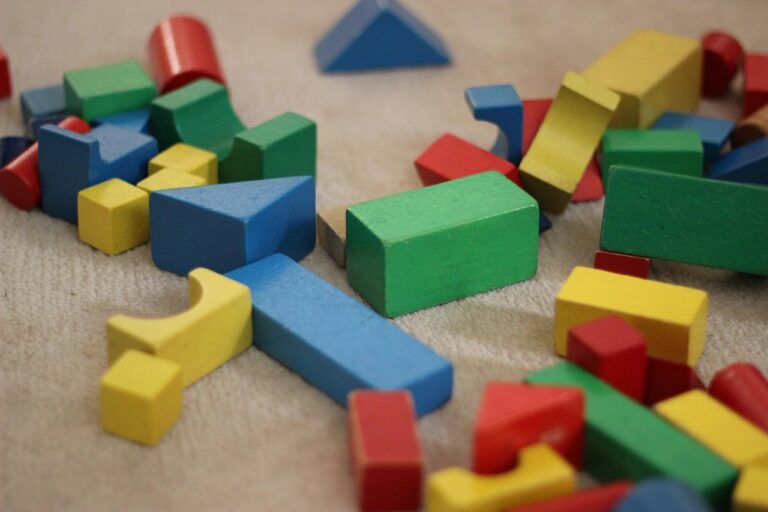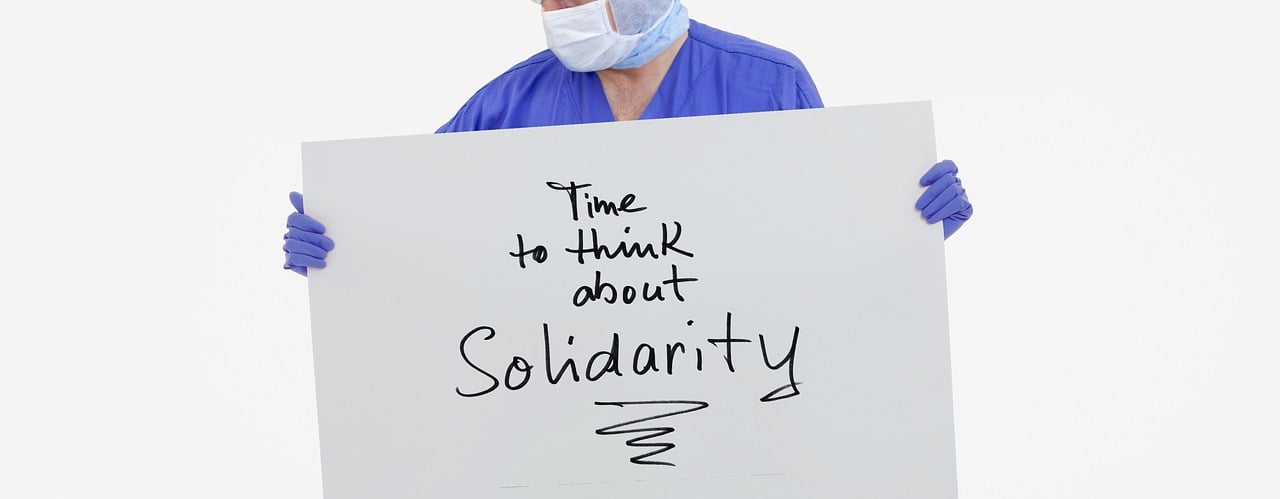
Brauchen wir Solidarität in der medizinischen Forschung?
Podcast: Play in new window | Download
Von Svenja Wiertz (Freiburg) –
Dieser Blogbeitrag basiert auf einem Aufsatz, der in der Zeitschrift Public Health Ethics erschienen ist. Der Aufsatz kann auf der Website der Zeitschrift kostenlos heruntergeladen werden.
Der Blogbeitrag kann auch als Podcast gehört und heruntergeladen werden:
Solidarität ist in aller Munde. Wir solidarisieren uns mit der Ukraine, Fußballvereine bedanken sich für die Solidarität ihrer Fans, Solidarität ist Grundprinzip von Gewerkschaften im Streik. Im Kontext der Medizin sprechen wir im Zusammenhang mit Solidarität über Krankenversicherungssystemen, über globale Ungerechtigkeit im Zugang zu Gesundheitsversorgung, oder auch Impfstoffverteilung. Nicht immer ist leicht zu erkennen, ob hier auf ein klar umrissenes Konzept der Solidarität bezuggenommen wird, oder ob diese als modisches Schlagwort fungiert, um die Bedeutung des Anliegens zu unterstreichen. Der folgende Beitrag befasst sich mit der Frage, ob es hilfreich ist, auf Solidarität zu verweisen, um zu begründen, warum Patient:innnen ihre Daten für medizinische Forschungszwecke teilen sollten. Dabei ist vor allem zu klären, wie der Begriff der Solidarität sinnvoll gefasst werden kann, um gehaltvoll zur Diskussion beizutragen.
Zum Begriff der Solidarität
Der Begriff der Solidarität lässt sich auf das römische Recht zurückführen und steht hier für ein Konzept der Gesamtverantwortung, in dem mehrere Personen gemeinschaftlich für die Erbringung einer Schuld einstehen. Im 19. Jahrhundert wird er zunächst in Frankreich in den politischen Kontext übertragen: Er ersetzt als Bezeichnung für den Zusammenhalt einer Gemeinschaft hier umgangssprachlich den Begriff der ‚Brüderlichkeit‘. Von dort findet er Eingang in die Arbeiterbewegung. Heute nehmen politische Gruppen aller Art den Begriff für sich in Anspruch.
Betrachten wir den Begriff der Solidarität aus philosophischer Perspektive genauer, dann ergeben sich verschiedene Probleme der Begriffsbestimmung. Zu allererst lässt sich fragen, wer sich eigentlich sinnvoll mit wem solidarisch zeigen kann. Typischerweise hat Solidarität ihren Ort innerhalb einer Gruppe oder Gemeinschaft, die gemeinsame Ziele verfolgt. Aber wieviel konkrete Gemeinsamkeit ist notwendig? Kann ich als Weiße meine Solidarität mit PoC zum Ausdruck bringen oder als heterosexuelle cisgender Person mit Angehörigen der LGBTQ+ Gemeinschaft? Alltagssprachlich sind solche Ausdrucksweisen durchaus üblich. Wir können aber dennoch hinterfragen, ob sie den Kern des Begriffs treffen, oder nicht über einen Unterschied hinwegtäuschen – zwischen mir, und der Gruppe, die ich unterstützen möchte, der ich aber nun einmal nicht angehöre. Im engeren Sinne setzt der Begriff der Solidarität (jedenfalls so, wie er im europäisch-akademischen Kontext verwendet wird) voraus, dass Handlungen aus Solidarität auf ein gemeinsames Ziel einer Gruppe ausgerichtet sind, der die handelnde Person zugehört.
Der Aspekt der Zugehörigkeit ist eng mit dem Gedanken der Gegenseitigkeit verbunden. Solidarität ist dabei nicht wie ein Geschäft zu verstehen, bei dem eine Handlung mit einer gleichwertigen Handlung vergolten wird. Dennoch wird ihr in der Regel ein Aspekt der indirekten Reziprozität zugesprochen: Der Akt der Solidarität erkennt (im Unterschied etwa zur Wohltätigkeit) an, dass ich mich potentiell in derselben Situation wiederfinden könnte und vielleicht selbst einmal von vergleichbaren solidarischen Handlungen anderer profitieren werde. Es ist keine Mildtätigkeit, keine Geste von oben herab, sondern eine Handlung, die der Umsetzung gemeinsamer Interessen dient.
Im Gruppenbezug der Solidarität liegt aus ethischer Perspektive auch ihr größtes Problem: Wenn Solidarität die Interessen und Ziele einer bestimmten Gruppe befördert, dann ist damit gleichzeitig gesetzt, dass es jene außerhalb dieser Gruppe gibt, deren Ziele nicht berücksichtigt werden. Solidarität unter Ärzt:innen kann sich zum Nachteil für Patient:innen auswirken. Solidarität kann ausgrenzen und sie kann Menschen schaden, die nicht zur solidarischen Gruppe gehören [2].
Zum normativen Anspruch von Solidaritätskonzepten
Ein weiterer wichtiger Aspekt von Solidaritätskonzepten ist in ihrem normativen Anspruch zu sehen. Betrachten wir Solidarität als eine soziale Praxis, dann ist Solidarität normativ, so wie jede soziale Praxis normativ ist: Sie etabliert soziale Normen anhand derer entschieden wird, ob jemand erfolgreich an dieser Praxis teilnimmt oder nicht: Wer sich im Streik solidarisieren will, muss die eigene Arbeit niederlegen. Wer ein Schild auf dem Schreibtisch mit der Aufschrift „ich streike“ aufstellt und weiterarbeitet, hat die Normen dieser sozialen Praxis nicht verstanden und scheitert in dem Versuch, an ihr teilzunehmen.
In einem anderen Sinne von Normativität lässt sich fragen, ob der Begriff selbst in normativ-evaluativer Weise gebraucht wird, oder nicht. Es kann sinnvoll sein, ‚Solidarität‘ wertfrei zu verwenden: Solidarisch sind alle sozialen Praktiken, in denen sich die Handlungen einzelner in einem Modus der Reziprozität auf die Verwirklichung eines wahrgenommenen Gutes für eine Gruppe beziehen. Mit dieser Beschreibung bleibt völlig offen, ob diese solidarischen Handlungen auch aus ethischer Perspektive als gut einzuordnen sind.
In diesem Sinne können wir den Zusammenhalt weißer Menschen als solidarisch beschreiben, wenn sie sich gegenseitig Vorteile verschaffen, und dabei rassistisch gegenüber schwarzen Menschen agieren. Wenn Männer aus Solidarität bevorzugt Männer einstellen, und Frauen damit den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren, sind sie im deskriptiven Sinne solidarisch. Es gab und gibt viele problematische Praktiken, die als Erscheinungsformen von Solidarität eingeordnet werden können. Dies scheint der Alltagsintuition entgegenzustehen, dass Solidarität doch im Allgemeinen etwas Gutes ist.
Entsprechend gibt es jenseits einer solchen deskriptiven und wertfreien Verwendungsweise des Begriffs Ansätze, Solidarität so zu fassen, dass sie zwar nicht immer und notwendig als gut einzuordnen ist, aber doch allgemein als ein begrüßenswertes Phänomen erscheint. Stellen wir uns zwei mögliche Welten vor: Eine, in der Solidarität vollständig abwesend ist, und eine, in der sich Menschen in verschiedenen Kontexten solidarisch miteinander zeigen. Die Vertreter:innen schwach-evaluativer Solidaritätskonzepte erwarten von uns, dass wir zustimmen, dass die zweite Welt der ersten grundlegend vorzuziehen ist [3]. Prinzipiell wollen wir in einer Welt der Solidarität leben. Solidarität liegt überall dort vor, wo Menschen einander gegenseitig in der Erreichung ihrer Ziele unterstützen. Es handelt sich auch dann um Solidarität, so nimmt die Position weiter an, wenn die verfolgten Ziele im Einzelfall als verfehlt zu betrachten sind. Aber auch wenn Menschen in Gemeinschaft gelegentlich die falschen Ziele verfolgen, sei eine Welt mit Solidarität unterm Strich besser als eine Welt ohne Solidarität. Solidarität ist dann nicht immer gut, aber meistens.
Hier, wie auch im unten vorgestellten dritten Konzept von Solidarität, wird der Wert einer solidarischen Praxis in ihrem Bezug zur Gerechtigkeit gesehen. Solidarische Praktiken erscheinen in vielen Fällen geeignet, Gerechtigkeit zu fördern, ohne aber notwendig auf diese bezogen zu sein. Obwohl dieser Ansatz durchaus Plausibilität besitzt, hat er etwas Unbefriedigendes, vielleicht sogar Irreführendes: Er stellt Solidarität allgemein als wertvoll dar, ohne uns einen überzeugenden Grund zu liefern, eine konkrete einzelne Praxis der Solidarität als wertvoll einzuordnen: Solidarität im Einzelfall kann Gerechtigkeit fördern, sie kann aber auch Ungerechtigkeit herstellen. Wenn die Frage nicht lautet, ob es Solidarität in unserer Welt überhaupt geben sollte, sondern in Frage steht, ob eine konkrete Praxis der Solidarität wünschenswert ist, kann diese Auffassung von Solidarität uns nicht von der Aufgabe entbinden, jede Praxis einzeln im Hinblick auf ihre Ziele und möglichen Aspekte der Ausgrenzung zu bewerten: Jede konkrete Praxis der Solidarität kann sich bei näherer Betrachtung potentiell auch als ethisch verwerflich erweisen.
Um diesem Problem auszuweichen gibt es nun eine dritte Gruppe von Ansätzen, Solidarität begrifflich zu fassen. Diese binden Solidarität direkt an Vorstellungen der Gerechtigkeit [4]. Eine soziale Praxis sollte dann und nur dann als ‚solidarisch‘ ausgezeichnet werden, wenn ihre Ziele zur Verwirklichung von Gerechtigkeit beitragen. Solidarität und Gerechtigkeit sind aus dieser Perspektive nicht gleichzusetzen, da Gerechtigkeit auch auf anderen Wegen hergestellt werden kann. Aber Solidarität ist ein geeignetes Mittel Gerechtigkeit zu verwirklichen. Wird Solidarität so verstanden, kann sie aus ethischer Perspektive immer als gut eingeordnet werden. In diesem Fall sollten wir uns in der Tat, wo immer es geht, solidarisch zeigen.
Solidarität in der medizinischen Forschung?
Übertragen wir diese Überlegungen auf den Kontext der medizinischen Forschung und gehen der Frage nach, ob Menschen aus Gründen der Solidarität Forschung unterstützen sollten. Solche Überlegungen sind insbesondere im Kontext von Diskussionen um die breite Einwilligung angeführt worden. Diese soll für daten- und probenbasierte Forschung das Modell der spezifischen Einwilligung ablösen, um mehr Forschung zu ermöglichen. Patient:innen werden nicht mehr gebeten, einzelnen Projekten zuzustimmen, sondern sollen sich entscheiden, ihre Daten und ggf. Bioproben insgesamt für die Forschung zur Verfügung zu stellen – oder eben nicht. Wäre das Erteilen einer breiten Einwilligung in die Forschung eine solidarische Handlung? Und lässt sich daraus ein ethisches Argument ableiten, dass wir unsere Einwilligung zur Forschung erteilen sollten?
Beziehen wir uns auf einen deskriptiven Begriff von Solidarität, dann können wir lediglich das Bestehen einer Praxis aufzeigen. Da der Begriff keinen evaluativen Charakter hat, ist damit auch nichts darüber ausgesagt, ob diese Praxis positiv oder negativ einzuordnen ist. Wenn wir die Praxis der Einwilligung zur Forschung als eine Praxis der Solidarität beschreiben, dann sagen wir lediglich soviel wie „Es gibt da eine Praxis, an der Menschen sich beteiligen, um gemeinsame Ziele zu verfolgen.“ Als Individuum können wir das als Anlass nehmen uns zu überlegen, ob wir dieser Gruppe zugehören (wollen), und ob die verfolgten Ziele auch unsere Ziele sind. Die Tatsache, dass es sich um eine solidarische Praxis handelt, liefert in diesem Verständnis jedoch an sich keinerlei Grund, uns an der Praxis zu beteiligen
Ziehen wir einen schwach-evaluativen Begriff von Solidarität heran, dann gehen wir einen Schritt weiter. Wir verweisen darauf, dass Einwilligung zur medizinischen Forschung eine solidarische Praxis darstellt, und wir deuten zugleich an, dass es sich vermutlich um eine wünschenswerte soziale Praxis handelt, ohne an dieser Stelle jedoch ein finales Urteil gesprochen zu haben. Sofern Solidarität auch schädliche Praktiken umfasst, bleibt der Einzelfall zu prüfen.
An dieser Stelle ist einzuwenden, dass es stark vereinfacht ist, die Zustimmung zu medizinischer Forschung im Sinne einer einzigen solidarischen Praxis zu verstehen. Unsere Daten für alle in Frage kommenden Forschungsprojekte freizugeben kann als eine solidarische Handlung verstanden werden. Es wäre aber auch eine solidarische Handlung, die Erforschung von seltenen Erkrankungen zu unterstützen, wenn ich an einer seltenen Erkrankung leide. Oder speziell die Krebsforschung zu unterstützen. Während uns ein schwach-evaluativer Begriff von Solidarität also unter Vorbehalt einen Grund liefert, eine Einwilligung zur Forschung zu erteilen, könnten wir uns legitimerweise wünschen, andere Optionen der Einwilligung zu haben. Insbesondere, wenn wir in Frage stellen, dass die medizinische Forschung als ganzes tatsächlich die richtigen Ziele verfolgt, die bessere Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen etwa jedoch ein Anliegen ist, zu dem wir gerne beitragen würden: Ein schlichtes ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ zu jeglicher Form von Forschung fördert eine mögliche Praxis der Solidarität, schließt andere jedoch aus.
Gerechtigkeit, Wohlergehen und medizinische Forschung
Allein der dritte Begriff von Solidarität ist geeignet, ein starkes ethisches Argument zu liefern. Seine Überzeugungskraft leitet sich jedoch vom Begriff der Gerechtigkeit ab. Deshalb müssen wir uns hier auf die Gegenfrage einlassen, ob die Forschung, um die es gerade geht, denn eigentlich geeignet ist zu mehr Gerechtigkeit in der Welt beizutragen. Ist ein konkretes Forschungsprojekt geeignet, das Wohlergehen benachteiligter Gruppen, global gesehen, oder zumindest innerhalb unserer Gesellschaft zu fördern? Oder geht es um die Entwicklung teurer Therapien oder Medikamente, die am Ende nur wenigen zur Verfügung stehen? Ist das relevante Krankheitsbild eines, an dem die Ärmsten der Gesellschaft sterben? Oder trifft es in der Mehrheit diejenigen, die in unserer Gesellschaft ansonsten gut gestellt sind?
Sicher gibt es medizinische Forschung, die zu einem solchen Ziel beiträgt. Es scheint allerdings bei weitem nicht selbstverständlich, dass jegliche medizinischen Forschung, die wir aktuell betreiben und als sinnvoll betrachten, im engen Sinne Gerechtigkeit fördert. Das ist in der Regel nicht ihr eigentliches Ziel. Das primäre Gut, auf das medizinische Forschung ausgerichtet ist, ist die Verminderung von Leid und Förderung von Wohlergehen. Das ist ein genuin wertvolles Ziel. Aber es ist kein Ziel der Gerechtigkeit. Vielleicht ist also Solidarität auch in diesem dritten Sinne eigentlich der falsche Begriff, um Menschen zur Teilnahme an Forschung aufzufordern.
Brauchen wir einen neuen Begriff der Solidarität?
Möglicherweise ließe sich eine andere plausible Auffassung von Solidarität ins Feld führen, die weit besser als die hier vorgestellten Konzepte geeignet ist, ein Argument für die Teilnahme an medizinischer Forschung zu liefern. Es gibt ohnehin Tendenzen, den Begriff der Solidarität zunehmend weiter zu fassen. Eine anderer Strategie bestünde darin, ein stark-evaluatives Konzept von Solidarität vorzuschlagen, das den Begriff nicht allein an Gerechtigkeit bindet, sondern auch solche Praktiken einschließt, die andere wertvolle Ziele wie etwa die Verminderung von Leid verfolgen.
Ich würde entgegnen, dass mir nicht einleuchtet, warum wir riskieren sollten, den Begriff der Solidarität überzustrapazieren, wenn wir ihn nicht brauchen. Wir haben andere passende Begriffe, wie Hilfe, Wohltätigkeit, Dankbarkeit, um konkrete Handlungen oder abstrakte ethische Verpflichtungen zu beschreiben, die auf die Unterstützung des Wohlergehens anderer ausgerichtet sind. Es trägt nicht zu einer begrifflichen Schärfe bei, wenn jede Form von Unterstützung zu Solidarität erklärt wird.
Svenja Wiertz ist Mitarbeiterin am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universität Freiburg sowie am University College Freiburg. Sie forscht zu Themen der Medizinethik und Wissenschaftsethik, insbesondere zu Fragen mit Bezug zu Daten, Digitalisierung und KI, sowie zu persönlichen und interpersonalen Beziehungen: https://www.egm.uni-freiburg.de/Mitarbeitende/mitarbeiterin_wiertz
Quellen
[1] Die hier vorgestellten Überlegungen basieren im Wesentlichen auf der folgenden Veröffentlichung: Svenja Wiertz, How to Design Consent for Health Data Research? An Analysis of Arguments of Solidarity, Public Health Ethics, 2023; phad025, https://doi.org/10.1093/phe/phad025
[2] Vgl. hierzu Kaphegyi, Tobias, Philipp Rhein, Giuliana Sorce, und Daniel Lehnert. „Einleitung“. In Exkludierende Solidarität der Rechten, herausgegeben von Giuliana Sorce, Philipp Rhein, Daniel Lehnert, und Tobias Kaphegyi, 1st ed. 2022., 1–18. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint Springer VS, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36891-3_1.
[3] Vertreterinnen dieses Ansatzes sind insbesondere Barbara Prainsack und Alena Buyx, die in den vergangenen Jahren eine ganz Reihe wertvoller Beiträge zur Debatte um Solidarität geleistet haben. Verwiesen sei hier insbesondere auf: Prainsack, Barbara, und Alena Buyx. Das Solidaritätsprinzip: Ein Plädoyer für eine Renaissance in Medizin und Bioethik. s.l.: Campus Frankfurt / New York, 2016. http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783593434018.
[4] Vgl. etwa Gould, Carol C. „Solidarity and the problem of structural injustice in healthcare“. Bioethics 32, Nr. 9 (1. Januar 2018): 541–52. https://doi.org/10.1111/bioe.12474.