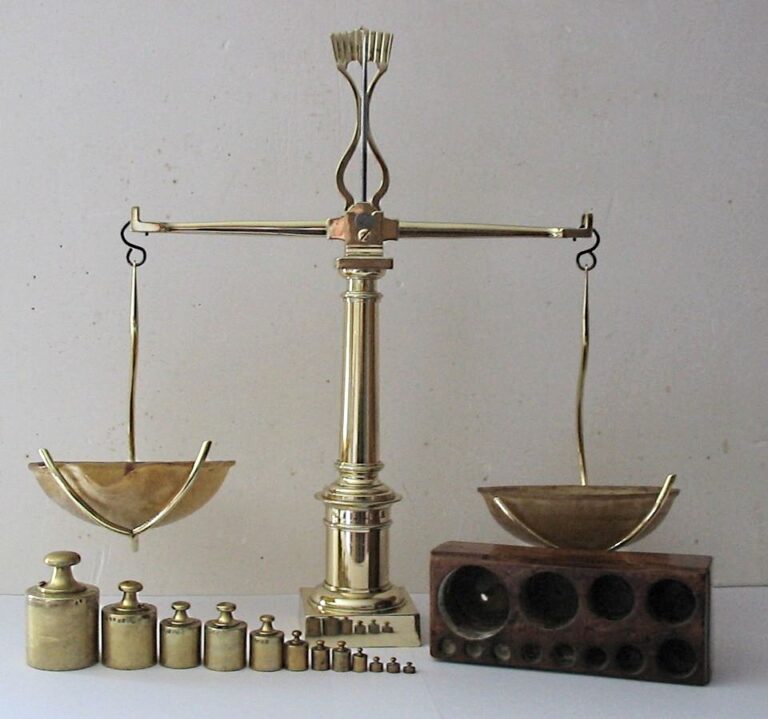Auf einem Auge blind? ‚Vendor Lock-in‘ und dessen Folgen in der Philosophie
Nicola Mößner (Leibniz Universität Hannover / RWTH Aachen)
Jay F. Rosenberg (2009) schreibt über den Gegenstand der analytischen Philosophie, dass wir Forschende hier stets einen „Schritt von den Fakten ‘erster Ordnung’ entfernt“ seien (ebd., 21). Wir reflektieren über andere Wissenschaften, deren Methoden, deren Fragestellungen. Wir nehmen gerne die Metaperspektive ein – wir gehen so vor von Berufswegen. Manchmal stehen wir uns damit aber auch selbst etwas im Weg – dann nämlich, wenn wir uns selbst – unser eigenes Vorgehen– in den Blick nehmen sollten. Auf diesem Auge scheinen wir tatsächlich eine gewisse Sehschwäche zu haben.
Gemeint ist nicht die Frage nach der richtigen Methode der Philosophie und damit zusammenhängend die basale Überlegung, was Philosophie überhaupt ist, welche Schule – analytische Tradition oder kontinentaleuropäische – zu verfolgen sei u.Ä., wie es in der sogenannten Metaphilosophie z.B. von Timothy Williamson (2007) untersucht oder in Einführungswerken wie jenem von Rosenberg (2009) oder auch von Gerhard Ernst (2012) thematisiert wird. Nein, es geht darum, die philosophische Arbeitspraxis im 21. Jahrhundert viel grundsätzlicher zu betrachten. Was ist also unser blinder Fleck?
Wie in anderen akademischen Disziplinen auch spielt innerhalb der Philosophie das Thema des elektronischen Publizierens eine große Rolle. Arbeitsergebnisse werden zunehmend in Zeitschriftenartikeln festgehalten, die überwiegend auf webbasierten Plattformen in den Datenbanken der Fachverlage zugänglich gemacht und gehalten werden. Wenn im Folgenden also von Arbeitspraxen die Rede ist, dann ist genau das damit gemeint: Praxen des elektronischen Publizierens, d.h. eigene Forschungsergebnisse und -hypothesen schriftlich zu fixieren, zu veröffentlichen und, umgekehrt auch, nach publizierten Werken von FachkollegInnen zu recherchieren, um sich mit diesen (kritisch) in der eigenen Arbeit auseinanderzusetzen. Postuliertes Ziel ist bei all dem der Austausch – ein Diskurs – über die verschiedenen Themen innerhalb der philosophischen Community[i].
Der Zeitschriften-‘Markt’
Zeitschriftenaufsätze wurden ursprünglich in die wissenschaftliche Kommunikation integriert, um den Austausch unter KollegInnen zu beschleunigen.[ii] Angestrebt wurde, den langwierigen Entstehungs- und Veröffentlichungsprozess in Buchform abzukürzen. Gleichzeitig sollte die Möglichkeit erhalten bleiben, einen größeren Kreis von LeserInnen zu adressieren und sich nicht bloß via Gelehrtenbrief an einzelne Personen zu wenden. Dem Praktiker ist bewusst, dass dieses hehre Ziel in weite Ferne gerückt ist. Lange Warte- und Überarbeitungszeiten im üblichen Peer-Review-Verfahren, Zeitverluste angesichts wiederholter Versuche, den Beitrag bei einem Journal unterzubringen (inkl. dem damit verbundenen Aufwand zur Anpassung an inhaltliche und formale Vorgaben) sowie Verzögerungseffekte, die dem im digitalen Zeitalter wenig verständlichen Festhalten an Erscheinungszyklen in Heftnummern geschuldet sind, stellen dieses Argument der Effizienzsteigerung in Frage.
Darüber hinaus hat sich im Zusammenhang mit dem elektronischen Publizieren eine Reihe weiterer Probleme herausgebildet[iii], die sowohl für den einzelnen Wissenschaftler / die einzelne Wissenschaftlerin als auch für das System Wissenschaft als Ganzes massive Nachteile mit sich bringen.[iv] Diese Probleme hängen überwiegend mit der Oligopolbildung auf dem wissenschaftlichen Zeitschriftenmarkt zusammen.
Oligopolisten: ihre Produkte, unsere Probleme
Die angesprochenen Probleme werden offenkundig, wenn man die einzelnen Schritte des Produktionsprozesses eines elektronischen Zeitschriftenartikels genauer betrachtet[v]:
- Der Artikel wird von einer Wissenschaftlerin / einem Wissenschaftler verfasst – üblicherweise im Rahmen der Tätigkeit an einer Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung. Die Finanzierung der Arbeit erfolgt klassischerweise über Steuergelder, aus denen die Personalkosten an diesen Institutionen gedeckt werden.
- Der fertige Artikel (inkl. Layout, Lektorat etc.) wird an eine Zeitschrift gesendet, um diesen zu veröffentlichen. Der Verlag, der diese Zeitschrift herausgibt, erhält dieses ‚Produkt‘ kostenlos zur Verfügung gestellt. Üblicherweise werden die AutorInnen später (d.h. bei Annahme des Artikels) aufgefordert, eine Reihe von Rechten an ihrem Werk an den Verlag (ebenfalls unentgeltlich) abzutreten.
- Die Herausgeber der Zeitschrift (zumeist ebenfalls WissenschaftlerInnen, die im Übrigen für den Verlag gratis ihre Tätigkeit verrichten) senden den eingereichten Beitrag an andere WissenschaftlerInnen zur Begutachtung. Dieser sogenannte ‚Peer-Review-Prozess‘, durch welchen die (vermeintlich) hohe Qualität der Beiträge in einer Zeitschrift sichergestellt werden soll, findet also erneut als Gratis-Leistung (bzw. steuergeldfinanzierte Aufgabe) der Wissenschaft für den kommerziellen Verlag statt. Letztlich ist es dieses Qualitätsmerkmal der Begutachtung, das zumeist angeführt wird, um das Renommee der jeweiligen Zeitschrift zu begründen und damit auch deren Preis, der im nachfolgenden Schritt aufgerufen wird.
- Die Verlage verkaufen die Artikel als Inhalte der Zeitschrift zurück an die wissenschaftliche Gemeinschaft. Der übliche Weg ist hier der Subskriptionsvertrag, den die Bibliotheken mit den Verlagen abschließen.[vi] Neben diesem ‚klassischen‘ Weg der Monetarisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die Wissenschaftsverlage haben sich im Bereich der Open-Access(OA)-Publikation[vii] eine Reihe weiterer Kostenmodelle etabliert. Bekannt sind die sogenannten Article Processing Charges (APCs)[viii], welche der Autor / die Autorin für die OA-Publikation zu bezahlen hat.[ix]
- Ein weiteres Produkt, das die kommerziellen Verlage aus den gratis zur Verfügung gestellten Leistungen der WissenschaftlerInnen generieren und mit Gewinn an die Wissenschaft und andere Akteure (zurück-)verkauft, sind bibliometrische Daten. In der Bibliometrie als Metawissenschaft werden mittels quantitativer Maßstäbe (z.B. h-Index, Journal Impact Faktor u.a.) Aussagen über den (vermeintlichen)[x] Impact, d.h. den Einfluss eines Wissenschaftlers / einer Wissenschaftlerin in ihrer Community getätigt. Um diese Kennzahlen generieren zu können, wird eine möglichst umfassende Datenbasis benötigt, die Erhebungen zu den Veröffentlichungszahlen sowie den Zitationen der AutorInnen erlauben. Auch ein Ranking von Institutionen kann auf dieser Basis erstellt werden, indem deren einrichtungsweiter ‚wissenschaftlicher Output‘ erfasst wird, und diese anschließend einander vergleichend gegenübergestellt werden. Interesse an den bibliometrischen Erhebungen haben somit nicht allein einzelne WissenschaftlerInnen, die besagte Indices für Selbstdarstellungen z.B. im Rahmen von Bewerbungsverfahren nutzen, sondern ebenso wissenschaftliche Einrichtungen z.B. für PR-Zwecke, um beispielsweise Studierende für ihre Fächer anzuwerben. Aber auch Geldgebern der unterschiedlichen Art ist an diesen Zahlenwerten gelegen, um z.B. die Vergabe von Fördergeldern entsprechend zu gewichten. Wiederum gilt, dass diese Kennzahlen nur erhoben werden können, wenn man über eine entsprechende Datenbank verfügt.[xi] Und diese sind derzeit fest in kommerzieller Hand.
- Schließlich ermöglicht die Nutzung der im vorherigen Schritt angeführten Datenbanken durch die WissenschaftlerInnen den Oligopolisten, ein weiteres ‚Produkt’ zu generieren und zu monetarisieren: die Datenspuren, welche die Nutzenden auf ihren Plattformen hinterlassen.[xii] Hier entsteht das Problem des Datentrackings, auf welches die DFG in einem Positionspapier aufmerksam macht (2021). Das von Online-Plattformen und -Dienstleistungen wie Google und Amazon bekannte Profiling der Nutzenden kommt hier erneut zur Anwendung. Vergleichbar ist dabei ebenfalls die Argumentation, mit der die Etablierung des Trackings der Nutzenden gerechtfertigt wird: nämlich, dass dadurch lediglich eine Optimierung des Produkts auf die Bedürfnisse der AnwenderInnen hin erfolge. Wesentlich tritt aber hinzu, dass diese von den Oligopolisten erstellten Datenprofile mit dritten Parteien gehandelt werden. Verschiedene Szenarien sind denkbar im Hinblick auf die Frage danach, wer ein Interesse an den erhobenen Daten haben könnte.[xiii] Björn Brembs et al. haben auf diese Schwierigkeit aufmerksam gemacht und eine Petition gegen das „Wissenschaftler-Tracking“[xiv] initiiert.
Locked-in
Deutlich wird in dieser Übersicht, dass die Oligopolisten des akademischen Zeitschriftenmarktes auf vielerlei Weise Kapitel aus dem Wissenschaftssystem schlagen. Die Vielfalt der wissenschaftlichen Zeitschriften und Datenbanken hängt tatsächlich an einigen wenigen Anbietern, die zu großen Konzernen verschmolzen sind.[xv]
Dass dem so ist, macht es zunehmend schwieriger, sich jenseits dieses etablierten Systems zu bewegen. Die notwendige Infrastruktur zur Publikation sowie zur Recherche wissenschaftlicher Arbeiten wird mehr und mehr von diesen Anbietern dominiert. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem sogenannten „vendor lock-in“, d.h. Alternativen zu den bekannten Infrastrukturen – z.B. Journals, die von der wissenschaftlichen Community selbst herausgeben und gehostet werden[xvi] oder auch nicht-kommerzielle Datenbanken wie z.B. Philpapers.org tun sich schwer damit, als attraktive Angebote in den Augen der Nutzenden zu erscheinen. Zumeist verfügen sie nicht über die prestigeträchtigen Namen, die von den Mitgliedern der eigenen Community als Synonyme für qualitativ hochwertige Arbeit gelesen werden.[xvii]
Subskriptionskrise: Deutlich wird die Schwierigkeit auch an der sogenannten Subskriptionskrise (vgl. Brembs u.a. 2023). Es wurde bereits auf die hohen Gewinnmargen hingewiesen, die sich aus den Abonnements wissenschaftlicher Zeitschriften für die Verlage ergeben. Die Preise sind in diesem Kontext über die Jahre kontinuierlich angestiegen (vgl. Holzer 2022). Bibliotheken, die diese Abonnements abschließen, um WissenschaftlerInnen an ihren Institutionen Zugang zu den Inhalten zu ermöglichen, können aber schlecht, einzelne Zeitschriftentitel einfach abbestellen, auch wenn sie es, von einem finanziellen Standpunkt aus betrachtet, eigentlich müssten. Die namenhaften Journals lassen sich ja schwerlich durch andere Angebote ersetzen. Dadurch dass bestimmten Zeitschriften von Seiten der Wissenschaft ein entsprechendes Renommee zugesprochen wird, sehen sich die Bibliotheken gezwungen, diese ebenfalls im Zugriff für ihre Lesenden vorzuhalten – auch wenn die von den Oligopolisten aufgerufenen Preise in keinem Verhältnis zur Leistung stehen.
Publikationskrise: Eine weitere Folge des Locked-in-Syndroms besteht in einer Reihe negativer Auswirkungen auf das Publikationsverhalten individueller WissenschaftlerInnen selbst (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft, AG Publikationswesen 2022). An anderer Stelle auf diesem Blog wurde diese Schwierigkeit genauer beleuchtet (vgl. Mößner 2023). Insbesondere wurde im Anschluss an das Positionspapier der DFG (2022) auf Normverletzungen der guten wissenschaftlichen Praxis aufmerksam gemacht, welche durch die im System des elektronischen Publizierens herrschenden Anforderungen an die AutorInnen entstehen. Dies beginnt bereits bei der Feststellung, dass in einigen Fällen die Zugänglichmachung wissenschaftlicher Ergebnisse, welche Ziel einer Publikation sein sollte, bewusst zu Gunsten publikationsstrategischer Erwägungen (Platzierungen in namenhaftem Journals) verzögert wird.
Deutlich wird, dass das derzeitige System des elektronischen Publizierens im Zeitschriftenformat in den Händen der Verlagsoligopolisten eine Reihe von tiefgreifende Problemen aufwirft, die eng miteinander verzahnt sind.[xviii] Ersichtlich werden sollte dabei ebenfalls, dass es nicht damit getan ist, die (technische) Infrastruktur des Publikationswesens auszutauschen. Viele der angesprochenen Schwierigkeiten können ihre dysfunktionale Macht letztlich nur deshalb voll entfalten, weil aus dem System Wissenschaft heraus selbst ein Interesse daran besteht, dass bestimmte Strukturen bleiben, wie sie nun einmal sind. In vielen Fällen steht die eigene Wissenschaftskultur, die sich nach wie vor stark von der – etwas despektierlich ausgedrückt – Zahlenmystik der Bibliometrie einnehmen lässt, wirklichen Veränderungen im Weg.
Warum WIR etwas tun müssen…
Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen wurde im Rahmen der DGPhil-Forumstagung „verTRACKte Infrastruktur?! Von Konstrukteuren und Kontrolleuren wissenschaftlicher Expertise“ im September 2023[xix] ein Positionspapier (vgl. Mößner und Erlach 2024) entwickelt, das Empfehlungen bündelt, wie und wo die philosophische Community selbst aktiv werden kann, um den geschilderten Problemstellungen entgegenzutreten. Hierzu zählen im Einzelnen:
- Elektronisches Publizieren: Infrastruktur in die Hände der wissenschaftlichen Community legen (z.B. Diamond Open Access)
- Peer Review: Begutachtung nur nach Kriterien der Wissenschaftlichkeit
- Bewerbungsverfahren: Nutzung von Visualisierungen statt Metriken
- Promotionsphase: Trennung der Rollen von Betreuung und Begutachtung
- Datenhoheit: Unterbindung des Wissenschaftler-Trackings durch Nutzung wissenschaftsgestützter Infrastruktur sowie Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen
Diese Empfehlungen verstehen sich als Vorschläge, die zur kritischen Reflexion anregen sollen. Darüber hinaus kann jeder der Punkte dazu genutzt werden, dem Machtgefälle im Wissenschaftssystem / im System der akademischen Philosophie, den dysfunktionalen Publikationspraxen sowie einer weiteren Verstärkung des Locked-in-Syndroms im Bereich des elektronischen Publizierens in einem ersten Schritt entgegenzutreten. Mit diesen Empfehlungen ist die Hoffnung verbunden, zu einer Stärkung der Autonomie der Wissenschaften – und damit auch der akademischen Philosophie im digitalen Zeitalter – beitragen zu können.
Nicola Mößner ist Vertretungsprofessorin am Institut für Philosophie der Leibniz Universität Hannover. Sie studierte Germanistik, Philosophie und Politologie an der Universität Hamburg, lehrte und forschte in Münster, Aachen, New York, Greifswald, Frankfurt/Main und Stuttgart. Seit 2017 ist sie Privatdozentin für Philosophie an der Philosophischen Fakultät der RWTH Aachen. Sie befasst sich mit Fragen der sozialen Erkenntnistheorie, der Wissenschaftstheorie sowie der analytischen Bildtheorie. Profil auf Philpapers.org: https://philpeople.org/profiles/nicola-mossner-1
Bibliographie
Altschaffel, Robert, Michael Beurskens, Jana Dittmann, Wolfram Horstmann, Stefan Kiltz, Gerhard Lauer, Judith Ludwig, Bernhard Mittermaier, und Katrin Stump. 2024. Datentracking und DEAL – Zu den Verhandlungen 2022/2023 und den Folgen für die wissenschaftlichen Bibliotheken –. In: RuZ – Recht und Zugang 5 (1): 23–40. https://doi.org/10.5771/2699-1284-2024-1-23.
Andersen, Hanne. 2019. „Can Scientific Knowledge Be Measured by Numbers?“ In: What Is Scientific Knowledge?: An Introduction to Contemporary Epistemology of Science, hrsg. von K. McCain und K. Kampourakis, 144–159. New York. https://doi.org/10.4324/9780203703809.
Baldwin, Melinda Clare. 2015. Making Nature: The History of a Scientific Journal. Chicago und London. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226261591.001.0001.
Björn Brembs, Konrad Förstner, Peter Kraker, Gerhard Lauer, Claudia Müller-Birn, Felix Schönbrodt, & Renke Siems. 2020. Auf einmal Laborratte. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. https://doi.org/10.5281/zenodo.4317253.
Brembs, Björn, Philippe Huneman, Felix Schönbrodt, Gustav Nilsonne, Toma Susi, Renke Siems, Pandelis Perakakis, Varvara Trachana, Lai Ma, und Sara Rodriguez-Cuadrado. 2023. Replacing Academic Journals. In: Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.7974116.
Deutsche Forschungsgemeinschaft, AG Publikationswesen. 2022. Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung. In: Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.6538163.
DFG-Ausschuss Für Wissenschaftliche Bibliotheken Und Informationssysteme. 2021. Datentracking in der Wissenschaft: Aggregation und Verwendung bzw. Verkauf von Nutzungsdaten durch Wissenschaftsverlage. Ein Informationspapier des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In: Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.5900759.
Drößler, Stefan. 2022. „Open Access: Technikgetriebene Gesellschaftsutopie für die Transformation des wissenschaftlichen Publikationssystems“. In: Kalibrierung der Wissenschaft: Auswirkungen der Digitalisierung auf die wissenschaftliche Erkenntnis, hrsg. von N. Mößner und K. Erlach, 79–102. Bielefeld. https://doi.org/10.14361/9783839462102-004.
Eggert, Eric. 2024. „Fachinformationsdienst Philosophie: Journal Hosting“. In: Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14251396.
Ernst, Gerhard. 2012. Denken wie ein Philosoph: eine Anleitung in sieben Tagen. 3. Aufl. München.
Herb, Ulrich. 2018. Zwangsehen und Bastarde. Wohin steuert Big Data die Wissenschaft? In: Information – Wissenschaft & Praxis 69 (2–3): 81–88. https://doi.org/10.1515/iwp-2018-0021.
Holzer, Angela. 2022. „Die Vermessbarkeit der Wissenschaft: Digitalisierung, wissenschaftliches Publizieren, Verhaltenstracking und Wissenschaftsbewertung“. In: Kalibrierung der Wissenschaft: Auswirkungen der Digitalisierung auf die wissenschaftliche Erkenntnis, hrsg. von N. Mößner und K. Erlach, 163–182. Bielefeld. https://doi.org/10.14361/9783839462102-007.
Lamdan, Sarah. 2023. Data cartels: the companies that control and monopolize our information. Stanford, California.
Mößner, Nicola. 2022a. „›Keine Spyware in Bibliotheken und Institutionen‹ – wirklich?: Die Gefahren des Wissenschaftstrackings“. In: Mitteilungen der DGPhil 55 (Frühjahr): 11–13.
———. 2022b. „Mitleser aufgepasst! Von der Informationsanalyse zum Wissenschaftlertracking“. In: Jahrbuch Technikphilosophie. Auskopplungen: Wissenschaftler-Tracking. https://jtphil.de/?p=1081.
———. 2023. „Digitale Praxis – Fallstrick für Normen im Wissenschaftsalltag?“ In: Prae|Faktisch. Ein Philosophieblog. https://praefaktisch.de/digitalisierung/digitale-praxis-fallstrick-fuer-normen-im-wissenschaftsalltag/.
———. 2024. „Metriken und Expertise“. In: Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14218972.
Mößner, Nicola, und Klaus Erlach. 2024. Elektronisches Publizieren und Bewertung wissenschaftlicher Expertise. In: Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.10948471.
Retzlaff, Eric. 2022. „Wer bewertet mit welchen Interessen wissenschaftliche Publikationen?: Eine Skizzierung des Einflusses kommerzieller Interessen auf die Forschungsoutput-Bewertung“. In: Kalibrierung der Wissenschaft: Auswirkungen der Digitalisierung auf die wissenschaftliche Erkenntnis, hrsg. von N. Mößner und K. Erlach, 139–162. Bielefeld. https://doi.org/10.14361/9783839462102-006.
Rosenberg, Jay F. 2009. Philosophieren: ein Handbuch für Anfänger. 6. Aufl., Frankfurt am Main.
Siems, Renke. 2021. When Your Journal Reads You – User Tracking on Science Publisher Platforms. In: Zenodo. https://doi.org/10.5281/ZENODO.4683778.
Stein, Lisa-Marie (i.E.): „Das Alphabet der Publikationskosten.“ In: Vermessene Philosophie. Konstruktion und Kontrolle wissenschaftlicher Expertise im digitalen Raum, hrsg. von N. Mößner und K. Erlach.
Williamson, Timothy. 2007. The Philosophy of Philosophy. Malden, Mass. u.a.
[i]Es ist richtig darauf hinzuweisen, dass auch in der breiteren Öffentlichkeit ein Interesse an philosophischen Themen besteht, und Publikationen aus der Philosophie rezipiert werden. Allerdings scheint es ebenfalls plausibel anzunehmen, dass diese Art von Interesse sich eher selten auf die philosophische Fachdiskussion erstreckt, wie sie in den Journalpublikationen ihren Ausdruck findet.
[ii]Vgl. z.B. die wissenschaftshistorische Analyse zur Zeitschrift Nature von Melinda Baldwin (2015).
[iii]Björn Brembs et al. (2023) benennen die folgenreichsten dieser Problemstellungen und fordern die Abkehr vom klassischen oligopolgesteuerten Zeitschriftenmarkt im akademischen Sektor.
[iv]Vgl. dazu z.B. die Ausführungen von Ulrich Herb (2018).
[v]Vgl. dazu auch die Ausführungen von Angela Holzer (2022). Sie ist Mitglied der Gruppe „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme” bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und Ansprechpartnerin des Allianz-Schwerpunkts „Digitalität“ Steuerungsgremium.
[vi]Dass die Preise, die hierbei von den Verlagen verlangt werden, weit jenseits klassischer Abonnements liegen, belegt beispielsweise Holzer (2022). Sie schreibt: „Selbst zahlungskräftige Einrichtungen wie die Harvard University waren im Zuge der Zeitschriftenkrise nicht mehr in der Lage, die Kosten für den Zugang zu wissenschaftlicher Information zu tragen“ (ebd., 167).
[vii]Zu den verschiedenen Varianten des Open Access vgl. die Erläuterungen des open-access.network unter: https://open-access.network/informieren/open-access-grundlagen/open-access-gruen-und-gold, eingesehen am 27.11.2024.
[viii]Für eine Übersicht der Bandbreite der hier aufgerufenen Kosten vgl. https://treemaps.openapc.net/apcdata/openapc/journal, eingesehen 28.11.2024. Für eine kritische Einordnung dieser Kosten vgl. die Ausführungen von Drößler (2022), der als Open-Access-Beauftragter an der Universitätsbibliothek Stuttgart tätig ist.
[ix]Dass in diesem Zusammenhang das Potential für die Generierung einer ganzen Bandbreite neuer Kostenarten auf Seiten der Verlage möglich wird, macht Lisa-Marie Stein (i.E.) aus dem Projekt „openCost“ geltend, vgl. auch https://www.opencost.de/, eingesehen am 27.11.2024.
[x]Für Erläuterungen der Funktionsweise dieser Indices sowie deren kritische Betrachtung (vgl. Andersen 2019; Mößner 2024).
[xi]Datenbanken, die derzeit diese Aufgabe bewältigen können sind Scopus (https://www.scopus.com/, eingesehen am 28.11.2024) des Konzerns Elsevier, Web of Science (https://clarivate.com/academia-government/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-referencing/web-of-science/, eingesehen am 28.11.2024) des Unternehmens Clarivate und Dimensions (https://app.dimensions.ai/discover/publication, eingesehen am 28.11.2024) von Digital Science & Research Solutions Ltd.
[xii]Zu den verschiedenen technischen Möglichkeiten des Datentrackings, von denen das beschriebene Profiling auf den Plattformen der Oligopolisten eine Variante darstellt, (vgl. Altschaffel et al. 2024).
[xiii]Vgl. dazu u.a. die Ausführungen von (Brembs et al. 2020; Lamdan 2023; Mößner 2022a; 2022b; Siems 2021).
[xiv]Vgl. https://stoptrackingscience.eu/, eingesehen am 28.11.2024.
[xv]Für eine Erläuterung dieser Unternehmungsstrukturen (vgl. z.B. Lamdan 2023; Retzlaff 2022). Lamdan spricht in diesem Zusammenhang auch von „data cartels“.
[xvi]Vgl. dazu z.B. das Angebot des Fachinformationsdienstes Philosophie (FID) (Eggert 2024).
[xvii]Dass diese Gleichsetzung nicht zulässig ist, wurde mehrfach in der Forschung betont (vgl. z.B. Deutsche Forschungsgemeinschaft, AG Publikationswesen 2022; Mößner 2024; Retzlaff 2022)
[xviii]Björn Brembs et al. (2023) ergänzen die angeführten Punkte noch um die Replikationskrise sowie die schon angesprochene Trackingkrise, zu letzterer vgl. auch die Beiträge in der Auskoppelung „Wissenschaftler-Tracking“ des Jahrbuchs für Technikphilosophie unter https://jtphil.de/?page_id=5, eingesehen am 03.12.2024.
[xix]Ein Tagungsbericht wurde in den Mitteilungen der DGPhil Nr. 62 (Winter 2023) veröffentlicht (https://tinyurl.com/33rj4f35, eingesehen am 04.12.2024).