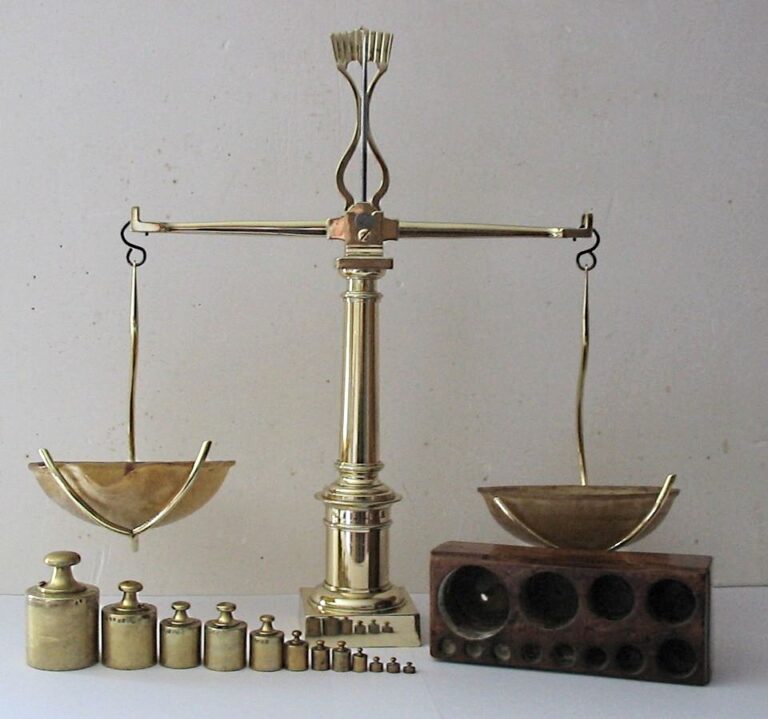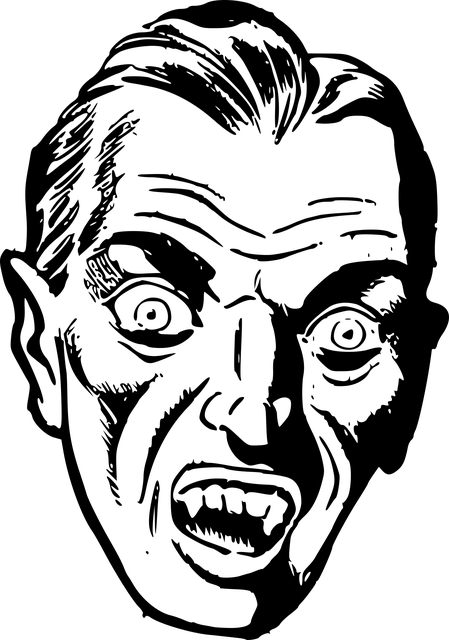
Sinners: Was ein Vampirfilm über den Humanismus verrät
Von Christoph Henning (University for Humanistic Studies Utrecht)
Spoiler alert!
Der Film Sinners will uns etwas sagen, und zwar auf vielen Ebenen. Oder vielmehr, er lässt sich auf verschiedene Weisen lesen. Es ist ein Film über eine schwarze Gemeinschaft irgendwo im Süden der USA, die um 1930 mit guter Musik ausgelassen feiern und dabei von weißen Vampiren angegriffen werden, die fast alle töten oder verwandeln. Es geht zunächst um Unterschiede: schwarz gegen weiß, lebendig gegen tot, gut gegen böse, Rationalität gegen Zauber usw. Aber es ist nicht so, dass einfach eine Seite gewinnt, sondern der Film bringt uns, wie jeder gute Film, zum Nachdenken. Ich möchte ihn hier aus einer humanistischen Perspektive verstehen und prüfen, was er uns hier zu sagen hat.
Geht es um Kapitalismuskritik?
Es gibt zunächst eine interessante und naheliegende Interpretationsperspektive: Vampirfilme transportieren häufig eine Kapitalismuskritik (dazu Henning 2010, 2018): Obwohl Vampire zunächst aussehen wie Aristokraten (sie leben in Schlössern, arbeiten nicht, haben seltsame Gewohnheiten – tagsüber schlafen, nachts feiern, und saugen das Blut ihrer Untergebenen auf eine direkte und gewaltsame Weise aus, nicht vermittelt über Verträge, sondern ganz persönlich), hat er doch in neueren Filmen mehr und mehr die Gestalt des Kapitals angenommen. Nicht nur saugt er die Kraft der Menschen aus (was sich als abgepresster Mehrwert lesen lässt), er ist auch selbst eigentlich tot und wird nur durch die Zufuhr von abgepresstem Leben wiederbelebt – wie das Kapital, das Marx als „tote Arbeit“ begreift, die stets aufs Neue durch ‚lebendige Arbeit‘ belegt werden muss, und dabei „unersättlich“ ist im Abpressen von Mehrwert (also eigentlich: Arbeitszeit und damit Lebenskraft), eben wie ein Vampir. Häufig sind Vampire in neueren Vampirfilmen auch gut organisiert und treten in Nadelstreifenanzügen auf, wie Banker, Manager oder Berater.
In diesem Film lassen sich dafür ebenfalls Hinweise finden: So wird der Vampir für seine Opfer deswegen interessant, weil er ‚echtes‘ Geld mitbringt (anders als die Gutscheine, mit denen sich die schwarzen Landarbeiter gegenseitig auszahlen). Aber es ist doch ein merkwürdiger Repräsentant des Kapitals: das Geld, das er hat, ist vorkapitalistisch (es sind uralte Goldmünzen), und obwohl weiß, ist er doch kein Nadelstreifen-Kapitalist, sondern im Grunde ein irischer Landarbeiter – also ebenfalls ein Geknechteter. In den USA des 19. Jahrhundert galten Iren keineswegs als ‚weiß‘, und es gibt sogar einen Moment der ‚Solidarität‘ mit den Opfern, als der Vampir verrät, dass der ortsansässige KuKluxClan vorhat, alle feiernden Schwarzen zu ermorden. Andererseits werden die Opfer selbst organisiert von einem – wenn auch kriminellen – unternehmerischen Bruderpaar, das die ganze Feier als kommerziellen Event organisiert. Die ökonomische Kapitalismuskritik wird also aufgerufen, aber steht nicht im Zentrum des Geschehens.
Geht es um Postkolonialismus?
Weit augenfälliger ist daher zunächst die ethnische oder anti-rassistische Ebene: Offensichtlich spielt der Rassismus in den USA dieser Zeit eine besonders große Rolle: Die schwarze Gemeinschaft im Süden der USA, die nicht mehr versklavt ist, aber immer noch auf Baumwollfeldern und unter sehr schlechten Bedingungen arbeitet, schirmt sich zu ihrem eigenen Schutz so gut es geht gegen die Weißen ab (symbolisch dafür ist im späteren Verlauf der massige Türsteher, ein alter Baumwollarbeiter), während die wenigen Weißen, die man überhaupt zu sehen bekommt, fast durchgehend Rassisten sind (die einzige weiß gelesene Person, die Zugang zur Feier erhält, ist eine alte Freundin, die ‚zur Familie‘ gehört und tatsächlich mit einigen Protagonisten verwandt zu sein behauptet). Was für eine Botschaft wird damit gesendet? Auf der einen Seite wird hier auf großartige Weise die Differenz gefeiert – im wahrsten Sinne: Die schwarze Kultur Amerikas hat einen grandiosen und ekstatischen Auftritt in dem wilden Tanz, in dem sich afrikanische Vorfahren, afro-futurische Space-Musiker und Hip-Hop in kollektiver Ekstase mit dem Blues verbinden. Dagegen kommt, ebenso großartig, auch die Musik der weißen Einwanderer zu Gehör, in diesem Fall durch die irisch klingende Bluegrass und Folk-Musik der weißen Vampire. Beide Musiken klingen grandios.
Auf der anderen Seite hat auch die Verbindung, die es zwischen verschiedenen Kulturgruppen gibt, einen Auftritt, und zwar auf doppelte Weise. Zum einen ist die Musik selbst etwas, das eine verbindenden Kraft hat – die Weißen werden vom schwarzen Blues angelockt, und die Schwarzen können dem Bluegrass durchaus etwas abgewinnen. Und zum anderen wird gerade auch die normative Idee einer Verbindung zwischen Kulturen thematisiert: Gleichheit, Verbundenheit, eine große Familie sein können über Unterschiede hinweg, diese Ideen kommen deutlich zu Sprache.
Nun kommt allerdings der eigentliche Witz: diese frohe Botschaft der Verständigung und des Ausgleichs wird von der Seite des radikal Bösen ausgesprochen: es sind die weißen Vampire (die damit in einem doppelten Sinne übermächtig sind), die versuchen, sich mit einer solchen Botschaft Zugang zur Feier der Schwarzen zu verschaffen: ‚Seht her, wir machen auch Musik, das ist doch eine Verbindung! Und sehr, wir sind auch Menschen, wir sind doch alle gleich und sollten uns nicht in Lager verschließen.‘ Aber allzu deutlich ist in diesem Film, dass dieser Botschaft nicht zu trauen ist, es ist ein durchsichtiger Trick der Weißen, sich Zugang zur Kultur und zu den Körpern der Schwarzen zu verschaffen und diese auf der Stelle auszusaugen. Sobald das geschehen ist und die Opfer als Vampire wiedererwachen, gibt es nur noch weiße Musik – keine gemischte „Weltmusik“ etwa, im Sinne einer hegelschen Synthese oder neu-materialistischen Assemblage, sondern die wachsende Zahl der Vampirisierten wird, wenn nicht alles täuscht, einfach in die weiße Kultur hineinvampirisiert. Das klingt zunächst nach klassischer Blaxploitation.
Das Verstörende daran ist nun, und darin wird der Film wieder ambivalenter, dass die vermeintlichen Opfer eigentlich sehr zufrieden aussehen. Sie machen Musik miteinander auf hohem Niveau, und in einem erstaunlich philosophischen Dialog versuchen die Vampire, die verbliebenden Menschen von ihrer höheren Moral zu überzeugen: ‚Sieh doch, nur auf dieser Seite gibt es echte Freiheit, gibt es Gleichheit und sogar Unsterblichkeit.‘ Hinzu kommt, dass sich tatsächlich Verwandte oder Liebende auf beiden Seiten finden, so dass ein Lagerdenken tatsächlich als altbacken erscheint. Das ist eine ingeniöse Vorwegnahme seitens der Filmemacher: den Vorwurf des Kulturessentialismus, den dieser Film vielleicht erwarten darf, wird im Film von der verbleibenden Gruppe der Menschen vertreten und sieht dort streckenweise etwas traurig und wie auf verlorenem Posten aus. Aber zugleich wird auf diese Weise der Gegen-Vorwurf des Vampirismus an die Kritiker weitergeleitet: wer im Sinne der Hybride, der Übergegensätzlichkeit denkt, hat vielleicht ebenso wie die Vampire eine ausbeuterische Absicht und spricht aus einer Position der Macht heraus und damit ideologisch.
Es geht um den Humanismus
Aber genau hier möchte ich die Frage stellen: Ist diese – wir könnten sagen: postkolonialistische – Lesart des Filmes die einzig mögliche? Will er wirklich die Idee visualisieren, dass Ideen von Universalismus und Verständigung stets zu misstrauen ist, dass sie nur Vorwände sind, um eine Kultur zu brechen und auf diese Weise nur die Dominanz der Weißen zu verschleiern? Jeder Anspruch auf Universalismus ist nur ein verdeckter Angriff der Privilegierten? Klar ist, dass – ebenso wie der die Kapitalismuskritik – auch diese Kritikschiene in diesem Film aufgerufen wird. Ich denke aber nicht, dass sich der Film darauf festlegen lässt.
Denn es gibt Momente, die in eine andere Richtung weisen. Zum einen ist die Frage, ob der Vampirismus wirklich essentiell weiß ist. Die Verkörperung durch einen Iren stellt das ansatzweise in Frage – die Iren gehören zu den Opfern einer langen Kolonialpolitik seitens Englands und wurden lange nicht als ‚weiß‘ wahrgenommen. Zudem ist die Begeisterung für die Vampir-Kultur zu glaubhaft dargestellt, als dass man sie einfach als einen falschen Zauber abwerten könnte: Die Versuchung, auf diese Weise gleich zu werden, ist tatsächlich stark und nicht einfach nur ‚Lüge‘. Sie ist klar mit einer Ausbeutungspraxis verbunden, das ist überdeutlich, aber trotzdem für viele im Film attraktiv. Man muss nur auf der richtigen Seite stehen: Nicht bluten, sondern bluten lassen. (Das nun wieder kann man als Kapitalismuskritik lesen, aber eine, die nicht mehr ethnisch nur an einzelne Gruppen adressiert wird.)
Es gibt weitere Momente, die eine alternative Lesart nahelegen. Denn nicht nur die weißen Vampire haben ihren Zauber, sondern auch die Schwarzen Nicht-Vampire haben einen, auch wenn er streckenweise nur schwach zu sein scheint. Er wirkt, wie sich mehrfach zeigt, verdeckter, aber ist doch da. Dafür müssen wir noch einmal auf die Helden des Films schauen. Es gibt zwei Helden in diesem Film. Beide sind deswegen Helden, weil sie nicht klar einer Seite zuzurechnen sind. Beide gehen auf Ihre Weise einen besonderen Weg: der junge schwarze Gitarrist, der mit seiner Blues-Musik die bösen Geister allererst beschworen hat, aber als einer der wenigen überlebt, lässt sich trotz der Katastrophe nicht davon abbringen, von diesem Zauber zu lassen. Er findet offensichtlich einen Weg, ihn in sein Leben zu integrieren, ohne die bösen Geister wieder zu beschwören.
Der andere Held ist, wie sich am Ende zeigt, einer der beiden schwarzen Unternehmer-Brüder, der durch die Liebe seines sterbenden Menschen-Bruders das Desaster überlebt hat. Die Bruderliebe besiegt die Grenze zwischen Tod und Leben, zwischen Vampir und Mensch, vermutlich durch den Einfluss des unscheinbaren schwarzen Zaubers – ist das nicht eine humanistische Nachricht? Dieser überlebende schwarze Vampir-Bruder hat ebenfalls einen erstaunlichen Weg gefunden. Er schafft es, vampirisiert weiterzuleben und trotzdem auf eindrückliche Weise schwarz und stolz zu sein, auch wenn das nur ansatzweise aufscheint. Er schafft es damit, ebenso wie der Musiker, sich nicht vom Vampirismus auffressen zu lassen – er hat, wie am Ende deutlich wird, seinem sterbenden Bruder versprochen, den Musiker am Leben zu lassen. Zugleich scheint er damit schwarze Kulturelemente ‚aufgehoben‘ zu haben.
Das Aufeinandertreffen dieser beiden Helden macht dies am Ende klar: Beide geben sich zu verstehen, dass die Nacht des schwarzen Zaubers zu ihren schönsten gehörte. Aber es blieb ein Traum, das Leben in abgetrennten Vierteln ist keine echte Option (weil es böse Geister heraufbeschwört, gleich auf doppelte Weise: als Geld-Vampir oder als Ku-Klux-Klan). Das wird mit Melancholie akzeptiert. Doch haben beide Wege gefunden, den bösen Geist zu integrieren, ohne sich von ihm auffressen zu lassen. (Vielleicht kann man von einer kulturellen Gegen-Aneignung sprechen.) Der überlebende Bruder ist auf glaubhafte Weise schwarz, obwohl er vom weißen Vampir gebissen wurde; der Musiker spielt weiter seine Monster-Magnet Gitarre und hat dennoch Jahrzehnte in Frieden verlebt. Es scheint also einen dritten Weg zu geben. Zwischen diesen beiden Helden gibt es natürlich eine Macht-Asymmetrie: Der Vampir verschont sein Opfer, aber sie stehen nicht auf gleicher Stufe. Doch es scheint doch ein Einverständnis zu geben.
Das können wir abschließend wieder auf den Kapitalismus zurückbeziehen. Denn was dafür nötig ist, ist Mäßigung – ich muss Versprechen halten können, Menschen am Leben lassen, einen Weg ohne Desaster finden (das erinnert fern an die zivilisierten Vampir-Familie Cullen aus Twilight). Der Geist darf aus der Flasche, aber nicht die Macht über mich übernehmen; er soll mir dienen, nicht ich ihm. Mit dem Kapitalismus kann man leben, so scheint die Botschaft zu sein, wenn man sich nicht von ihm ‚auffressen‘ lässt. Das schaffen nur wenige. Aber gelingt es, dann winkt eine Solidarität über Grenzen hinweg, wenn man will: ein Universalismus, der nicht gepredigt, sondern gelebt wird. Er wird erst toxisch, wenn er sich mit der Absicht zur Ausbeutung verbindet. Man braucht für diese Solidarität allerdings Türsteher (das ist vielleicht der dritte, tragische Held des Filmes), um der Ausbeutung die Tür zu weisen. Denn sie ist, die am Ende alles verdorben hat und besser draußen bleibt, aller Sirenenklänge zum Trotz. Diese Botschaft ist erstaunlich.
Christoph Henning, Chair of Philosophy and Humanism an der University for Humanistic Studies Utrecht. Zuvor arbeitete er an der Universitaet St. Gallen, am Max Weber Kolleg der Universitaet Erfurt, an der Zeppelin University und an der TU Dresden. Er befasst sich mit politischer Philosophie, Ideengeschichte, Naturphilosophie und Aesthetik.
Christoph Henning: Vampire sind unter uns! Zum Wandel eines Genres. Filmbulletin: Kino in Augenhöhe 11/2010
Christoph Henning: Marx und die Monster des Marktes: Kleine Philosophische Bilderkunde. In: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 3/2018, 353-374