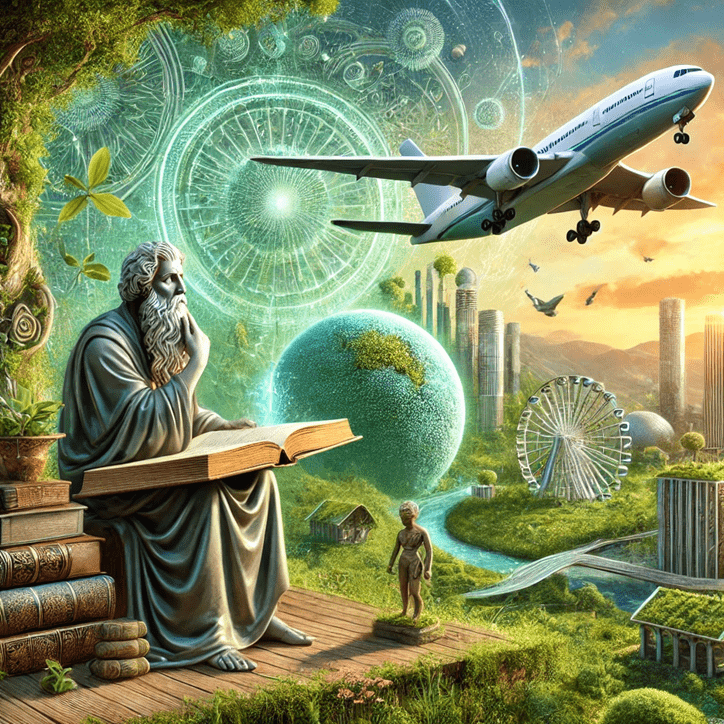Landschaftsveränderungen ästhetisch beurteilen. Analyse zweier aktueller Vorschläge
Von Kira Meyer (Kiel)
Anhand welcher Kriterien sollte eine ästhetische Beurteilung von möglichen oder tatsächlichen Landschaftsveränderungen, beispielsweise im Rahmen der Energiewende, vorgenommen werden? Zwei aktuelle Vorschläge für solche Kriterien möchte ich im Folgenden analysieren und kritisch reflektieren: Erstens die Idee von Landschaften als materiellen Sinnhorizonten (Braun 2023) sowie zweitens den Vorschlag von Landschaften als “units of sense” (Siani 2024).
Weitere Vorschläge zur Beurteilung von Landschaften und möglichen Eingriffen in diese aus ästhetischer Perspektive, wie denjenigen, die spezifischen Charakteristika einer Landschaft mithilfe der Methode des “Landscape Character Assessment” (Tudor 2014; Schmidt et al. 2018b, 2018a) zu eruieren, lasse ich aus Platzgründen außer Acht. Neben den hier diskutierten ästhetischen Kriterien für die Beurteilung von Eingriffen in Landschaften sind zudem ohne Frage noch weitere Erwägungen wichtig, insbesondere Fragen der Ökologie sowie Fragen der Effizienz (Barsch et al. 2002). Die Abwägung dieser unterschiedlichen Argumente ist komplex und muss andernorts erfolgen. Dabei wären weitere Disziplinen neben der Philosophie, allen voran die Landschaftsökologie wie auch die Landschaftsarchitektur, zu inkludieren.
Ich setze im Folgenden voraus, dassästhetische Argumente als eudaimonistisch-intrinsische Argumente (vgl. Krebs 1997; Ott 2016) auch im Landschafts- und Energiediskurs ernstgenommen werden sollten – was mit Blick sowohl auf verwaltungsrechtliche Planungsverfahren, als auch auf den akademischen Diskurs über Landschaften, Landschaftsarchitektur und -planung sowie Renaturierung keinesfalls selbstverständlich ist.
Materielle Sinnhorizonte
In seinem Buch Klimaverantwortung und Energiekonflikte argumentiert Florian Braun, unter Rückgriff auf eine Idee von Sören Schöbel-Rutschmann, dafür, dass wir Landschaftsbilder “als in Materie gegossene Sinnhorizonte” auffassen sollten (Braun 2023, 334). Dabei geht Braun von der Annahme aus, dass eine Verobjektivierung von Landschaften oder deren ästhetischen Qualitäten der falsche Weg ist (vgl. Braun 2023, 335). Es könne also nicht rein objektiv bestimmt werden, was ein passender Sinnhorizont für eine bestimmte Landschaft wäre. Allerdings seien ästhetische Urteile einerseits an “authentizitätsprägend[e]”, andererseits an “gemeinsinnbezogen[e] Orientierung zurückgebunden” (Braun 2023, 336). In diesen lokalen Kontexten besitzen ästhetische Urteile also zwei Dimensionen: (1) Eine intrasubjektive sowie (2) eine intersubjektive.
Der authentizitätsprägenden Orientierung zufolge sollen die Inhalte ästhetischer Argumente “als zentrales Bedeutungsmoment des Selbst – als ‘jemeinig’ – empfunden” werden können (Braun 2023, 179), also einer “ernsthafte[n] intrasubjektive[n] Prüfung vor dem Hintergrund” der eigenen Konzeptionen des guten Lebens standhalten können (Braun 2023, 178) und “wie ein Puzzlestück in die Reihe der persönlichen Erfahrungen und Überzeugungen” passen (Braun 2023, 340).[1] Das zweite Kriterium, nämlich die gemeinsinnbezogene Orientierung, zielt darauf ab, eine “tragfähige Verbindung mit dem lokalen Kulturnarrativ” und “tradierten Handlungspotenzial[n] einer Region” aufzubauen (Braun 2023, 338). Das können zum Beispiel das lokale Selbstverständnis als Waldgemeinde und der dafür wichtigen Rolle des Holzes sein (Braun 2023, 338–39).
Die Vereinbarkeit des eigenen ästhetischen Urteils “mit den Urteilen der anderen innerhalb des narrativen Referenzkontextes” kann dabei als Maßstab dafür herangezogen werden, ob eine gemeinsinnbezogene Orientierung – und somit, ob das zweite Kriterium das ästhetischen Urteils – vorliegt. Wichtig dabei ist, dass es sich nicht nur passiv in die Reihen der Urteile der anderen einfügen kann, sondern darüber hinaus aktiv dem Pool der bestehenden ästhetischen Urteile und dem darauf fußenden Narrativ hinzugefügt wird (Braun 2023, 337) – wodurch sich das Narrativ wiederum verändert (Braun 2023, 340).
Zusammengenommen drückt ein landschaftsästhetisches Urteil laut Braun “den ganzheitlichen Schluss aus, inwiefern sich ein Projekt nicht nur aus individueller (ICHA), sondern ebenso aus der kulturell kollektiven Sichtweise in eine Region (WIRL) integriert oder eben nicht.“ (Braun 2023, 331) Dieser Schluss muss in einem mehrschrittigen Prozess der Abwägung und argumentativen Urteilsfindung erarbeitet werden und erfordert begriffliche Arbeit (vgl. Braun 2023, 340f.). Weil ästhetische Urteile zumeist stark in lokalen und regionalen Narrativen und Selbstverständnissen verankert seien, gebe es eine “umfassende rationale Dimension ästhetisch bedingten Urteils und Argumentierens” (Braun 2023, 344).
Ob beziehungsweise welche Form des Eingriffs in eine Landschaft als ästhetisch wertvoll gelten kann, hängt also Braun zufolge davon ab, ob der materielle Sinnhorizont, welche eine Landschaft nach einer Veränderung, wie beispielsweise der Installation von 20 Windkrafträdern, verkörpert stimmig ist – nicht nur mit Blick auf die individuellen Narrative und dem Authentizitätskriterium, sondern insbesondere auch hinsichtlich der lokal-regionalen Narrative und dem Gemeinsinnkriterium. Landschaftliche Zukunftsszenarien sollten anhand dieser Kriterien diskutiert, bewertet und gegebenenfalls realisiert werden.
“Units of sense”
Da sich Braun nicht vertieft damit beschäftigt, was als ästhetische Erfahrung gilt, welche Strukturmerkmale diese aufweisen oder worauf sich die ästhetischen Urteile beziehen, ist eine Ergänzung seiner Überlegungen mit denjenigen von Alberto L. Siani aus dessen neuem Buch Landscape Aesthetics vielversprechend. Siani versteht Landschaften, ganz ähnlich wie auch Braun, als „units of sense“ (Siani 2024, 25). Dieser Sinn entsteht ihm zufolge in einem dynamischen Prozess sowohl durch die Landschaft und ihrer materiellen Eigenschaften sowie Funktionen, als auch durch die wahrnehmenden Menschen und ihren jeweiligen Überzeugungen und Präferenzen (vgl. Siani 2024, 56). Der Sinn einer Landschaft ist also veränderlich, wenn auch nicht beliebig. Das “unifying principle” dieser Sinneinheiten ist ihm zufolge die Atmosphäre (bzw. „‘sense’ or ‘character’ (…) or ‘genius loci’ or ‘mood’” (Siani 2024, 162)) und insofern ein Phänomen, das erfahren werden ‚muss‘.
Da er einen weiten Begriff der Ästhetik anlegt und darin alle Erfahrungen, nicht bloß solche des Schönen oder der Kunst, inkludieren will (Siani 2024, 52), kann auch gesagt werden, dass ihm zufolge Landschaften überhaupt nur ästhetisch verstanden und beschrieben werden können. Bei Siani findet man also eine Auffassung von Ästhetik als Aisthetik, als Lehre der Wahrnehmungen – dabei kommt es auf die Beteiligung aller Sinne und die Interaktion und den Austausch zwischen Mensch(en) und seiner Umwelt an. Er geht also von einem sehr weiten Ästhetik-Begriff aus, der letztlich alle Wahrnehmungen als ästhetische versteht. Dabei heißt ästhetisch noch nicht notwendigerweise schön, weshalb damit auch keine Entleerung des Ästhetik-Begriffs einhergehen muss. Ästhetik kann ihm zufolge dabei helfen, “to unveil and make explicit elements and connections contained in the landscape (…), thus contributing to its sense-making and our ability to meaningfully inhabit it”(Siani 2024, 99). Er erläutert dies näher am Beispiel von Windkraftanlagen, die im Idealfall dazu dienen könnten, die Kraft des Windes, dessen Bedeutung für die lokale Imagination, Identität und Besinnung explizit zu machen und dadurch die Landschaft ‘zusammenzuhalten’ (ebd.).
Mit Brauns Vorschlag hat er die Konzeptionierung von Landschaften als Sinneinheiten gemeinsam. Darüber hinaus beschäftigt Siani sich eingehender mit Fragen der Ästhetik und legt dar, wie Landschaften atmosphärisch wahrgenommen werden und wie dies wiederum zu deren Bedeutungskonstitution beiträgt.
Doch eine Schwachstelle weist auch Sianis Ansatz noch auf: Die Wichtigkeit von individuellen Überzeugungen und Präferenzen für die Sinngebung von Landschaften lässt, ohne weiteres Kriterium wie zum Beispiel bei Braun die Rückbindung an das eigene authentische Selbstverständnis, einen sehr großen Spielraum zu. Um dies an einem Beispiel deutlich zu machen: Sofern jemand davon überzeugt ist, dass es dringlichere Aufgaben als den Klima- und Naturschutz gibt und er eine Präferenz für traditionell-szenische Landschaften ohne Störung durch moderne Erneuerbare-Energie-Anlagen hat, wäre eine Landschaft mit Windrädern für ihn kein geeigneter materieller Sinnhorizont, sondern eine ‘sinnlose’ Landschaft oder eine Landschaft, die einen verfehlten Sinn darstellt. Was an diesem Beispiel gezeigt werden soll: Der hohe Stellenwert von Präferenzen und Überzeugungen der Individuen macht es nötig, diesen noch stärker Beachtung zu schenken als Siani dies tut.
Wie kommen Präferenzen und Überzeugungen zustande? Welche Strukturen sind dabei besonders wirkmächtig und wie sind diese Strukturen zu bewerten? Sind alle Präferenzen und Überzeugungen legitim (z.B. auch die von Klimaleugner*innen, rechtsextremen Heimatschützer*innen, technikskeptischen Esoteriker*innen)? Mir scheint in dieser Hinsicht Brauns Ansatz vorzugswürdig, da er nicht nur individuelle Aspekte wie Präferenzen und Überzeugungen – die er mit dem Authentizitätskriterium beziehungsweise dem individuellen Narrativ abdeckt – sondern auch den kollektiven Aspekt des Gemeinsinns beziehungsweise des lokalen Narrativs dazu nimmt. Um das Problem der Beliebigkeit von individuellen Präferenzen und Überzeugungen zu beheben, müsste das Authentizitätskriterium in Brauns Ansatz jedoch noch weiter erläutert werden. Der Rückgriff auf Charles Taylors Authentizitätstheorie, auf die Braun auch kurz Bezug nimmt, könnte dabei hilfreich sein, da Taylor Authentizität an einen überindividuellen Wertehorizont zurückbindet wodurch ein Relativismus oder Narzissmus vermieden werden soll (Taylor 2017 [1995]). An dieser Stelle geht die Landschaftsästhetik über zur Sozialphilosophie.
Sowohl Braun, als auch Siani sind sich darin einig, dass es eine demokratische Deliberation darüber braucht, welche Landschaften wertvoll sind und das heißt welche Sinnhorizonte zukünftig gesellschaftlich gewünscht werden (vgl. Braun 2023, 346). In solche deliberative Aushandlungen sollten möglichst vielfältige Perspektiven und Stakeholder einbezogen werden (Siani 2024, 56–57). Damit diese deliberativen Aushandlungsprozesse funktionieren sind jedoch, wie Siani selbst zu bedenken gibt, “certain competences necessary” (Siani 2024, 57) – welche Kompetenzen das sind, lässt er allerdings offen. In dieser Hinsicht kommt man von der Landschaftsästhetik zur Kommunikationsethik und Fragen der deliberativen Demokratie.[2]
Kira Meyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Philosophischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Umweltethik, Politische Philosophie und Ökophänomenologie. Kira Meyer ist Mitglied der AG Nachhaltigkeit der GAP und der DGPhil. Mehr über Ihre Arbeit findet sich auf ihrer Website: https://kirameyer.weebly.com/.
[1] Das authentizitätsprägende Kriterium sollte allerdings nicht als ethisches Kriterium gedeutet werden. Denn in dem Buch geht es um die Modellierung ästhetischer Urteile auf lokaler Ebene, wohingegen ethische Kriterien einen universellen Geltungsanspruch verfolgen. Zwar haben die ästhetischen Urteile einen intersubjektiven Anspruch im regionalen Bereich und besitzen als Prämissen einen starken Einfluss in ethischen Argumenten vieler Bürger:innen – aber sie sind keine Substitute vollumfänglicher ethischer Urteile, die sich am Gemeinsinn der Menschheit an sich orientieren.
[2] Ich danke Florian Braun für intensive Diskussionen über seinen Ansatz, von denen nicht nur der vorliegende Text überaus profitiert hat. Ebenso danke ich Karen Koch für die kritisch-konstruktive redaktionelle Überarbeitung des Artikels.
Literaturverzeichnis
Barsch, Heiner / Bastian, Olaf / Beierkuhnlein, Carl / Bosshard, Andreas / Breuste, Jürgen & Klötzli, Frank / Otl, Konrad / Tress, Bärbel / Tress, Gunther / Wiland, Ulrike. (2002). Application of landscape ecology. In: Bastian, Olaf / Steinhardt, Uta / Naveh, Zev: Development and Perspectives of Landscape Ecology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishing, 307-432.
Braun, Florian. 2023. Klimaverantwortung und Energiekonflikte: Eine Argumentationsanalyse von Abwägungen zu Windkraftanlagen. 1. Auflage. Wissenschafts- und Technikforschung 23. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-3027446.
Krebs, Angelika. 1997. „Naturethik im Überblick.“ In Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, hrsg. von Angelika Krebs, 337–79. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Ott, Konrad. 2016. „On the Meaning of Eudemonic Arguments for a Deep Anthropocentric Environmental Ethics.“ New German Critique 43 (2 (128)): 105–26. https://doi.org/10.1215/0094033X-3511895.
Schmidt, C., M. Gagern, M. Lachor, G. Hage, L. Schuster, A. Hoppenstedt, O. Kühne et al. 2018a. Landschaftsbild und Energiewende: Forschungsvorhaben im Auftrag des BfN. Band 1. 2 Bände. Dresden. https://www.bfn.de/sites/default/files/2022-04/landschaftsbildundenergiewende_band1_nbf.pdf.
Schmidt, C., M. Gagern, M. Lachor, G. Hage, L. Schuster, A. Hoppenstedt, O. Kühne et al. 2018b. Landschaftsbild und Energiewende: Forschungsvorhaben im Auftrag des BfN. Band 2. Dresden. https://www.bfn.de/sites/default/files/2022-04/landschaftsbildundenergiewende_band2_nbf.pdf.
Siani, Alberto L. 2024. Landscape aesthetics: Toward an engaged ecology. New York: Columbia University Press.
Taylor, Charles. 2017 [1995]. Das Unbehagen an der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Tudor, Christine. 2014. „An Approach to Landscape Character Assessment.“ Unveröffentlichtes Manuskript. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5aabd31340f0b64ab4b7576e/landscape-character-assessment.pdf.