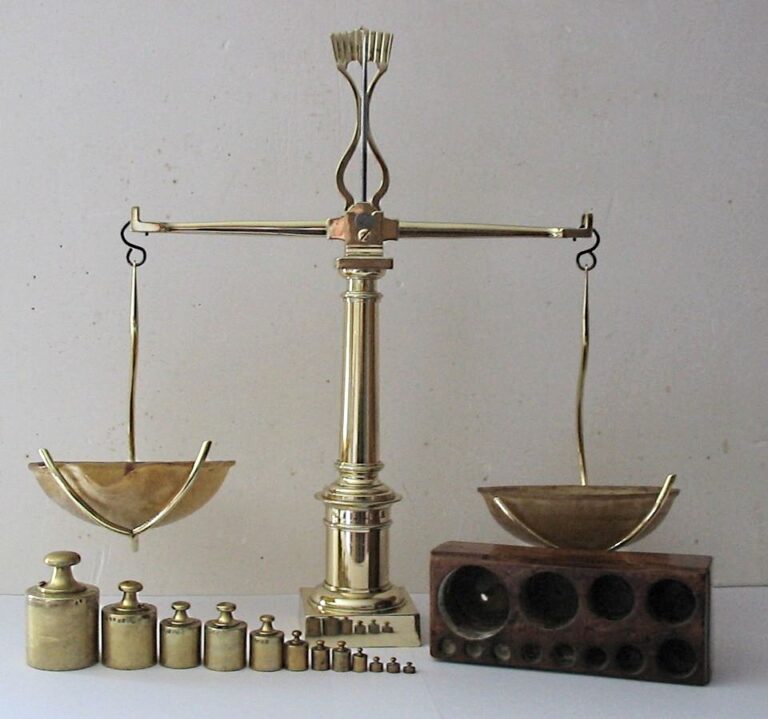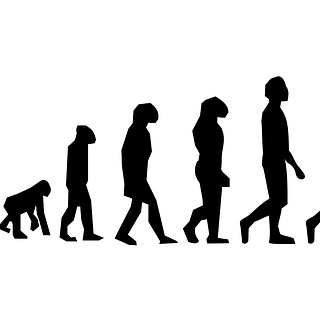
Menschsein im Fluss – Reflexion über ein Konzept im Wandel
Von David Jost (Bonn)
Als 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) verabschiedet wurde, war dies eine direkte Reaktion auf die unfassbaren Gräueltaten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Um derartiges Unrecht künftig zu verhindern, wurde ein Katalog universeller Rechte geschaffen, der für alle Menschen – jederzeit und überall – Geltung beansprucht. Zudem werden in der AEMR bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten dargelegt, die allen Menschen zugesprochen werden: etwa Würde, Vernunft und Gewissen. Eine klare Definition dessen, wer unter den Begriff Mensch fällt und damit Anspruch auf diese Rechte hat, findet man jedoch nicht. Bislang war eine solche Festlegung offenbar nicht notwendig, da sich in unserer Gesellschaft ein implizites Menschenbild etabliert hat, das den Begriff Mensch – und die damit verbundenen Menschenrechte – auf alle Mitglieder der biologischen Spezies Homo sapiens bezieht. Ein Blick in die Geschichte zeigt allerdings, dass dieses Verständnis keineswegs selbstverständlich ist. Das Konzept Mensch war nie statisch – er wurde immer wieder ausgeweitet und neu gedacht. Es ist gut möglich, dass auch unser heutiges Menschenbild bald auf den Prüfstand steht und ausgeweitet werden muss.
Menschenbilder im historischen Wandel
Wie Felipe Fernández-Armesto in So You Think You’re Human? (2009) verdeutlicht, ist es ein relativ neues Phänomen, dass Menschen sich auf Basis einer biologischen Systematik kategorial von Tieren abgrenzen. Mit der Einordnung als Spezies Homo sapiens gehen Zuschreibungen bestimmter Eigenschaften und Fähigkeiten einher, durch die sich der Mensch nicht nur von anderen Entitäten abgrenzt, sondern sich auch eine Sonderstellung zuschreibt. Dieses Verständnis vom Menschen hat sich über einen längeren Prozess herausgebildet und ist mittlerweile fest in unserer Gesellschaft verankert. Die Geschichte belegt jedoch, dass dieses Menschenbild keine Selbstverständlichkeit ist. Über den größten Zeitraum der Menschheitsgeschichte stellte sich die Frage nicht, was die Spezies Homo sapiens von anderen Entitäten unterscheidet. Unsere Vorfahren ordneten sich selbstverständlich in das Tierreich ein, wobei vor allem die Zugehörigkeit zu einer abgegrenzten sozialen Gruppe eine wichtige Rolle spielte. Menschsein ließ sich folglich darauf reduzieren, Mitglied einer bestimmten Gruppe zu sein. Dabei wird anhand verschiedener Beispiele wie Belege zu prachtvollen Tiergräbern, tierähnlichen Götterdarstellungen sowie dem Totemismus deutlich, dass auch bestimmte Tiere als vollwertige Mitglieder einer abgegrenzten Gruppe anerkannt wurden oder ihnen gar eine Sonderstellung zugesprochen wurde. Ebenso könnten auch nicht sichtbare Entitäten wie z. B. Geister oder Ahnen als Gruppenmitglieder gegolten haben. Hingegen wurden Vertreter der Gattung Homo sapiens, die kein Teil der eigenen Gruppe waren, nicht als Menschen gesehen. Sie fielen – wie viele andere Tiere und Entitäten – nicht in den moralischen Achtungsbereich der abgegrenzten Gruppe.[1]
Ein weiteres Beispiel, das verdeutlich, dass unser heutiges Menschenbild keineswegs selbstverständlich ist, findet man im Zusammenhang mit der spanischen Konquistador, die im 16. Jahrhundert im Zuge der Eroberung Amerikas stattfand. Als die ersten Konquistadoren nach Amerika kamen, wurden die dort lebenden Homo sapiens zum Teil nicht als (vollwertige) Menschen anerkannt, da ihre Lebensweisen nicht mit den bei den Konquistadoren verbreiteten Überzeugungen übereinstimmten, wie sich Menschen normalerweise verhalten (sollen). Die Konquistadoren hätten ihre bisherigen Vorstellungen über den Menschen hinterfragen müssen, um die fremden Wesen als Menschen anzuerkennen. Wie die Geschichte zeigt, gelang dies nicht allen.[2] Zwischen einigen Konquistadoren und Vertretern der Kirche kam es zu heftigen Auseinandersetzungen darüber, ob es sich bei den dort lebenden Wesen um Menschen handelt und ob sie folglich eine Seele haben. Wie aus der Geschichte bekannt ist, hat sich (auch aus rassistischen Motiven) die Überzeugung durchgesetzt, es handle sich um keine vollwertigen Menschen. Dementsprechend wurde es als legitim angesehen, die indigenen Menschen auszubeuten und ihnen ihr Land weg zu nehmen.[3] Auch im Zusammenhang mit den rassistischen Menschenbildern, die sich im Zuge des Kolonialismus in Europa ausbreiteten, wird deutlich, dass Vertreter der Gattung Homo sapiens aufgrund körperlicher und kultureller Unterschiede in verschiedene Grade des Menschseins eingeteilt wurden.[4] Es lässt sich vielfach belegen, dass bestimmten Vertretern der Gattung Homo sapiens im gesellschaftlich dominanten Menschenbild Europas die Anerkennung als vollwertige Mitglieder verwehrt blieb.
Das moderne Menschenbild
Heute besteht ein fester Konsens darüber, dass alle Mitglieder der biologischen Spezies Homo sapiens als (vollwertige) Menschen zu betrachten sind. Diese Auffassung ist mittlerweile so tief in unseren gesellschaftlichen Überzeugungen verankert, dass man sich nicht einmal bei der Darlegung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Mühe machte, dies explizit hervorzuheben. Zugleich sind mit der AEMR implizite Vorstellungen darüber verbunden, wie Menschen (als Homo sapiens) sind bzw. wie sie sein sollen. Das dahinterliegende Menschenbild umfasst weltweite Gültigkeit und enthält Annahmen, die auf alle Mitglieder der Gattung Homo sapiens zutreffen. So wird unter anderem davon ausgegangen, dass alle Menschen zwar individuelle Unterschiede aufweisen, ihnen jedoch die gleiche angeborene absolute Würde sowie fundamentale Rechte zukommen, die es zu schützen gilt. Menschen haben somit ein Recht darauf, dass andere mit ihnen auf eine achtsame und respektvolle Weise umgehen. Außerdem werden allen Menschen drei fundamentale Fähigkeiten zugesprochen, die sie ausbilden und auf richtige Weise einsetzen sollen, nämlich Freiheit, Vernunft und Gewissen. Aufgrund dieser Fähigkeiten wird der Mensch als ein zur Selbstbestimmung fähiges Wesen aufgefasst.[5]
Auch wenn sich die Grundüberzeugung festgesetzt hat, dass der Begriff Mensch und folglich die Menschenrechte auf die Vertreter der Gattung Homo sapiens begrenzt sind, stellen uns doch einige filmische und literarische Figuren auf die Probe und bringen uns dazu, über das Konzept Mensch nachzudenken. Exemplarisch wird dies an Figuren wie Graf Dracula deutlich. Graf Dracula ernährt sich zwar von menschlichem Blut, doch weist er eine menschliche Gestalt auf und ist bis zu einem gewissen Grad zu vernünftigem sowie begründetem Denken in der Lage. In einer Menschenmenge würde er nicht herausstechen. Ebenso weisen auch anthropomorphisierte Tierfiguren in Animationsfilmen menschenähnliche Merkmale auf und regen dazu an, den Begriff Mensch aus einer anderen Perspektive zu betrachten. In Zukunft könnten solche Überlegungen nicht nur auf einer fiktiven Ebene stattfinden, sondern eine zentrale Rolle im künftigen Zusammenleben spielen.
Ein Blick in eine mögliche Zukunft – Die Wiederauferstehung des Neandertalers
Wer im Neanderthal Museum nahe Düsseldorf die Treppe hinaufblickt, dem sticht sofort ein Mann ins Auge, der lässig am Geländer lehnt. Er trägt einen Anzug, weiße Sneakers und hat einen modernen Haarschnitt. Man könnte ihn problemlos für einen ganz normalen Museumsbesucher halten, der die Ausstellung auf sich wirken lässt. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass der Mann ungewöhnlich klein ist und seine Gesichtszüge etwas eigenartig wirken. Der Blick auf ein Schild klärt auf: Es handelt sich um die Nachbildung eines Neandertalers, der mit modernen Attributen versehen wurde – sein Name: Mr. 4 Prozent. Die Illusion macht sichtbar, wie schwer es fällt den Homo sapiens und den vor 40.000 Jahren ausgestorbenen Homo neanderthalensis anhand äußerlicher Merkmale voneinander zu unterscheiden. Würde man einem Neandertaler auf der Straße begegnen, würde man ihn wohl kaum von einem Vertreter der Gattung Homo sapiens abgrenzen können, obwohl er streng genommen nicht in unser weithin geteiltes Menschenbild fällt.
Während der menschlichen Phylogenese lebten verschiedene Menschenarten über weite Zeiträume neben- und miteinander. Heute ist der Homo sapiens die einzige noch existierende Menschenart – ein Umstand, der als seltene Ausnahme betrachtet wird. DNA-Analysen heute lebender Menschen belegen, dass es zu sexuellen Begegnungen zwischen Angehörigen der Gattungen Homo sapiens und Homo neanderthalensis kam. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass das Erbgut heutiger eurasischer Homo sapiens zu ein bis vier Prozent aus Genen besteht, die von Neandertalern stammen. Lange Zeit herrschte die Meinung vor, dass es sich bei Neandertalern lediglich um stumme, „primitive“ Höhlenmenschen handelte. Mittlerweile gibt es jedoch immer mehr Belege dafür, dass sie nicht nur alle anatomischen, symbolbildenden und kognitiven Voraussetzungen zur Sprache aufwiesen, sondern auch ein komplexes kulturelles Gemeinschaftsleben hatten, das in manchen Teilen mit jenem des Homo sapiens verglichen werden kann. So stellten sie beispielsweise Schmuckstücke her, kümmerten sich um alte und kranke Gruppenmitglieder und bestatteten ihre Toten.[6]
In der aktuellen Neandertalerforschung sind Bestrebungen erkennbar, die bei einigen ein mulmiges Gefühl hervorrufen könnten. So gibt es Wissenschaftler:innen, die davon sprechen, den Homo neanderthalensis mittels wiederhergestellter Neandertaler-DNA zum Leben erwecken zu wollen. Bereits in der Diskussion darüber, ob ein solches Vorhaben moralisch vertretbar ist, stellt sich die Frage, ob wir Neandertaler als echte Menschen klassifizieren und unser Menschenbild ausweiten. Davon hängt ab, ob wir sie als (vollwertige) Menschen sehen, denen wir jene Rechte zugestehen, die derzeit lediglich den Vertretern der Gattung Homo sapiens vorbehalten sind. So betonen die Paläoanthropologin Silvana Condemi und der Journalist François Savatier in dem Buch Der Neandertaler, unser Bruder (2020), dass sie den Neandertaler als eigenständigen Menschen betrachten, „der folglich das Menschenrecht genießt, tot zu bleiben, wenn er einmal ausgestorben ist (210).“
Sollte man es eines Tages tatsächlich schaffen, einen Neandertaler wieder zum Leben zu erwecken, würde dies zwangsläufig eine Debatte darüber auslösen, ob Neandertaler ‚Mensch‘ genug sind, um als (vollwertige) Menschen anerkannt zu werden. Würde man ihm das volle Recht auf gesellschaftliche Teilhabe einräumen – inklusive Wahlrecht und der Freiheit, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben? Oder würde er doch eher als Mensch zweiter Klasse gelten und in Zoos ausgestellt werden? Auch wenn es sich bei dem vorliegenden Gedankenexperiment um ein rein theoretisches Konstrukt handelt, macht es doch in bemerkenswerter Weise deutlich, dass die Kategorie Mensch keine feststehende, naturgegebene Größe ist, sondern vielmehr ein historisch und kulturell wandelbares Konzept, das immer wieder neu ausgehandelt und interpretiert werden muss.
Dementsprechend lässt sich die Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein, nicht anhand eines feststehenden Katalogs an Eigenschaften beantworten. Erst im Laufe der Jahrhunderte kam es zu einer schrittweisen Ausweitung und Etablierung des heute weithin akzeptierten Menschenbildes – etwa durch die Abschaffung der Sklaverei, die Anerkennung indigener Rechte oder die Formulierung universaler Menschenrechte. Angesichts technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen könnte sich unser Verständnis von Menschsein auch künftig weiterentwickeln. Umso wichtiger ist es, sich kritisch mit früheren Formen der Ausgrenzung auseinanderzusetzen.
David Jost ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Philosophische Grundfragen der Theologie und Sozialphilosophie an der Universität Bonn.
[1] Siehe hierzu ausführlich Fernández-Armesto, Felipe 2009: So You Think You’re Human?, Oxford.
[2] Siehe hierzu Zichy, Michael 2021: Die Macht der Menschenbilder. Wie wir andere wahrnehmen, Ditzingen.
[3] Siehe hierzu ausführlich Huber: Die Konquistadoren. Cortés, Pizarro und die Eroberung Amerikas, München 2019.
[4] Siehe hierzu ausführlich Blanchard et al. (Hrsg.) 2012: MenschenZoos. Schaufenster der Unmenschlichkeit, Hamburg.
[5] Siehe hierzu Zichy, Michael 2017: Menschenbild und Menschenrechte, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 71, H. 3, 380–406.
[6] Siehe hierzu Condemi, Silvana /Savatier, François 2020: Der Neandertaler, unser Bruder. 300.000 Jahre Geschichte des Menschen, München.