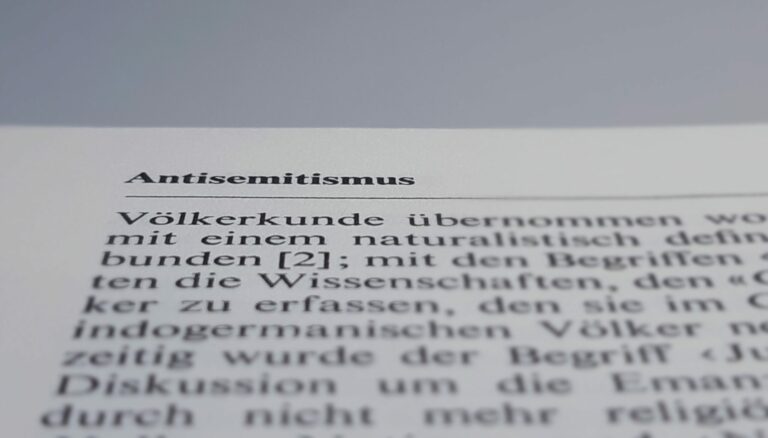„King of my castle“ oder Knecht im Home-Office? – Die Bedeutung von #stayathome für das Erleben des Privaten
Von Eike Buhr (Oldenburg)
Dieser Blogbeitrag basiert auf einem Aufsatz, der in einem Schwerpunkt zur COVID-19 Pandemie in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift für Praktische Philosophie (ZfPP) erschienen ist. Der Aufsatz kann auf der Website der ZfPP kostenlos heruntergeladen werden.
Wir schätzen unsere private Wohnung nicht nur als Dach über dem Kopf, sondern auch als Ort des Rückzugs und der Erholung. Im Rahmen der erlassenen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie darf man aber weder beliebig viele Freunde und Verwandte nach Hause einladen noch die Wohnung zu beliebigen Zwecken verlassen. Wenn Arbeit, Kindererziehung und Freizeit unter einem Dach stattfinden, lässt sich dann wirklich noch von Erholung und Rückzug sprechen? Inwiefern haben die erlassenen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen unser Erleben des Privaten verändert? Kann hier sogar von einem unzumutbaren staatlichen Eingriff in unsere Privatsphäre gesprochen werden?
Die Existenz eines privaten Raumes setzt dessen Trennung von einem öffentlichen Raum voraus. Diese Trennung lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Während die Privatsphäre für Aristoteles noch einen Zustand der Beraubung („De-Privation“), der Unfreiheit und Lebensnotwendigkeit markierte, ist der Raum des Privaten für die liberalen Klassiker der Frühen Neuzeit, John Locke und John Stuart Mill, gerade ein Raum der Freiheit abseits von öffentlicher Meinung und staatlichen Zugriffen. Das englische Sprichwort „My home is my castle“ meint genau dies: das eigene private Zuhause als einen Ort der Zuflucht und als einen sicheren Hort der Erholung, bei dessen Gestaltung dem Staat oder der Öffentlichkeit kein Mitspracherecht eingeräumt werden muss. Das Private dient also nicht mehr nur zur Sicherung des Überlebens, sondern vielmehr als Grundlage eines guten Lebens.
Die im Privaten garantierte Freiheit darf allerdings nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden. So sind staatliche oder öffentliche Eingriffe auch für Locke und Mill dann legitim, wenn sie dazu dienen, Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. Angewandt auf die Ausgangsfrage bedeutet dies, dass die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen nicht notwendigerweise einen illegitimen Eingriff in unsere Privatsphäre darstellen, da das Verlassen der Wohnung und insbesondere der Kontakt zu einer unüberschaubaren Anzahl von Personen das Infektionsgeschehen erhöhen und unkontrollierbar machen würden. Das vermeintlich private Handeln Einzelner führte so zum Schaden der gesamten Gesellschaft. Insbesondere vor dem Hintergrund der Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung, wie sie in Artikel 13 im Grundgesetz verbrieft ist, wird über Maß und Dauer der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen aber weiterhin kontrovers diskutiert.
Die Trennung zwischen Privatheit und Öffentlichkeit ist im 20. Jahrhundert umfassend kritisiert worden. Insbesondere von feministischen Autorinnen wird das Private nicht als Garant gleicher individueller Freiheit, sondern vielmehr als Instrument der Verdrängung und Unterdrückung von Frauen betrachtet.[1] So spricht Mill beispielsweise noch davon, dass die Heirat für Frauen mit der Übernahme häuslicher Pflichten verbunden ist. Catharine MacKinnon und Anita Allen haben in ihren Kritiken beispielhaft gezeigt, dass das Private gemeinhin vor allem für Männer einen Wert hatte und dass die Privatsphäre und dort insbesondere familiäre Strukturen keinen Bereich darstellen, der frei von gesellschaftlichen Machtstrukturen wäre. Dabei haben sie zugleich verdeutlicht, dass Privatheit kein statisches Konzept ist und dass sich im Wandel gesellschaftlicher Normvorstellungen auch die geschlechtsspezifische Konnotation der Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit verändert hat.
Die Legitimitätsbedingung für Eingriffe in die Privatheit lässt sich also erweitern. Neben dem Kriterium der Schadensabwendung sind öffentliche Eingriffe in die Privatsphäre ebenfalls dann legitim, wenn sie dazu dienen, allen Gesellschaftsmitgliedern den gleichen Wert von Privatheit zugänglich zu machen.
Warum bedürfen wir der privaten Wohnung als Ort des Rückzugs und der Erholung? Nicht zuletzt, um abseits der urteilenden Blicke von Arbeitskollegen und Fremden, man selbst sein zu können. Die insbesondere in kleineren Wohnungen bestehende Unmöglichkeit, in ein „Zimmer für sich allein“ (V. Woolf) zu flüchten, führt dazu, dass selbst Familienmitglieder die Rollen, die sie voreinander einnehmen, nicht mehr ablegen können. Menschen, die auf so engem Raum zusammenleben, sind gezwungen, gleichzeitig unterschiedliche familiäre sowie öffentliche bzw. berufliche Rollen einzunehmen. Dies führt mitunter nicht nur zu einem Ausbleiben von Erholung, sondern sogar zu einer Zunahme von Stress. Die Zunahme häuslicher Gewalt, vor der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bereits zu Beginn der Pandemie gewarnt hat, lässt sich als trauriges Symptom dieser Problematik betrachten.
Das Nachdenken darüber, wer wir sind und sein wollen, ist allerdings nicht unbedingt eine Tätigkeit, die wir vollständig allein vornehmen. Wir sind hierbei auch auf die Unterstützung von Freunden oder Angehörigen angewiesen. Dies macht zweierlei deutlich. Erstens besteht die Privatsphäre nicht in vollständiger Zurückgezogenheit. Man kann auch gemeinsam privat sein. Dies erfordert allerdings – zweitens – eine Differenzierung zwischen individueller und sozialer Privatheit. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen fordern sowohl die individuelle als auch die soziale Privatheit heraus. Wir sitzen nicht nur auf engem Raum zusammen und haben nur noch eingeschränkte Möglichkeiten zum Rückzug. Wir können auch den Rat und die Nähe unserer Freunde und Verwandten, den wir schätzen und bisweilen sogar benötigen, nur noch eingeschränkt wahrnehmen. Sei es aufgrund von Reise- und Kontaktbeschränkungen oder der Notwendigkeit sie zu schützen, da sie einer Risikogruppe angehören. Die hierfür notwendige soziale Nähe kann auch Telekommunikation nicht ersetzen.
Während wir auf der einen Seite die Personen, die wir gerne in unserem Umfeld haben, nicht in die eigene Wohnung einladen können, müssen wir – zumindest diejenigen, die ihrer Arbeit aus dem Home-Office aus nachgehen – auf der anderen Seite denjenigen Einblick in unsere private Wohnung gewähren, die wir ansonsten explizit aus unserer Privatsphäre ausschließen. So möchten wir beispielsweise nicht, dass jeder die Fotos unserer Kinder an der Wohnzimmerwand bestaunen kann. Das im Hintergrund stehende Hochzeitsfoto aus dem letzten Jahr lässt möglicherweise den unliebsamen Kollegen erahnen, dass wir nicht im kleinen Kreis, sondern bloß ohne ihn gefeiert haben. Und möchte man wirklich, dass der eigene Chef sieht, dass man den Wäscheständer immer noch nicht abgeräumt hat, obwohl er auch schon beim letzten Meeting im Hintergrund zu sehen war? Die Arbeit aus dem Home-Office erfordert also nicht nur die Herstellung eines Arbeitsplatzes an einem Ort, der vom Büro möglicherweise gerade unterschieden werden sollte, sondern ebenfalls eine Auseinandersetzung mit der Einrichtung und Inszenierung der eigenen Wohnung nach anderen Maßstäben als den eigenen, persönlichen Vorstellungen. An solchen Beispielen lässt sich erkennen, dass der durch die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verordnete Rückzug ins Private nicht zwangsläufig zur Entschleunigung führt, sondern ebenfalls eine Entgrenzung zwischen Privatsphäre, Kindererziehung und Berufsleben, das heißt zwischen Erholung, Freizeit und beruflichen beziehungsweise erzieherischen Anforderungen bedeutet.
Bei genauerer Betrachtung dieser Beispiele fällt allerdings auf, dass diese Entgrenzung nicht auf jedes Gesellschaftsmitglied zutrifft. So wird sich nicht jeder von Ihnen in jedem Beispiel wiedergefunden haben. Sei es, weil Sie nicht im Home-Office arbeiten, über ein eigenes Arbeitszimmer verfügen, das keiner entsprechenden Reorganisation bedarf, ein Großteil der Kindererziehung stets bei Ihnen zu Hause stattfand oder sie gar keine eigenen Kinder haben. Möglicherweise konnten Sie sich auch auf ihren Landsitz am Starnberger See zurückziehen und können über Probleme wie mangelnde Rückzugsmöglichkeiten oder Platzmangel in der (groß‑)städtischen Enge nur müde lächeln. Diese beschriebene Diskrepanz im Erleben der Privatsphäre besteht offenkundig vor allem zwischen wohlhabenderen und finanzschwächeren Gesellschaftsmitgliedern.
Die Privatsphäre bietet mehr also als nur ein Dach über dem Kopf. Sie fungiert vor allem als Ort des Rückzugs, der Erholung und familiären Intimität. Somit erfüllt sie neben individuellen auch gesellschaftliche Funktionen. Im Zuge der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen finden nun Arbeit, Kindererziehung und Freizeit unter einem Dach statt und über die Teilnahme an Videokonferenzen sehen auch die Kollegen und Kolleginnen, die man gerade nicht nach Hause einladen wollte, wie man die private Wohnung eingerichtet hat. Obwohl diese Maßnahmen zunächst keine illegitimen staatlichen Eingriffe in die Privatsphäre darstellen, ist doch eine Veränderung im Erleben der Privatsphäre zu beobachten. Erscheint die Privatsphäre nicht als Ort des Rückzugs und der Erholung führt dies nicht nur zu einer Zunahme von Stress, zu einer „Regel- oder Corona-Müdigkeit“, sondern im schlimmsten Fall zur Zunahme häuslicher Gewalt. Dass gerade #stayathome dem „home“ mitunter seine Funktionen beraubt, ist ein kaum berücksichtigter, aber nicht zu vernachlässigender Aspekt in der Beurteilung der Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens der COVID-19 Pandemie.
Eike Buhr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Ethik in der Medizin an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
[1] Beispielhaft Elshtain 1981; Allen 1988; Okin 1989; MacKinnon 1989; Cohen 1992. Für einen historischen Überblick über die Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit, vgl. Davidoff 1998.