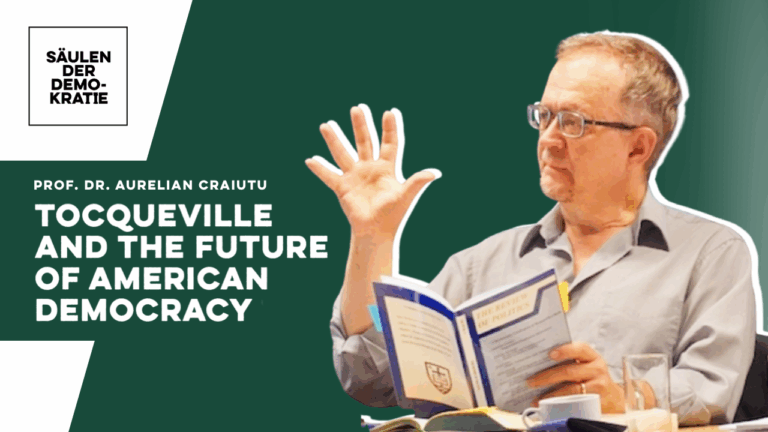Größe und Demokratie
von Dirk Jörke (Universität Darmstadt)
Anlässlich der Feierlichkeiten zu 60 Jahre Élysée-Vertrag forderten Emmanuel Macron und Olaf Scholz, dass “Europa noch souveräner wird” und dachten dabei, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der vielbeschworenen “Zeitenwende”, insbesondere an eine militärische und geopolitische Unabhängigkeit. Flankiert werden solche Bestrebungen durch Intellektuelle und Politikwissenschaftler, die sich darüber durch die Erweiterung der Rechte des Europaparlaments und die Etablierung transnationaler Wahllisten eine Überwindung des vielbeschworenen demokratischen Defizits der Europäischen Union erhoffen. Doch das ist eine trügerische Hoffnung, die im Effekt dazu führt, eine antidemokratische Praxis mit einem demokratietheoretischen Zuckerguss zu verdecken.
Als Vorbild für die Demokratisierung eines supranationalen Raumes wird oftmals der Zusammenschluss der US-amerikanischen Republiken im Jahr 1787 und der in Philadelphia ausgehandelten Unionsverfassung genannt. Insbesondere die in den von Alexander Hamilton, John Jay und James Madison verfassten “Federalist Papers”. Dieser Text, mit dem die Autoren um die Unterstützung für den Verfassungsentwurf warben, brach erstmals mit der damals verbreiteten Überzeugung, demokratische (bzw. im damaligen Sprachgebrauch “republikanische”) Verhältnisse seien lediglich in kleinen, überschaubaren Räumen realisierbar. Durch die Einführung des Repräsentativsystems, so Madison im berühmten 10. Artikel der Federalist Papers, wäre eine Gewährleistung republikanischer Prinzipien auch in so großen Gebilden wie sie mit einem Zusammenschluss der damaligen 13 Republiken geschaffen werden, möglich. Doch nicht nur dies, darüber ermögliche die in großen Räumen erforderliche Selektion der Repräsentanten, dass nicht länger Demagogen, sondern nur die “wahren Wächter des öffentlichen Wohls” die Geschicke des Landes bestimmen. Dieser Argumentation widersprachen die sogenannten Anti-Federalists, die sich dem mit der neuen Union einhergehenden Souveränitätstransfer entgegenstellten und für den Forstbestand der alten föderalistischen Ordnung, wie sie in den nach der Erlangung der Unabhängigkeit vereinbarten Articles of Confederation bestanden hatte. Die Konföderationsartikel sahen durchaus eine enge Zusammenarbeit der Republiken vor, verzichteten aber auf eine eigene Legitimation der föderalen Ebene. Entsprechend handelte es sich bei den Vertretern im Kongress um Delegierte, die den Parlamenten der jeweiligen Republiken gegenüber rechenschaftspflichtig waren.
Eines der zentralen Argumente der Anti-Federalists gegen die neue Verfassung von 1787 war das der räumlichen Ausdehnung. Dabei hatten sie sowohl die unterschiedlichen ökonomischen Strukturen als auch die ausgeprägten Mentalitätsunterschiede zwischen den Republiken des Nordens und denen des Südens im Sinn. Gegen eine engere Vereinigung sprachen ihnen zufolge – und dabei stützten sie sich auf klassische Argumente von Montesquieu und Rousseau – erhebliche Interessensgegensätze auf der einen und die Nichtexistenz einer gemeinsamen politischen Kultur auf der anderen Seite. Zudem befürchteten die Anti-Federalists eine erhebliche Abschwächung demokratischer Einflussnahme als Folge des größeren politischen Raumes. Die politischen Eliten würden sich nicht nur deutlicher von der Mehrheit der Bürger unterscheiden, sie würden sich im fernen Philadelphia auch weniger leicht kontrollieren lassen. Das Resultat seien despotische Verhältnisse.
Die Europäische Union ist gewiss keine Despotie, wie es die Anti-Federalists mit Blick auf die neue US-amerikanische Union beschworen haben. Doch hat sie sich in den letzten Jahren zunehmend zu einem liberal-autoritären Regime entwickelt. Was sich paradox anhört, beschreibt eine Realität, in der die Durchsetzung spezifisch liberaler Zielvorsetzungen zunehmend gegen den Willen der Bevölkerungen geschieht, weil wesentliche Politikbereiche ihrer Einflussnahme entzogen worden sind. Zum einen sind zentrale inhaltliche Materien – etwa das Wettbewerbsrecht, die Frage des internationalen Kapitalverkehrs, die sogenannten Stabilitätskriterien – bereits im Vertragsrecht geregelt und haben damit gleichsam Verfassungsrang erhalten, sind also sakrosankt. Zum anderen wurden mit dem Europäischen Gerichtshof, der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank gestaltungsmächtige Institutionen etabliert, die einer demokratischen Einflussnahme weitestgehend entzogen sind. Insofern die europäische Ebene den Handlungsspielraum der Mitgliedsstaaten und ihrer demokratisch legitimierten Parlamente und Regierungen beschränkt hat, ist es zu einem Verlust an demokratischer Gestaltungsmacht gekommen, und das hat auch etwas mit der Größe der Europäischen Union zu tun.
Die Römischen Verträge von 1957 unterzeichneten sechs Staaten. Mittlerweile, nach insgesamt sieben Erweiterungsrunden, gibt es 27 Mitgliedsstaaten. Betrug die Gesamtbevölkerung der Gründungsmitglieder im Jahr 1957 ca. 168 (aktuell 236) Millionen, so sind es mit Blick auf die gesamte Europäische Union heute 446 Millionen. Auch räumlich ist es zu einer erheblichen Vergrößerung gekommen, nämlich von ca. 1.178.000 auf 4.234.564 Quadratkilometer. Schließlich stieg die Zahl der Amtssprachen von sechs auf 24. All das, so das Argument dieses Kapitels, stellt die Europäische Union vor erhebliche Herausforderungen und ist ein zentraler Grund dafür, dass sie sich nicht demokratisieren lässt. Doch nicht nur dies; die mit der zunehmenden Größe ebenfalls gewachsene Heterogenität des europäischen Wirtschafts- und Kulturraumes ist auch einer der Faktoren, die für die seit gut drei Jahrzehnten zu beobachtenden negativen Auswirkungen der Europäischen Union auf den Zustand der Demokratie verantwortlich sind.
Die integrationsfreundlichen Maßnahmen der vergangenen 35 Jahre, also seit dem Ende der 1980er Jahre, konnten sich auf das »Primärrecht« stützen, dass zunehmend expansiv ausgelegt wurde. Als solches werden jene inhaltlichen Bestimmungen bezeichnet, die in den Verträgen der Europäischen Union festgehalten sind, vor allem im Bereich der Wirtschafts- und Währungspolitik. Hier erfolgt ein entpolitisierter Modus der Durchsetzung vor allem den europäischen Grundfreiheiten für Waren, Dienstleitungen, Kapital und Personen. Die durch die Kommission und den Europäischen Gerichtshof betriebenen Maßnahmen einer »negativen Integration« (Scharpf), worunter vor allem der Abbau von »Wettbewerbsverzerrungen« fällt, haben einen wirtschaftspolitischen Rahmen erzeugt, der den gewählten Vertretern auf nationaler, regionaler und kommunaler Ebene kaum noch Spielraum für die Verfolgung einer eigenständigen Agenda lässt, etwa hinsichtlich der Subventionierung einheimischer Industrien oder der Bevorzugung lokaler Anbieter bei öffentlichen Ausschreibungen. Hervorzuheben ist nicht zuletzt die sehr integrationsfreundliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, durch die immer mehr Politikfelder der nationalstaatlichen Gesetzgebung, aber auch des Verwaltungshandelns entzogen wurden. Eine positive Integrationspolitik, etwa im Bereich des Sozialen, ist aufgrund der hierfür erforderlichen Einstimmigkeit im Europäischen Rat hingegen lediglich marginal ausgebildet. Gleiches gilt für eine europaweite einheitliche Steuerpolitik oder eine wirksame Bekämpfung von Steuerschlupflöchern. Auch die seit dem Ausbruch der Finanzkrise selbst von führenden Politikern geforderte europäische Finanztransaktionssteuer ist bis heute nicht zustande gekommen. Ursächlich hierfür sind die hohen Konsensschwellen. An dieser Stelle erweist sich insbesondere die gewachsene Heterogenität und die damit verbundene gestiegene Interessenvielfalt zwischen den Mitgliedsländern als Hindernis einer gemeinsamen Politikgestaltung.
Für die Anti-Federalists stand fest: Die ökonomischen Unterschiede zwischen dem durch Kleinfarmer geprägten Norden und dem von Großgrundbesitzern dominierten Süden seien zu groß, als dass eine Politik im gleichen Interesse aller formuliert werden könnte. Nicht zuletzt fürchteten sie eine Machtverschiebung in Richtung auf die »natürliche Aristokratie« und damit auf finanzstarke Akteure infolge der Ausdehnung des Herrschaftsraumes. Ähnliches lässt sich gegenwärtig in der Europäischen Union beobachten. Im Zuge des Abbaus von Wettbewerbsschranken und verschärft durch die Eurorettungspolitik erfolgt die Durchsetzung eines Wirtschaftsmodells, mit dem die Mitgliedsländer im Norden und insbesondere die deutsche Bundesregierung in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht zu haben glauben, auf Wirtschaftsräume, in denen davon ganz offensichtlich nur wenige profitieren. Aber auch in den Nordländern wächst die soziale Ungleichheit und in der Folge auch die politische Unzufriedenheit. Davon konnten zuletzt insbesondere rechtspopulistische Kräfte profitieren, die ihren Erfolg nicht nur dem Protest gegen steigende Einwanderungszahlen und einer vermeintlichen Islamisierung verdanken, sondern sich zunehmend auch gegen die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Europäischen Union wenden und für eine Stärkung des Sozialstaates auf der nationalstaatlichen Ebene eintreten. Diese Kombination aus Ablehnung der Migration und einer nationalstaatlich fundierten Sozialpolitik ist für immer größere Wählerschichten attraktiv geworden, wie immer man das auch normativ bewerten mag.
Doch was haben all diese inzwischen vielfältig diskutierten demokratieschädlichen Effekte der Supranationalisierung mit der Frage der Größe zu tun? Hingewiesen wurde bereits auf die Heterogenität zwischen den Mitgliedsländern, die eine »positive« Integrationspolitik nahezu verunmöglicht. Und dies gilt nicht nur mit Blick auf wirtschafts- und sozialpolitische Fragen, sondern auch hinsichtlich einer gemeinsamen Wertepolitik, wie sich zuletzt in der Auseinandersetzung über die Verteilung der Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien gezeigt hat. Zu unterschiedlich sind die jeweiligen historischen Erfahrungen, politischen Kulturen und Mentalitäten, als dass etwas Gemeinsames entstehen könnte, das nicht nur für kosmopolitisch orientierte Menschen handlungsleitend ist. Die Europäische Union ist mithin keine politische Gemeinschaft, die einen einheitlichen Willen ausbilden könnte, und das gilt insbesondere mit Blick auf die jeweiligen mitgliedsstaatlichen demoi, die sich offensichtlich nicht zu einem gemeinsamen demos vereinigen können und wollen. Ursächlich dafür ist vornehmlich, dass kein gemeinsamer Bedeutungsraum existiert. Die Ausbildung dessen, was man mit einer gewissen Vorsicht als eine europäische Identität bezeichnen könnte, ist größtenteils auf akademische Milieus beschränkt und es gibt wenig Anzeichen, dass sich das auch nur mittelfristig ändern könnte. Auch die Wahlen zum Europäischen Parlament sind größtenteils durch nationalstaatliche Wahrnehmungsmuster geprägt. Demokratie bleibt daher in Europa notwendig halbiert beziehungsweise ist, etwas polemischer ausgedrückt, liberal entgleist. Die Europäische Union ist zu groß für die Ausbildung eigener demokratischer Werte und Praktiken. Doch auch aus einem weiteren Grund sollte man den Forderungen nach einem weiteren Souveränitätstransfer auf die supranationale Ebene mit Skepsis begegnen.
Wolfgang Streeck hat in seinem viel diskutierten Buch Gekaufte Zeit an einen wichtigen Aufsatz Friedrich August von Hayeks erinnert. Der 1939 unter dem Titel »The economic conditions of interstate federalism« publizierte Artikel ist explizit den Größeneffekten einer Wirtschafts- und Währungsunion gewidmet und liest sich wie eine Blaupause für die heutige EU. Der Aufsatz ist im Kontext von Überlegungen neoliberaler Intellektueller zu verorten, die sich in den dreißiger und vierziger Jahren intensiv mit der Frage beschäftigten, wie die potenziell wirtschaftsfeindliche Macht souveräner Nationalstaaten eingedämmt werden könnte. Anlass dafür war das Vordringen des Sozialismus, der sich jedoch in ihrer Wahrnehmung nicht nur auf die osteuropäischen Staaten beschränkte, sondern auch viele der westlichen Demokratien erfasst habe, etwa im Rahmen des New Deals in den USA. Vor allem jedoch ging es darum, eine neue internationale Ordnung für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dem absehbaren Ende des britischen Empires zu kreieren. Das Ziel von Autoren wie Moritz Julius Bonn, Lionel Robbins, Ludwig von Mises und Hayek bestand darin, den Staaten die Verfügungsgewalt über wirtschaftliche Prozesse weitgehend zu entziehen, indem diese auf einer supranationalen Ebene festgeschrieben werden. Supranationale Agenturen und internationales Recht sollten Freihandel und Investorenschutz gegen die Begehrlichkeiten demokratisch gewählter Regierungen schützen. Dabei komme es vor allem darauf an, dass die untergeordneten Ebenen sich den Entscheidungen und den Gesetzen der supranationalen Ebene fügen müssen. Ein weiterer Vorteil eines solchen Arrangements läge in der Invisibilisierung der Prozesse der ökonomischen Governance, wie von Mises in seinem Vorschlag für eine Osteuropäische Union nach einem vorausgesetzten Sieg der Alliierten über Nazideutschland unterstreicht. Doch auch wenn sich die Überlegungen der Vordenker des Neoliberalismus in vielerlei Hinsicht gleichen, ist insbesondere die Lektüre von Hayeks Aufsatz aufschlussreich.
Hayek spricht sich vor dem Hintergrund des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges für eine föderale Ordnung aus, die sich nicht nur auf das traditionelle Feld der Friedenssicherung bezieht, sondern darüber hinaus auch die Wirtschafts- und Währungspolitik auf die suprastaatliche Ebene verlagert. Er plädiert dabei ebenso für den freien Verkehr von »Menschen, Gütern und Kapital« wie für einen gemeinsamen Währungsraum. Hayeks Argument für eine derartige föderale Ordnung ist zunächst, dass nur in deren Rahmen verhindert werden könne, dass die Interessengegensätze zwischen den Mitgliedstaaten ein Ausmaß annehmen, das dem Ziel der Friedenssicherung entgegensteht. Allerdings kann dieses Argument spätestens seit dem Ausbruch der sogenannten Eurokrise und der dabei zum Vorschein getretenen Auseinanderentwicklung zwischen den Staaten im Norden und denen im Süden als widerlegt gelten. Zwar sind wir innerhalb der Europäischen Union von kriegerischen Auseinandersetzungen weit entfernt, aber dass durch die wirtschaftliche Union die Interessengegensätze zwischen den Mitgliedstaaten geringer geworden seien, lässt sich nicht behaupten.
Der systematische Grund für Hayeks Plädoyer für eine Ausweitung des Föderalismus ist daher vielmehr darin zu sehen, dass auf diese Weise die Macht der Nationalstaaten, steuernd in die Wirtschaft einzugreifen, nachhaltig geschwächt wird: »Das heißt, daß der Bund die negative Macht haben müßte, die Einzelstaaten daran zu hindern, in bestimmter Weise in die Wirtschaftstätigkeit einzugreifen, während er aber selbst nicht die positive Macht hätte, das an ihrer Stelle zu tun.« Als Beispiel einer derartigen unerwünschten Einmischung der Staaten in die Wirtschaft führt er an erster Stelle Schutzzölle an, Hayek nennt aber auch die Begrenzung der Arbeitszeit oder eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung. Zudem hebt er positiv hervor, dass es wegen der möglichen Mobilität von Menschen, Gütern und Kapital für die einzelnen Staaten schwieriger würde, eine hohe Besteuerung durchzusetzen. Bemerkenswert ist das Zitat von Hayek aber insbesondere, weil er die aus seiner Sicht begrüßenswerten Effekte einer »negativen« Integration unterstreicht und zugleich betont, dass eine »positive« Integration, welche die sozialen Folgekosten abfedern könnte, verunmöglicht werde. Ist Ersteres die gleichsam naturwüchsige Folge des Wirtschafts- und Währungsföderalismus, so fehlt es etwa für eine einheitliche Sozial- oder Steuerpolitik an der nötigen Organisations- und Durchsetzungsfähigkeit, vor allem aber an einem kollektiven Willen. In einer Föderation aus mehreren Nationalstaaten bestehe zwangsläufig eine Vielfalt der Interessen, jedoch keine gemeinsame Identität, die diese Interessensgegensätze überbrücken könne.
Für Hayek ist eine Wirtschafts- und Währungsunion der ideale Rahmen, um die demokratische Gestaltungsmacht von Nationalstaaten zu überwinden, die ihnen aufgrund einer kollektiven Identität und gewachsener Solidaritätsstrukturen zukommt. Diese Voraussetzungen kollektiver Selbstregierung fehlten in einer Föderation von Nationalstaaten jedoch schlichtweg und könnten auch nicht erzeugt werden. Dass Hayek mit dieser Einschätzung noch heute richtig liegt, bestätigt sich tagtäglich beim Blick in die Zeitungen. Die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist weiterhin als gering einzustufen. Und auch die von Hayek so begrüßten Interessensgegensätze sind reichlich vorhanden. Besonders einschlägige Beispiele hierfür sind die nicht enden wollenden Diskussionen über die Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer, über gemeinsame Sätze bei den Unternehmenssteuern, die tatsächliche Austrocknung der Steueroasen innerhalb der Europäischen Union oder auch die Einführung eines gemeinsamen Mindestlohns. Bei all diesen Vorhaben, die in Richtung einer »positiven« Integration zielen, gibt es genügend Vetospieler, um sie auf den Sankt Nimmerleinstag zu verschieben. Die Ausführungen Hayeks legen nahe, dass aufgrund der Heterogenität innerhalb der EU eine »positive« Integration sehr unwahrscheinlich ist. Zumindest aber würde sie nur in kleinen Schritten und auch nur gegen Widerstand großer Teile der Bevölkerungen zu erreichen sein. Denn sie würde mit den Bürgerinnen und Bürgern einen weiteren Vetospieler ins europäische Boot holen. Insofern lässt sich aus einer neoliberalen Perspektive auch einer weiteren »Demokratisierung« der EU gelassen entgegensehen, denn diese wäre wenig mehr als eine Scheindemokratisierung.
Hayeks Argument ist freilich nicht neu. Bereits James Madison hat im zehnten Artikel der Federalist Papers den wesentlichen Vorteil der neuen Union gerade in der durch ihre Heterogenität bewirkten Verhinderung einer Mehrheitstyrannei erkannt. Und wie Hayek hat auch Madison darunter vor allem, wenn nicht gar ausschließlich, Eingriffe in die wirtschaftlichen Interessen der finanziell starken Akteure gesehen, etwa durch eine mehrheitlich, also demokratisch, beschlossene Ausgabe von Papiergeld oder Stundung von Schulden.
Was folgt nun aus dieser Analyse über das Verhältnis von Größe und Demokratie? Sicherlich nicht, dass der erreichte Grad an supranationaler Zusammenarbeit komplett in Frage gestellt werden sollte. Und auch nicht, dass die Idee einer engen Zusammenarbeit zwischen den Nationen nicht überzeugend ist. Im Gegenteil, es steht völlig außer Frage, dass Herausforderungen wie Friedenssicherung, Klimawandel, Migrationsbewegungen nicht an nationalstaatlichen Grenzen halt machen und deshalb hier eine enge Zusammenarbeit auch im Rahmen von supranationalen Institutionen, dringend geboten ist. Doch sollte man sich erstens von der Illusion verabschieden, diese Institutionen mit einer unmittelbaren demokratischen Legitimation ausstatten zu könnten. Und zweitens könnte es zum Zwecke der Wiederbelebung der Demokratie angeraten sein, insbesondere wirtschafts- und finanzpolitische Kompetenzen wieder auf die Ebene der Nationalstaaten zu verlagern. Ein Modell könnte dafür die erwähnten US-amerikanischen Konföderationsartikel sein. Im Konföderationsmodell werden einige zentrale Bereiche auf die suprastaatliche Ebene delegiert, und die Staaten verpflichten sich hier zu einer engen Kooperation. Das kann qualifizierte Mehrheitsentscheidungen ebenso einschließen wie unmittelbar wirksame Rechte der Bürgerinnen und Bürger der einzelnen Staaten. So garantierte die US-amerikanischen Konföderationsverfassung Freizügigkeit über Staatsgrenzen hinweg. Doch welche Politikfelder bedürfen einer supranationalen Koordination? An erster Stelle ist dabei an eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu denken. Damit würde man zu den Ursprüngen des Föderationsgedankens zurückkehren. Eine Föderation sollte nämlich in der Antike und der Neuzeit vorwiegend Sicherheit garantieren und auf diese Weise gerade die Freiheit kleiner Republiken schützen, wie Montesquieu im “Geist der Gesetze” schreibt. Die Lösung des Größendilemmas, dem zufolge kleine Republiken ihre Autonomie nicht sichern, große Staaten aber keine freiheitliche Regierung ausweisen können, bestand für Montesquieu also darin, sich in dem Kernbereich der Verteidigungspolitik zusammenzuschließen, weitere Politikfelder aber in der Verfügungsgewalt der einzelnen Republiken zu belassen. Nun hat sich die Welt seit Montesquieus Zeiten erheblich verändert, und es sind zahlreiche Herausforderungen entstanden, die einer globalen Koordination bedürfen, aber auch auf supranationaler Ebene reguliert werden müssen. Dazu zählt an erster Stelle die Umweltpolitik, denn bekanntlich machen Treibhausgase und verunreinigte Flüsse nicht an nationalstaatlichen Grenzen halt.
Der wesentliche Unterschied des hier vorgeschlagenen Konföderationsmodells zur Europäischen Union besteht jedoch darin, dass eine supranationale Regelung gerade nicht vorwiegend auf dem Gebiet der Wirtschafts-, Währungs- und Handelspolitik geschehen sollte, wie es gegenwärtig der Fall ist. Das schließt eine gemeinsame Koordination etwa in der Steuerpolitik ebenso wenig aus wie Solidaritätstransfers, letztere sind sogar in höherem Umfang erforderlich, als es gegenwärtig der Fall ist. Doch die Grundlage dafür kann nur eine Stärkung der Entscheidungsgewalt der einzelstaatlichen Parlamente und Regierungen sein, und hier sind insbesondere die Bereiche der Wirtschafts-, Währungs- und Handelspolitik von zentraler Bedeutung.
Dirk Jörke ist seit 2014 Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Darmstadt. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Demokratietheorie, wobei er ideengeschichtliche, empirische und normative Perspektiven vereinigt. Fragen der Bedeutung sowie der Rechtfertigung der Demokratie aus pragmatistischer Perspektive waren Gegenstand seiner Dissertation („Demokratie als Erfahrung“, Wiesbaden 2003). Der ideengeschichtlichen Wandel des Demokratiekonzeptes von der Antike bis zum frühen 20. Jahrhundert war Thema seiner Habilitationsschrift („Kritik demokratischer Praxis“ Baden-Baden 2011). Zudem beschäftigt er sich seit nunmehr 20 Jahren mit dem gegenwärtigen Formwandel der Demokratie. In den letzten Jahren erfolgte eine Auseinandersetzung mit der populistischen Herausforderung moderner Demokratien sowie zum Verhältnis von „Größe und Demokratie. Über die räumliche Dimension von Herrschaft und Partizipation“ (Berlin 2019). Seine aktuellen Forschungen, in denen es um die Transformation des Demokratieverständnis im 18. und 19. Jahrhundert geht, schließen hier an.