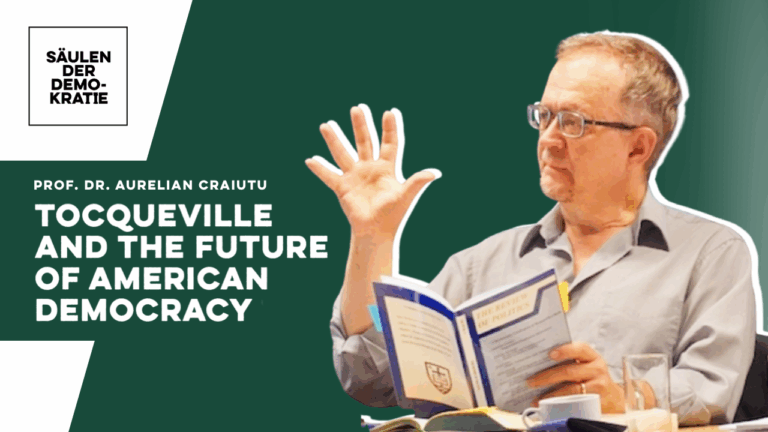Horizontale und vertikale Demokratie. Zum Verhältnis von Volkssouveränität und Staat
von Oliver Eberl (Leibniz Universität Hannover/Goethe-Universität Frankfurt)
Die Versprechen der Demokratie
Die moderne Demokratie ist von zwei zentralen Versprechen geprägt: der Freiheit und der Gleichheit. Diese beiden Prinzipien sind es, auf die die Versuche, die Versprechen der Demokratie zu benennen, immer wieder hinauslaufen. Zum Beispiel hat Hubertus Buchstein die Versprechen der Demokratie folgendermaßen benannt: (1) körperliche Unversehrtheit und Freiheit, (2) rechtliche und politische Gleichheit, (3) politische Beteiligungsmöglichkeiten, (4) wirtschaftlicher Wohlstand, (5) Sicherheit und Frieden (Buchstein 2013: 34). Es ist möglich, so mein Argument, diese Punkte wieder auf Freiheit und Gleichheit zurückzuführen.
Die ersten beiden Punkte nennen Freiheit und Gleichheit bereits, die weiteren fügen Differenzierungen hinzu oder erfassen Erwartungen der Bürger*innen, die sich wirtschaftlichen Wohlstand und Frieden von der Demokratie erhoffen. Doch fügen sich politische Beteiligung und Frieden fast logisch dem Versprechen auf Freiheit ein, denn ohne politische Partizipation wäre es keine Demokratie und im Krieg gibt es bekanntlich weniger Freiheit und wird diese von außen bedroht. Auch die Sicherheit lässt sich der Freiheit zuschlagen, denn ohne Sicherheit wird jede Freiheit schal. Wohlstand, der nicht extrem ungleich oder nach gesellschaftlichen Ständen verteilt ist, ist ein Beweis der Gleichheit. Dieser Punkt lässt sich also der rechtlichen und politischen Gleichheit hinzufügen. Zwar hat Hubertus Buchstein gute Gründe, den Wohlstand von der rechtlichen Gleichheit zu trennen, er will damit nämlich verhindern, dass formale Gleichheit, die rechtlich herzustellen ist, mit sozialer Gleichheit, die gesellschaftlich herzustellen ist, identifiziert wird. In genau diesem Sinne hat Dirk Jörke die beiden Versprechen der Demokratie bestimmt als „das prozedurale Versprechen der gleichen Teilhabe am politischen Prozess und das substantielle Versprechen einer Angleichung der sozialen Lebensverhältnisse“ (Jörke 2010: 73). Zwar betont Jörke, dass er nur die Attraktivität des Wortes Demokratie im 19. Jahrhundert erklären will, doch ist gut zu erkennen, dass er Gleichheit als zentralen Wert der Demokratie setzt, aus der politische und soziale Forderungen abgeleitet werden. Jörkes Definition kommt scheinbar ohne Freiheit aus, doch steckt sie im prozeduralen Versprechen der Gleichheit. Prozedurale Gleichheit ist eine Voraussetzung von Freiheit.
So lassen sich folgende Gruppen um Freiheit und Gleichheit bilden: (1) Freiheit, Frieden, Sicherheit, politische Beteiligung und (2) rechtliche und politische Gleichheit, wirtschaftlicher Wohlstand. Natürlich lässt sich jede einzelne Zuordnung bestreiten, wenn man die Begriffe auf differenzierte Weise verwendet. Doch ist es kaum möglich, den Sinn demokratischer Verfahren nicht auf Freiheit zu beziehen und Gleichheit nicht als Voraussetzung demokratischer Verfahren zu akzeptieren. Ich schließe daraus, dass Freiheit und Gleichheit die zentralen Versprechen, bzw. die zentralen Prinzipien der Demokratie sind.
Demokratie und Staat
Natürlich verweisen die von Buchstein und Jörke genannten Versprechen auf wesentliche Erwartungen an die Demokratie: sozialer Wohlstand/Gleichheit etwa und Sicherheit und Frieden. Doch halte ich es nicht für ganz überzeugend, diese Versprechen der Demokratie zuzuordnen. Sie gehören eher zu den Versprechen des Staates. Sozialer Wohlstand ist erkennbar ein Versprechen des Wohlfahrtsstaates des 20. Jahrhunderts, der eine Reaktion auf die Erfahrung ist, dass Freiheit unter den Bedingungen kapitalistischer Wirtschaft durch soziale Krisen bedroht ist. Dafür ist der umverteilende Wohlfahrtsstaat entwickelt worden, der Armut und zu große Ungleichheit verhindert. Sicherheit und Frieden verweisen ebenfalls auf den Staat, denn Sicherheit wird üblicherweise mit Sicherheit vor Gewalt durch Mitmenschen und Frieden als Sicherheit vor äußerer Gewalt durch andere Staaten verstanden. Für beides ist das Gewaltmonopol des Staates zuständig. Ist es richtig, diese Aufgaben der Demokratie zuzurechnen? Ich denke, dies zu tun, liegt an der Gewohnheit, bei Demokratie an den demokratischen Nationalstaat der Nachkriegszeit zu denken. Man könnte ergänzen, den „westlichen“ Nationalstaat. Das lässt sich auch an den Debatten erkennen, die seit längerem zur Globalisierung geführt werden, in denen nationalstaatliche Demokratie und Sozialstaat als durch die (neoliberale) Globalisierung geschwächt oder ausgehöhlt beschrieben werden. In dieser Perspektive lässt sich dann auch die Krise der Demokratie aus der Krise des Staates ableiten. So diagnostiziert Philip Manow vor dem Hintergrund dieser Debatte und unter dem Eindruck des Populismus, dass die Demokratie in einen Streit mit sich selbst, nämlich in einen Konflikt über Demokratie geraten sei, „weil mit dem Staat die äußere Form der Demokratie in die Krise gerät“ (Manow 2020: 152). Gleichwohl lassen sich neue Formen der Verbindung von Volkssouveränität und Staat suchen (Eberl/Erbentraut 2022). Der Staat ist nicht der Ursprung der Demokratie.
Hier beginnt das Feld der Debatten um den Staat, die die politische Philosophie schon so lange beschäftigen und die mit dem Namen Thomas Hobbes verbunden sind. Bekanntlich empfahl uns Hobbes, den Staat zu gründen, um die Unsicherheit von Leib und Leben im „Naturzustand“ zu überwinden. Diesem schrieb er Freiheit zu und zwar die Freiheit der „Wilden“ (Eberl 2021). Erst die Errichtung eines Gewaltmonopols über allen Bürger*innen würde ihnen Sicherheit vor den Übergriffen der Mitmenschen bieten. Freiheit wird hier verstanden als vorstaatlicher Zustand. Die Gleichheit taucht dagegen doppelt auf: im Naturzustand als gleiches Recht auf die Aneignung von Dingen und als Gleichheit unter dem neuen Gewaltmonopol. Denn die Menschen beschließen in einem Gesellschaftsvertrag, ein solches Gewaltmonopol über sich zu erlauben. Sie erzielen es, indem einer außerhalb des Vertrages bleibt. Dieser hat das Gewaltmonopol, es ist der Monarch. Von Demokratie ist hier noch keine Rede. Allerdings verspricht auch Hobbes eine „Gleichheit vor dem Gesetz“ des Monarchen (Maus 2004: 838). Es ist ein Tausch Freiheit gegen Sicherheit, und neben Frieden umfasst Sicherheit in einem gewissen Sinne auch Rechtssicherheit.
In der Geschichte des politischen Denkens ist diese Lösung immer wieder diskutiert und kritisiert worden. Jean-Jacques Rousseau hat am vehementesten widersprochen und erklärt, in diesem System sei der Mensch unfrei. Eine Gleichheit als Untertan sei nicht ausreichend und widerspreche der angeborenen Freiheit der Menschen. Sie haben das Recht, sich selbst eine Verfassung und Gesetze zu geben. Unabhängig vom konkreten Inhalt dieser Verfassung und der Gesetze wird man nur dann sagen können, diese seien Ausdruck der Freiheit, wenn man als Gleiche an ihrem Zustandekommen mitgewirkt hat. Diese Gleichheit lässt sich im Sinne von Buchstein als formale (rechtlich-politische) Gleichheit, aber auch im Sinne Jörkes als soziale Gleichheit verstehen und im Werk Rousseaus finden sich Anhaltspunkte für beide Deutungen. Freiheit muss also als Gleiche ausgeübt werden, sonst wird sie zur Unfreiheit der anderen. Eine politische Abstimmung, bei der Abstimmende drei Mal so viele Stimmen wie andere oder ein Veto gegen die Mehrheit haben, findet nicht unter Bedingungen der Gleichheit statt (und kann trotzdem aus unterschiedlichen Gründen als berechtigt angesehen werden). Freiheit und Gleichheit stehen in einem Verwirklichungszusammenhang.
Rousseau hat nachdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass der Staat die Freiheit auch bedroht. Der absolutistische Staat wurde von der Aufklärung als „despotisch“ beschrieben, weil er die Gesetze als Willen des Monarchen ohne Beteiligung der Gesetzesunterworfenen gegeben und ausgeführt hat. Das Gewaltmonopol, das Sicherheit gewährleisten soll, hat sich verselbständigt. Es führt Kriege und unterdrückt die Bevölkerung. Im Feudalstaat institutionalisiert es darüber hinaus die Ungleichheit der Stände. Dagegen formuliert Rousseau seine Theorie des Gesellschaftsvertrages, in der der Staat nur noch als Ergebnis des Willens des Volkes als legitim verstanden werden kann.
Volkssouveränität und Staat
Rousseau lässt aus dem Gesellschaftsvertrag nicht das Gewaltmonopol, sondern die Souveränität hervorgehen. Dem argumentationslogischen Dreischritt Naturzustand – Vertrag – Staat folgend, begründen die Individuen demnach in einem Akt freiwilligen Zusammenschlusses die politische Vereinigung. Im Unterschied zu Hobbes unterwerfen sich die Menschen bei Rousseau dabei aber nicht zu Gunsten eines Dritten, der außerhalb des Vertrages bleibt, sondern sie schließen sich selbst zum Souverän zusammen. So kommt ein kollektives Ich zustande: die Republik. Die Republik schafft die staatlichen Institutionen, die es zur Ausübung des Willens braucht und stellt zugleich alle neuen und alten Institutionen unter einen ständigen Existenzvorbehalt: Nur solange sie der Ausübung des allgemeinen Willens dienen, der sich in allen drei Gewalten zeigt, sind sie legitim. Die Souveränität – eigentlich gibt es nur Volkssouveränität, da Volk und Souverän dieselbe Person sind – ist nichts anderes als die Ausübung der volonté générale.
Die Souveränität des Volkes ist unveräußerlich und unteilbar. Der Wesenskern der Souveränität liegt somit im Akt der Selbstgesetzgebung; hierbei kann sich das Volk nicht repräsentieren lassen, ohne auf seine Souveränität zu verzichten. Genau diese Programmatik der Selbstrepräsentation hat Martin Welsch jüngst als das Rousseausche Programm von Kants Staatsrecht freigelegt: „Die Rousseau‘sche Volkssouveränität ist die schlechthin notwendige, zugleich jedoch die einzig mögliche und einzig wirkliche Form staatlich-souveräner Herrschaft“ (Welsch 2021: 15). Welsch betont auch, dass der Staat bei Kant zunächst als historisch gegeben verstanden wird (ebd.: 52). Mit Rousseau und Kant wird der Staat nicht als Verfassungsvoraussetzung gedacht. Der Staat wird der Demokratie normativ nicht länger vorgesetzt, sondern er wird als historisch vorgefunden und muss nun verrechtlicht und demokratisiert werden.
In einer umfassenden Rekonstruktion hat Ingeborg Maus diesen Aspekt der Volkssouveränität scharf herausgearbeitet. Volkssouveränität hat selbst keine Gewalt, sie ist, so Maus, „der genaue Gegenspieler der gewalthabenden Staatsapparate“ (Maus 1994: 9). Der Ausgangspunkt von Volkssouveränität liege in dem „Antagonismus zwischen ‚Volk‘ und Funktionären“, die die Staatsgewalt repräsentieren, es gehe Volkssouveränität um eine „Domestizierung staatlicher Gewalt“ (ebd.: 80). Diese Gegenüberstellung versteht das staatliche Gewaltmonopol als Bedrohung bürgerlicher Freiheit und menschlicher Rechte – eine Erfahrung, die nicht nur von der absolutistischen Monarchie, sondern von jeder staatlichen Exekutive bestätigt wird. Im absolutistischen Staat fehlt es an Gewaltenteilung, die gesetzgebende Gewalt ist mit der gesetzesanwendenden verschmolzen. Der Staat besteht aus dieser Perspektive vor allem in dem gesetzgebenden Monarchen, der zugleich die Spitze der Exekutive ist, die sich somit selbst programmiert. An dieser Problemstellung hat sich wenig geändert: Auch der nationalsozialistische Staat war durch Gewaltenfusion und eine sich selbst programmierende Exekutive gekennzeichnet und auch im Spätkapitalismus und der Postdemokratie sind die exekutiven Apparate nicht streng den Gesetzen unterworfen, sondern ermächtigen sich häufig selbst. Natürlich hat diese Sichtweise Maus viel Kritik eingebracht. Doch ganz unpolemisch verstanden, verweist sie darauf, dass die Exekutive als Kern der staatlichen Gewalt nicht nur richterlicher Kontrolle, sondern auch gesetzgebender Programmierung unterworfen werden muss, um Selbstermächtigungen zu beschränken.
Jürgen Habermas hat diese Kritik aufgenommen, jedoch die „rousseauistische Hoffnung“, „daß ein mit sich selbst konsistent bleibender demokratischer Gesetzgeber keine Beschlüsse fasst, der nicht alle zustimmen können“ als zu schwache rechtsstaatliche Garantie beschrieben (Habermas 1993: 557). Die Systeme Staat und Ökonomie müssten als Zwänge, die Volkssouveränität einschränken und ihr entgegenstehen, begriffen werden. Ähnlich wie Maus, die die durch die Systeme gewünschte Entformalisierung des Rechts und eine Form der Ideologiekritik als Hindernisse der Volkssouveränität sieht (Maus 2018), beschreibt Habermas die systemischen Zwänge als grundlegend: „In komplexen Gesellschaften scheitern auch die ernsthaftesten Anstrengungen um politische Selbstorganisation an Widerständen, die auf den systemischen Eigensinn des Marktes und der administrativen Macht zurückgehen.“ (Habermas 1993: 607)
Gegenüber diesen erinnert Habermas an die anarchistische Gesellschaftskritik und ihre Ideen zu freiwilligen Assoziationen, die einen entscheidenden Vorzug haben: „Diese weisen nur einen minimalen Grad der Institutionalisierung auf“ (Habermas 1993: 619). Habermas will den „anarchistischen Argwohn ins Methodische“ wenden und dazu die „Gesellschaft insgesamt als eine Assoziation im großen“ vorstellen, die freilich nicht mehr direkt, sondern vermittelt über das Medium Recht Selbsteinwirkungen vornimmt, in dem „der Gegensinn eines selbstprogrammierten Kreislaufs der Macht angelegt ist“ (Habermas 1993: 621). Dieser Gegensinn ist Volkssouveränität. Allerdings nimmt in seiner Fassung die Gegenspielerin keine institutionelle Form an. „Kommunikative Macht kann nur indirekt, in der Art einer Begrenzung des Vollzugs der administrativen – also der tatsächlich ausgeübten – Macht wirksam werden.“ (Habermas 1993: 630). Habermas will die Begrenzung staatlicher Macht durch Volkssouveränität, die jedoch nicht unmittelbar in den Gesetzgebungsverfahren, sondern durch Deliberation als kommunikative Macht der Öffentlichkeit formiert wird.
Horizontale und vertikale Demokratie
Freiheit und Gleichheit sind also die zentralen Versprechen (oder Prinzipien) der Demokratie. Denkt man sie sich auf zwei Achsen, dann ist die Gleichheit die horizontale und die Freiheit die vertikale Achse. Beide stehen aber in einem gegenseitigen Verwirklichungszusammenhang.
Gleichheit bestimmt das Verhältnis der Bürger*innen untereinander und gegenüber den selbstgegebenen Gesetzen: alle sind formal gleich. Wenn sie etwas über sich beschließen oder sich eine Verfassung geben, tun sie dies als Gleiche und alle unterliegen dem Gesetz auf gleiche Weise. Bürger*innen stehen also zueinander in einem horizontalen Verhältnis. Als Bürger*in sind sie alle gleich. Dies bedeutet nicht, dass sie als Privatperson alle gleich sind – hier beginnt wieder das Problem der sozialen Gleichheit und wird die Frage berührt, wieviel soziale Ungleichheit unter politisch Gleichen geduldet werden kann. Die horizontale Achse der Demokratie kann nämlich bedroht werden durch soziale Ungleichheit, die sich in politische Ungleichheit übersetzt. Die Beispiele für den höchst unterschiedlichen Einfluss von Personen auf politische Entscheidungen oder Debatten und Gesetzgebung, haben zu einer Beschreibung unserer Systeme als „Postdemokratie“ geführt (Eberl/Salomon 2017). Soziale Ungleichheit beeinträchtigt demokratische Gleichheit und beschädigt damit auch das Versprechen der Demokratie. Wird politische Gleichheit wegen der sozialen Ungleichheit aufgehoben, ist auch die Freiheit bedroht, denn Beschlüsse, Verfahren und Gesetze, die von Einzelnen unverhältnismäßig beeinflusst werden können, widersprechen nicht nur der Gleichheit, sondern gefährden auch die Freiheit.
Freiheit kann also durch Ungleichheit gefährdet werden. Aber Freiheit kann auch auf der vertikalen Achse bedroht werden, wo Volkssouveränität als Ausgangspunkt der Gesetze über den beauftragten Gewalten steht. „Dass das demokratische Gewaltenteilungsschema also ganz wesentlich auf der Entgegensetzung von Souveränität und Staatsgewalt beruht, erklärt auch, dass die Legislative im strengen Sinn gar keine ‚Gewalt‘ ist, sondern ‚Souveränität‘, und begründet ihre Dominanz im so genannten Gewaltenteilungssystem, das Vergesetzlichung der Staatsgewalt intendiert.“ (Maus 2004: 839) Die vertikale Anordnung der Gewalten ist ein wesentliches Moment der Freiheitssicherung, weil sich die gesellschaftliche Basis, von der alle Gewalt ausgehen soll, in Form des Gesetzgebers über die Instanzen setzt, die es regieren (Regierung, Verwaltung). Eine Verschiebung dieser vertikalen Anordnung führt zu Selbstermächtigungen der untergeordneten Gewalten und so zu Freiheitsbedrohungen. Ausgangspunkt der vertikalen Anordnung ist die Überzeugung, dass das staatliche Gewaltmonopol gerade wegen seiner allumfassenden Gewalt strikt kontrolliert werden muss.
175 Jahre nach 1848 ist die Erinnerung, dass Demokratie eine Sache der Gleichheit und der Freiheit ist und gegen die Herrschenden erkämpft werden musste, sicher nicht unangemessen. Wer Demokratie will, sollte keine der beiden Achsen vergessen.
Bibliographie
Buchstein, Hubertus 2013: Die Versprechen der Demokratie und die Aufgaben der Politikwissenschaft – Eröffnungsvortrag zum 25. Kongress der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft, in: ders. (Hg.), Die Versprechen der Demokratie, Baden-Baden: Nomos 2023, S. 25-41.
Eberl, Oliver 2021: Naturzustand und Barbarei. Begründung und Kritik staatlicher Ordnung im Zeichen des Kolonialismus. Hamburg.
Eberl, Oliver / Salomon, David (Hg.) 2017: Perspektiven sozialer Demokratie in der Postdemokratie, Wiesbaden: Springer VS.
Eberl, Oliver/Erbentraut, Philipp 2022: Einleitung: Volkssouveränität, Staatlichkeit und intermediäre Organisationen. In: Oliver Eberl/Philipp Erbentraut (Hg.), Volkssouveränität und Staatlichkeit – Institutionen und Räume der Selbstgesetzgebung. Baden-Baden.
Habermas, Jürgen 1993: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates. Frankfurt am Main.
Jörke, Dirk 2010, Die Versprechen der Demokratie und die Grenzen der Deliberation, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 20. Jahrgang (2010) Heft 3-4, 269-290.
Manow, Philip 2020: (Ent-)Demokratisierung der Demokratie. Berlin: Suhrkamp.
Maus, Ingeborg 1994: Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluß an Kant. Frankfurt am Main.
Maus, Ingeborg 2004: Vom Rechtsstaat zum Verfassungsstaat. Zur Kritik juridischer Demokratieverhinderung, in: Blätter für deutsche und internationale Politik Heft 7, 835-850.
Welsch, Martin 2021: Anfangsgründe der Volkssouveränität. Immanuel Kants ‚Staatsrecht‘ in der „Metaphysik der Sitten“. Frankfurt am Main.
Dr. Oliver Eberl ist Privatdozent und Ko-Projektleiter des von der Gerda-Henkel-Stiftung geförderten Projekts „Der Blick nach unten. Soziale Konflikte in der Ideengeschichte der Demokratie“ (www.demokratiekonflikte.de). Sein Buch „Naturzustand und Barbarei. Begründung und Kritik des Staates im Zeichen des Kolonialismus“ (Hamburger Edition 2021) wurde mit dem Preis „Das politikwissenschaftliche Buch“ für das Jahr 2022 der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft (DGfP) ausgezeichnet.
Im Sommersemester vertritt er die Professur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt (eberl@soz.uni-frankfurt.de).
Seine Forschungsschwerpunkte sind Demokratie- und Staatstheorie, Ideengeschichte, Internationale Politische Theorie, Kosmopolitismus, Kolonialismus.