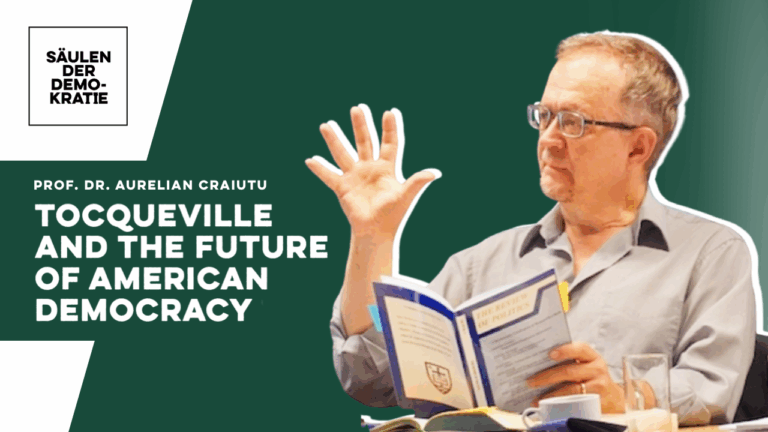„Werd‘ ich doch wohl sagen dürfen, wenn es meine Meinung ist.“ Zum Verhältnis von Demokratie und Wahrheit
von Michael Roseneck (Johannes-Gutenberg Universität Mainz) –
Warnungen vor den Folgen des menschengemachten Klimawandels, Maskenpflicht und Lockdowns während der Corona-Pandemie, Marktversagen in Wohnungsbau und Energiewende – dies sind einige Fragestellungen, in denen unsere Antwort, was zu tun ist, in erheblichem Maße davon abhängt, was wir als wahr erkennen. Gleichwohl macht sich ein Unbehagen bemerkbar, unsere Demokratien verkämen immer mehr zu „elitären Expertokratien“. Man diagnostiziert eine moralisierende, antidemokratische „Epistemisierung des Politischen“ und macht diese dann auch für das Erstarken populistischer, rechtsextremer Bewegungen verantwortlich. Doch das ist nicht nur empirisch falsch[i], sondern verkennt den normativen Sinn von Demokratie.
Das Unbehagen an einer „Epistemisierung des Politischen“ findet seinen Ursprung heutzutage unter anderem in von Carl Schmitt (!) und der postmodernen Vernunftkritik inspirierten, sich selbst als „radikal“ bezeichnenden Demokratietheorien. Ihnen zufolge bedeute Demokratie den nicht allzu eskalativen Kampf um Deutungshoheit und soziale Positionen, keinesfalls aber die öffentliche Verständigung über das bessere Argument. Dies – die Annahme, es gehe in Demokratien auch um den vernunftorientierten Austausch über das, was getan werden soll – verkenne das wahre Wesen des Politischen, wenn nicht gar einer durch und durch kontingenten, aber immer doch vermachteten Welt, setze ferner demokratische Gesellschaften mit Universitätsseminaren gleich und bedinge schlimmstenfalls die Unterdrückung „subalterner Stimmen“, so der Jargon.[ii]
Auf der einen Seite trifft sich hier der auf rhetorischer Ebene emanzipativ und gesellschaftskritisch wirkende radikaldemokratische Diskurs mit reaktionären Stimmen, etwa der Neuen Rechten: Die Schelte einer bildungsbürgerlichen Hegemonie, würde sie ausbuchstabiert werden, passt nur allzu gut zur Kritik an einem „linksliberalen, grünen Konsens“ in Politik, Wissenschaft und öffentlich-rechtlichen Medien.
Auf der anderen Seite erinnern die Positionen radikaler Demokratietheorien aber doch auch eigentümlich an klassisch liberale und libertäre Ansätze. So mahnt Locke im Brief über Toleranz etwa:
„Wenn ein römischer Katholik glaubt, daß das, was ein anderer Brot nennt, wirklich der Leib Christi sei, so tut er dadurch seinem Nächsten kein Unrecht. Wenn ein Jude nicht glaubt, daß das Neue Testament Gottes Wort ist, so ändert er dadurch nichts an den bürgerlichen Rechten der Menschen. Wenn ein Heide beide Testamente bezweifelt, so darf er deswegen nicht als ein gefährlicher Bürger bestraft werden. […] [E]s ist nicht die Aufgabe der Gesetze, für die Wahrheit von Meinungen, sondern für das Wohl und die Sicherheit des Gemeinwesens und der Güter und der Person jedes einzelnen Sorge zu tragen.“[iii]
Vieles ließe sich hier aus philosophischer Sicht der Dinge sagen; etwa, dass der unschuldig eingeführte Kontingenzbegriff – alles könnte doch auch anders sein –, der ja notwendige Vorannahme des Unbehagens an einer Epistemisierung des Willensbildungsprozesses bildet, seinerseits höchst umstritten und metaphysisch aufgeladen ist. Kann er dann überhaupt Grundlage einer normativen Demokratietheorie für pluralistische Gesellschaften sein? Im Folgenden möchte ich allerdings zeigen, dass es auch durch und durch demokratische Gründe für eine gewisse Epistemisierung des Politischen gibt.
I. Warum Demokratie?
Demokratie bringt viele Vorteile mit sich. Was sie aber in letzter Konsequenz begründet, ist, dass sie von der Freiheit und Gleichheit eines jeden Menschen respektive, wie es in Art. 1 GG heißt, einer unantastbaren Menschenwürde, ausgeht.[iv]Zugleich versuchen demokratische Systeme das Zusammenleben der Bürger*innen mit Hilfe von Gesetzen autoritativ zu regeln. Demokratische Herrschaft ist nun einmal Herrschaft. Doch steht dies dann nicht zwangsläufig im Widerspruch zum Selbstverständnis der Demokratie, die Freiheit und Gleichheit einer*eines Jeden zu respektieren? Herrschaft bedeute doch, so könnte gesagt werden, zwangsläufig Freiheitseinschränkung und die Asymmetrie zwischen Herrschendem und Beherrschten.
Demokratische Gemeinwesen versuchen diesen Widerspruch dadurch aufzuheben, dass die Rechtsnormen, welche die Herrschaftsausübung regulieren, gewissen Bedingungen genügen: Die Rechtsnormen stammen (1) (zumindest mittelbar) von den Bürger*innen selbst und (2) dies kanalisiert durch transparente, rechtmäßige Verfahren. Indem sich Bürger*innen selbst die Gesetzte geben oder abändern, mit denen dann Herrschaft ausgeübt wird, komme es idealiter nicht zu illegitimen Zwang. Ganz im Gegenteil: Indem sie sich an der kollektiven Gesetzgebung beteiligen, verwirklichen Bürger*innen als Gleiche unter Gleichen ihre politische Freiheit vielmehr.
Das kann es allerdings noch nicht gewesen sein. Denn es ist denkbar, dass eine Rechtsnorm zwar partizipativ, im regulären Prozess verabschiedet wird, aber dennoch illegitimen Zwang ausübt, zum Beispiel da die Mehrheit einfach über die berechtigten Anliegen einer Minderheit hinwegentscheidet. Es muss folglich noch als dritte Bedingung für demokratisch Legitimität hinzukommen, dass die Rechtsnormen, welche die Ausübung von Herrschaft regulieren, allgemeine Akzeptanz genießen können. „[T]o respect others requires that one refrains from coercing them unless one can provide reasons that, in some way, are accessible to them.“[v] Nur diese drei Bedingungen zusammengenommen können demokratische Herrschaft legitimieren. Beachtete man hingegen die dritte Bedingung nicht, so könnte demokratische Herrschaft auch nicht allgemein gerechtfertigt werden. Sie verkäme dann zu dem, was in der Politischen Theorie bekanntermaßen als „Tyrannei der Mehrheit“ bezeichnet wird.[vi] Oft schütteln wir natürlich den Kopf über sinnlose beziehungsweise uns sinnlos scheinende Gesetze – dennoch können diese potentiell dem Anspruch allgemeiner Akzeptabilität genügen, da sie unter anderem in einem rechtmäßigen Verfahren zustande kamen, die Mehrheit uns nichtsdestotrotz gewisse Gründe für sie lieferte, wir wissen, dass das Gesetz revidierbar ist, und es alles in allem nicht allzu massiv in unser oder das Leben anderer angreift.
II. Demokratie und Richtigkeit
Das Mittel der Wahl, um in Erfahrung zu bringen, welche Begründungen allgemeine Akzeptanz genießen, ist ein möglichst inklusiver und „herrschaftsfreier Diskurs“ (Habermas), in dem unterschiedliche Argumente vorgebracht und geprüft werden können. Der demokratische Diskurs unterscheidet sich dabei etwa von Diskursen in den Wissenschaften insofern, als es hier nicht primär um Wahrheit, sondern um, wie Habermas es nennt, Richtigkeit geht.[vii] Richtig sind dabei die Normen „denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen könnten“.[viii] Die Differenzierung zwischen Wahrheit und Richtigkeit ist aufgrund zweier Erwägungen von Bedeutung.
(I) Was bedeutet es, wenn wir von Wahrheit sprechen? Die äußere Welt erscheint uns zunächst in Form sensorischer Reize – von Farben, Geräuschen und so weiter –, die mithilfe unserer Wahrnehmung zu Perzeptionen zusammengefügt werden und als, wie ich es bezeichnen möchte, Tatsachen mitgeteilt werden können; zum Beispiel: Ich sehe ein Buch vor mir.
Darauf aufbauend lassen sich mindestens zwei Tatsachen durch die Annahme einer Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen ihnen als Kausalzusammenhänge versprachlichen, beispielsweise: Das Buch fällt zu Boden, da es mir aus der Hand gefallen ist. Solche zu Kausalzusammenhängen verbundenen Tatsachen lassen sich eingedenk des Induktionsproblems jedoch nicht beobachten, sondern operieren mit Verstandesbegriffen. Dass das Buch aufgrund von Schwerkraft fällt und nicht von daran interessierten unsichtbaren Wesen aus meiner Hand gerissen wurde, kann ich nicht aus meiner bloßen Beobachtung folgern, sondern nur durch gute Gründe rechtfertigen, die für das Vorhandensein von Schwerkraft sprechen.
Dieser Fall mag noch simpel sein, aber wenn man an Fragestellungen denkt wie beispielsweise, ob es einen Gott gibt, welche Kräfte im Kleinsten und Größten wirken et cetera, wird deutlich, dass die Attribution von Wahrheit zu einer Aussage ein in aller Regel komplexer kognitiver Akt ist. Folglich können Fragen der Wahrheit ein Sprungbrett für epistemisch gerechtfertigteMeinungsverschiedenheiten sein, die dabei so weit reichen, dass zwei gleichermaßen intellektuell redliche sowie perzeptiv und kognitiv kompetente Personen bei derselben Evidenz zu unterschiedlichen, sich ausschließenden Ansichten darüber gelangen, was der vorliegende Fall ist, und (vorläufig) nicht zu entscheiden sein wird, welche der zwei Wahrheitsansprüche epistemisch gerechtfertigt ist.
Wie Rawls anmerkt, werden derartige Konstellation unter den Rahmenbedingungen moderner Vergesellschaftung sogar in ihrer Häufigkeit ansteigen: Indem Modernisierung mit funktionaler Differenzierung einhergeht, vervielfältigen sich in modernen Gesellschaften auch die individuellen Erfahrungswelten je nach Milieu, Beruf und anderer sozioökonomischer Merkmale.[ix] Die anthropologisch konstant wirkenden Bürden des Urteilens erhalten durch diese Pluralisierung der Lebenswelt folglich eine größere Angriffsfläche für unterschiedliche Weltsichten und damit wird in modernen Demokratien der vernünftige Pluralismus darüber, was ist, letztlich unumgehbar zunehmen. Das alles bedeutet nicht, quasi in Form einer radikalkonstruktivistischen Pointe, dass Wahrheitsansprüche vollkommen relativ sind, sondern vielmehr, dass sie als sprachliche Äußerungen immer einen historischen, sozialen und individuellen Index aufweisen und bis zu einem gewissen Grad buchstäblich einseitig und deswegen umstritten sein werden.[x] (Mannheim 1952).
Wenn aber das, was wahr ist, bis zu einem gewissen Grad berechtigterweise umstritten sein wird, müssen demokratische Gesellschaften Wege finden, trotz divergierender Wahrheitsvorstellungen, zu allgemein akzeptierbaren Entscheidungen zu gelangen.
(II) Daneben erinnert uns Habermas daran, dass es im demokratischen Willensbildungsprozess insbesondere um praktische Fragestellungen, das bedeutet um Interessen, Werturteile, Fragen der Gerechtigkeit et cetera.[xi] Es geht um Zielvorstellungen für politisches Handeln – salopp formuliert: wo es hingehen soll. Derartige Themen lassen sich aber nicht auf Diskurse darüber, was wahr ist, reduzieren.
Dass es einen anthropogenen Einfluss auf das Weltklima gibt, ist angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnislage eine durchweg zutreffende Annahme. Wie wir allerdings als Rechtsgemeinschaft damit konkret umgehen wollen – welche Verbote wir erlassen, welche Technologien wir fördern, welche Anreize wir für ökologisches Handeln setzen, wie sich dies alles mit den berechtigen Ansprüchen derer vereinbaren lässt, die außerhalb unserer staatlichen Grenzen leben –, lässt sich nicht einfach auf Fragen der Wahrheit reduzieren.
III. Demokratie und Wahrheit
Vernachlässigen wir einmal die pejorative Konnotation des Begriffs: Ist eine post-truth-democracy nicht dann genau das, was eine liberale Antwort auf die soeben genannten Problematiken nahelegt; und sind dann nicht die Warnungen von einer Epistemisierung der Demokratie vollkommen berechtigt? Ist es nicht zutreffend, wenn zum Beispiel, wie es die AfD tat, vor einer „Corona-Diktatur“ gewarnt wurde, als das RKI signifikant auf die Entscheidungsfindungsprozess während der Coronapandemie Einfluss nahm?[xii] Es gehe doch in der Demokratie nicht um Wahrheit, sondern Richtigkeit.
So zu argumentieren, wäre kurzschlüssig; „[e]ine ,post-truth-democracy‘ […] wäre keine Demokratie mehr.“[xiii] Es geht zwar im demokratischen Diskurs darum, was richtig ist. Allerdings können gut begründete Wahrheitsansprüche in der demokratischen Willensbildung eine mittelbare Wirkung für Richtigkeit übernehmen, etwa im Bereich der Gesundheitspolitik.
Wenn dies der Fall ist, können wir nicht sagen, es gehöre einfach zum Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft, dass man die (vielleicht absonderlichen) Weltdeutungen der*des anderen hinnimmt, denn alles andere wäre etwas wie eine „Corona-Diktatur“ oder eine „Klima-Diktatur“. Wir müssen vielmehr in diesen Fällen nicht plausible Annahmen über das, was wahr ist, nicht deswegen ablehnen, weil sie epistemisch ungerechtfertigt sind – dies können wir natürlich auch als rationale Wesen –, sondern weil sie, wenn sie sich als Gründe in der politischen Willensbildung durchsetzen, Gefahr laufen illegitimen Zwangauszuüben. Wird hier betont, dass Wahrheit eine zentrale Rolle für Demokratie spielt, so nicht aus einem „wissenschaftsanalogen“[xiv] Fehlverständnis des Politischen, wie es radikale Demokratietheorien nahelegen, sondern aus Gründen der Verletzbarkeit des Menschen und der Vermeidung von illegitimem Zwang.
Zur Veranschaulichung: Wenn sich etwa epistemisch zweifelhafte Gründe in der Willensbildung durchsetzen würden, welche die Gefahr durch das Corona-Virus kleinreden, dann hätte dies zur Folge, dass Gesetze verabschiedet werden, welche nicht adäquat auf die Bedrohungslage antworten. Dies zeitigte dann wiederum die Konsequenz, dass mehr Menschen an Corona erkranken und vielleicht auch sterben. Kurzum: Wenn sich in Bezug auf ihre Wahrheit nicht plausible Gründe durchsetzen, so können daraus politische Maßnahmen folgen, die nicht allgemein akzeptabel sind, etwa für vulnerable Gruppen. Dies wäre aber demokratisch illegitim. Indem also in dem Fall Leib und Leben anderer tangiert ist, können wir sagen, dass eine Position, welche die Sorge vor der Ausbreitung von Covid-19 als Panik relativiert, keine bei der demokratischen Entscheidungsfindung zulässige Position ist, die Beachtung finden müsste. Es wäre vielmehr demokratisch illegitim, ihr Beachtung zu schenken. Dies nicht vordringlich, weil sie in epistemischer Hinsicht normativ defizitär ist, sondern auch weil sie in politischer Hinsicht normativ defizitär ist.
Ähnlich verhält es sich mit der Frage des menschengemachten Klimawandels. Demokratische Politiker*innen oder Parteien können für sich nicht einfach in Anspruch nehmen, gut begründete Erkenntnisse der Wissenschaft in Bezug auf die Ursache klimatischer Veränderungen nicht zur Kenntnis zu nehmen. Vielmehr müssen sie dies tun, um etwa Maßnahmen zu entwickeln, die gerade von denjenigen akzeptiert werden können, die durch den Klimawandel betroffen sind, zum Beispiel, um es pointiert zu formulieren, Bewohner*innen von Ahrweiler – von berechtigten Ansprüchen im Kontext von Fragen globaler Gerechtigkeit etwa ganz zu schweigen.
Insbesondere hiermit verbunden ist dann auch die Fragestellung, welche legitime Rolle wissenschaftlichen Expert*innen sowie Einrichtungen wie dem Robert-Koch-Institut oder dem Weltklimarat im demokratischen Willensbildungsprozess zukommen kann, ohne dem Verdacht einer technokratischen „Verwissenschaftlichung der Politik“ mitsamt einer undemokratischen „elitäre[n] Schlagseite“ Vorschub zu leisten.[xv] Wissenschaftler*innen können im arbeitsteiligen Prozess demokratischer Willensbeildung eine zwischengeschaltete Funktion hinsichtlich der Beratung von wirksamen politischen Maßnahmen übernehmen, solange die Zweckbestimmung dieser Maßnahmen einerseits und die letztendliche Entscheidungsbefugnis andererseits bei den Bürger*innen respektive den gewählten Repräsentant*innen verbleiben. „Der Mann, der die Schuhe trägt, weiß am besten, daß und wo sie drücken, auch wenn der fachkundige Schuhmacher am besten beurteilen kann, wie den Beschwerden abzuhelfen ist“.[xvi]
Fassen wir zusammen: Legitime demokratische Willensbildung kann nicht nur ein bloß partizipativer Prozess sein. Sie muss ferner auch ein Verfahren sein, das der Beratung allgemein akzeptierbarer Begründungen dient. Die Beachtung begründeter Wahrheitsansprüche im Willensbildungsprozess rechtfertigt sich dann in gewissen Fällen dadurch, dass sie dem Zweck dient, allgemeine Akzeptabilität überhaupt herzustellen. Eine solche Betonung der Bedeutung von Wahrheitsansprüchen für demokratische Prozesse unterscheidet sich in der Hinsicht von einem expertokratischen und „wissenschaftsanalogen“ Verständnis von demokratischer Willensbildung dadurch, dass die Beratung von Wahrheitsfragen nicht, wie in der Wissenschaft, dem intrinsischen Zweck des schieren Erkenntnisgewinns, sondern extrinsisch der Vermeidung von illegitimem Zwang dient.
Dem „zwanglosen Zwang besserer Argumente“ (Habermas) in Fragen der Wahrheit zu entrinnen und dies dann noch mit Verweis auf demokratisch-rechtsstaatliche Werte wie der Meinungsfreiheit zu rechtfertigen – „werd‘ ich doch wohl sagen dürfen, wenn es meine Meinung ist“ –, kann folglich nicht Ausdruck einer demokratischen Lebensform sein. Wenn populistische Bewegungen und Akteure dies gleichwohl tun, so verletzen sie nicht nur epistemische Werte wie intellektuelle Redlichkeit, sondern auch dezidiert demokratische.
———————————-
Michael Roseneck ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Praktische Philosophie II an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und für Religionsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. Er promovierte zum Verhältnis von pluraler Demokratie und religiösen Geltungansprüchen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Politischen Philosophie, insbesondere zeitgenössische Demokratie- und Gerechtigkeitstheorie, der Sozial- wie auch der Religionsphilosophie.
————————————
[i] Schäuble, Norbert. 2024. „Der Anteil des bürgerlichen Segments bei AfD-Wählern ist kontinuierlich gestiegen.“ Marktforschung.de. Abgerufen am 28. August 2024. https://www.marktforschung.de/marktforschung/a/der-anteil-des-buergerlichen-segments-bei-afd-waehlern-ist-kontinuierlich-gestiegen/.
[ii] Z.B. Butler, Judith, Ernesto Laclau und Slavoj Žižek. 2013. Kontingenz, Hegemonie, Universalität. Wien: Turia plus Kant; Mouffe, Chantal. 2020. The return of the political. London: Verso; Bogner, Alexander. 2021. Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Stuttgart: Reclam.
[iii] Locke, John. [1689] 1957. Ein Brief über Toleranz. Hamburg: Meiner. Hier S. 79-81.
[iv] Kolodny, Niko. 2014a. „Rule over none I: what justifies democracy?“ Philosophy and Public Affairs 42 (3): 195-229; ders. 2014b. „Rule over none II: social equality and the justification of democracy.“ Philosophy and Public Affairs 42 (4): 287-336.
[v] Gaus, Gerald F. 2010. „The place of religious belief in public reason liberalism.“ In Multiculturalism and moral conflict, herausgegeben von Maria Dimova-Cookson und Peter M. R. Stirk, 19-37. London: Routledge. Hier S. 21.
[vi] de Tocqueville, Alexis. [1835] 1987. Über die Demokratie in Amerika. Teil 1. Zürich: Manesse. Hier S. 375.
[vii] Habermas, Jürgen. 1981. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1, Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Hier. S. 26-44; ders. 1991. „Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft.“ In Erläuterungen zur Diskursethik, 100-118. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
[viii] Habermas, Jürgen. 1992. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Hier S. 138.
[ix] Rawls, John. 1989. „The domain of the political and overlapping consensus.“ New York University Law Review 64 (2): 233-255. Hier S. 235.
[x] Mannheim, Karl. [1929] 1952. Ideologie und Utopie. Frankfurt am Main: Schulte-Bulmke.
[xi] Habermas, Jürgen. 1996. „Drei normative Modelle der Demokratie.“ In Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, 277-292. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Hier S. 283f.; ders. 2005. „Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? Der Streit um das ethische Selbstverständnis der Gattung.“ In Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, 34-125. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Hier S. 51.
[xii] Die Zeit. 2020. „AfD spricht von ,Corona-Diktatur‘.“ Die Zeit (29. Oktober 2020), https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-10/corona-beschluesse-angela-merkel-alexander-gauland-kritik-opposition.
[xiii] Habermas, Jürgen. 2005. „Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den ,öffentlichen Vernunftgebrauch‘ religiöser und säkularer Bürger.“ In Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, 119-154. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Hier S. 150f.
[xiv] Jörke, Dirk. 2010. „Die Versprechen der Demokratie und die Grenzen der Deliberation“. Zeitschrift für Politikwissenschaft 20 (3-4): 269-290. Hier S. 275.
[xv] Ebd. Hier S. 277.
[xvi] Dewey, John. [1927] 1996. Die Öffentlichkeit und ihre Probleme. Bodenheim: Philo. Hier S. 172.