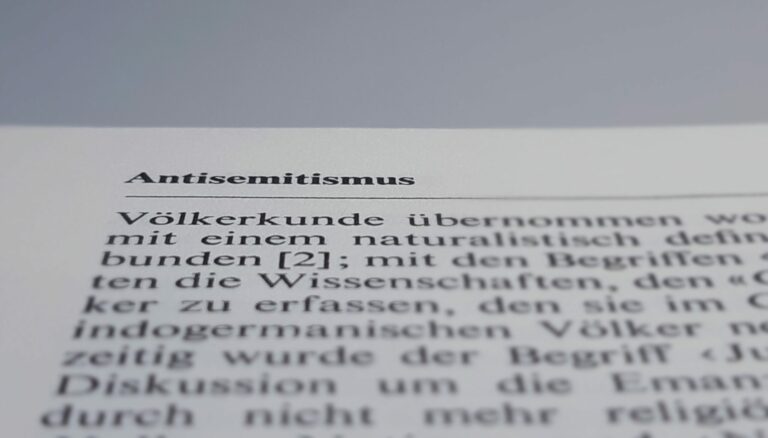Huxleys Albtraum. Über verwerfliche Diskriminierung und die Rolle des Staates
von Michael Oliva Córdoba (Hamburg)
Dieser Blogbeitrag basiert auf einem Aufsatz, der im Schwerpunkt “Diskriminierung” in der Zeitschrift für Praktische Philosophie erschienen ist.
Was ist Diskriminierung? Wann ist sie verwerflich? Dies sind philosophisch heikle Fragen. Mein Beitrag stellt sie in den Zusammenhang der Arbeiten Larry Alexanders und Kaspar Lippert-Rasmussens. Anders als diese Denker nehme ich jedoch primär die Perspektive der Politischen Philosophie ein. Wer einerseits schon mal von einer Meute rechtsradikaler Fußballfans mit „Ausländer raus!“-Rufen durch die Straßen gescheucht wurde, und andererseits auf dem zuständigen Amt um seine Einbürgerung bangen musste, weil er als Jugendlicher demonstrieren gegangen war, der weiß, dass sich beides sehr unterschiedlich anfühlt. Es macht eben einen großen Unterschied, ob mich meine Mitbürger beim Bäcker oder an der Ampel scheel ansehen, oder ob mir dies auf der Wache, auf dem Amt oder vor Gericht widerfährt. Etwas Größeres ist hier im Spiel. Der Blick ‚allein‘ auf das verabscheuungswürdige Verhalten fragwürdiger Individuen fängt dies nicht ein. Im Gegenteil, ein so verengter Blick kann diesen Unterschied sogar verschütten.
Lippert-Rasmussen legt uns die wichtige, allerdings rhetorisch gemeinte, Frage vor, warum Bürgern nicht moralisch verwehrt sein sollte, was dem Staat moralisch verwehrt ist. Dazu kann man einen interessanten Punkt aus einer Überlegung Alexanders herausschälen. Alexander vertritt ja, dass verwerfliche Diskriminierung nicht per se verwerflich ist, sondern (nur) wenn mit ihr moralisch Verwerfliches „kontingent“ verbunden ist oder sie „eine Verletzung von Treueversprechen oder Treuepflichten (fiduciary duties)“ darstellt. Insbesondere der letzte Teil dieser erläuterungsbedürftigen Bemerkung ist interessant. Obwohl nicht speziell auf unseren Punkt gemünzt, wird das Gesagte jedenfalls dann plausibel, wenn wir unsere Betrachtung im Sinne einer Dichotomie vergröbern, die wir in der Politischen Philosophie Thomas Hobbes’ vorfinden, und diese um einige Einsichten John Lockes ergänzen.
Im Leviathan stellt Hobbes ja der Allmacht des Staates die (vergleichsweise) Ohnmacht seiner Bürger gegenüber. Und in seinen Abhandlungen über die Regierung verweist Locke auf das Vertrauen, das zu missbrauchen den Inhaber der staatlichen Gewalt ins Unrecht setzt. Vor diesem Hintergrund ergibt Alexanders rätselhafte Bemerkung plötzlich guten Sinn: Der Treuhänder, der seine Treuepflichten (fiduciary duties) verletzt und sein Treueversprechen bricht, ist dann der allmächtige Staat (oder die Sachwalter seines Gewaltmonopols). Und der Grund, warum ihm verwehrt sein sollte, was dem ohnmächtigen Bürger nicht verwehrt ist, liegt in unserem Staatsverständnis.
Diskriminierung: Gleiche
Es ist keine neue Einsicht, dass unsere Welt nicht ideal ist. John Rawls hielt aus diesem Grund „positive“ Diskriminierung zur Korrektur historischen Unrechts für faktisch erforderlich. In einer idealen Theorie galt ihm affirmative action aber weder als erforderlich, noch als erlaubt. Analog hierzu gilt vielleicht nur in Hobbes’ idealer Welt strikt, dass Bürger einander nicht anders als friedlich begegnen können: Da sie sich ihrer Macht sämtlich zugunsten des Leviathan entledigt haben, bleibt freiwillige Kooperation die einzige mögliche Form sozialer Interaktion. Zugegeben, ideale Annahmen. Doch wenn Rawls uns mit dem Schleier des Nichtwissens etwas über das Gerechte zu sagen vermag, sagt uns Hobbes gewiss nicht weniger über das Politische. Mit Rawls und Hobbes dürfen wir jedenfalls annehmen, dass unsere Begriffe und Intuitionen ihre Schärfe nicht aus den kontingenten Unvollkommenheiten unserer faktischen Existenz herleiten. Wir sind und bleiben immer auch in den Höhen idealer Theorie.
(Politisch) Gleiche, Bürger also, begegnen einander in der hier zugrunde gelegten Hobbes’schen Vergröberung ohne Macht und Zwang. Dennoch können sie einander diskriminieren. Jemand diskriminiert jemanden im Sinne Lippert-Rasmussens, wenn er ihn aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozial salienten Gruppe anders behandelt als andere. Das ist für Lippert-Rasmussen eine Feststellung, die noch auf keine moralische Beurteilung festlegt. Wird durch die Behandlungen jedoch (ungerechtfertigter) Schaden zugefügt, oder wird durch sie im Sinne Benjamin Eidelsons (geschuldeter) Respekt verweigert, liegt (moralisch) verwerfliche Diskriminierung vor. Dieses hybride Verständnis setze ich bei meinen Ausführungen jedenfalls voraus.
Ist Diskriminierung unter Gleichen nun stets verwerflich? Eine interessante Klasse von Beispielen stellen die Fälle sexueller Diskriminierung dar. Anders als man denken könnte ist sexuelle Diskriminierung nicht automatisch Sexismus. Auch die moralisch unverdächtige freie Wahl des eigenen Sexual- oder Liebespartners kann bei Lichte betrachtet sexuelle Diskriminierung sein. Philosophen machen sich nun selten klar, was für Sozialpsychologen selbstverständlich ist: Die Zugehörigkeit zu sozial salienten Gruppen spielt für die Empirie menschlicher Partnerwahl eine wichtige Rolle. Im Gewande der ethnologischen Rede von endogamen (d.h. gruppeninternen) und exogamen (d.h. gruppenexternen) Präferenzen bei der Partnerwahl können sagen, dass es sowohl kollektiv wie individuell endogame wie exogame Präferenzen bei der Wahl des eigenen Sexual- oder Liebespartners gibt. Und dies, obwohl dies typischerweise keine „Wahl“ ist, sondern uns als Anziehungserlebnis„widerfährt“.
Macht man sich dieses klar, sieht man, dass Diskriminierung unter Gleichen keineswegs stets verwerflich ist. So verletzt und wenig respektiert man sich durch solche diskriminierende Präferenzen bei der Partnerwahl auch fühlen mag: Weder haben wir einen Anspruch darauf, dass uns jemand anziehend findet, noch kann das zum Objekt unserer Begierde erkorene Gegenüber frei entscheiden, was einen Partner für es anziehend macht. Wir mögen als soziale Wesen also regelmäßig sexuell diskriminierende Präferenzen bei der Partnerwahl haben; letztlich ist dies jedoch nicht einfach eine Art „sexueller Rassimus“, sondern Ausfluss unserer sexuellen Selbstbestimmung. Und darauf haben wir sogar ein Recht. Die Willkürlichkeit und Subjektivität der menschlichen Partnerwahl als auszumerzende Unvollkommenheit zu sehen, würde uns in Aldous Huxleys Dystopie Schöne Neue Welt versetzen. Huxleys Albtraum als Albtraum ernst zu nehmen heißt, sexueller Diskriminierung das Stigma des Verwerflichen zu nehmen.
Schaut man sich diese für unser Selbstverständnis zentrale Beispielklasse genauer an, wird viele klarer. Denken wir zum Beispiel an diskriminierende Präferenzen im alltäglichen Wirtschaftsleben. Jenseits aller Missverständnisse des Ökonomischen kann man sich ganz grundlegend folgendes klar machen: Was könnte schlimmer sein als die Zurückweisung durch das Objekt tiefer und aufrichtiger Liebe? Wo die Zurückweisung als Sexual- oder Liebespartner womöglich existenziell schmerzhaft, aber moralisch zulässig ist, ist es die Zurückweisung meines Tauschgutes oder meiner selbst als Tauschpartner allemal.
Diskriminierung: Ungleiche
Dass alle legitime Herrschaft auf Zustimmung beruht, ist eine der wichtigsten Einsichten der modernen Politischen Philosophie. Denken wir uns das Gemeinwesen also mit Hobbes und Locke als durch Zustimmung konstituiert. Denken wir uns seinen Repräsentanten, den Inhaber aller staatlichen Gewalt, mit Locke als durch ein Mandat berufen, dessen Umfang durch diese Zustimmung bestimmt ist. Denken wir uns zudem, dass der Repräsentant gelobt hat, dieses Mandat zu achten. Wir erweitern dann Hobbes’ Verständnis zu einem moderneren Verständnis des Gemeinwesens. Der Inhaber der staatlichen Gewalt ist nicht länger ungebundener Souverän außerhalb des Rechts, der gar nicht unrecht handeln kann. Er ist stattdessen lediglich Treuhänder. Recht und Gewalt sind ihm anvertraut, doch bleibt er ans Recht gebunden.
Was nun, wenn dieser Treuhänder sein Mandat verletzt? Das wäre die Verletzung eines Versprechens (seines Gelöbnisses) und ein Bruch der Treuepflicht (seiner Verpflichtung als Treuhänder). Wenn er sein Mandat durch unterschiedliche Behandlung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozial salienten Gruppe verletzt, dann haben wir staatliche Diskriminierung: Machtmissbrauch in Gestalt des „breach of promises or fiduciary duties“.
Politisch wie moralisch kann es kaum einen größeren Unterschied geben als den zwischen der Diskriminierung unter politisch Gleichen und der Diskriminierung durch denjenigen, dem wir alle politische Gewalt übertragen und dem gegenüber wir uns um des Gemeinwesens willen wehrlos gemacht haben. Wo der Staat als Diskriminator auftaucht, tut er etwas, dessen Reichweite gerade wegen seiner Allmacht tendenziell unabsehbar ist, und das nur er tun kann: Der Treuhänder staatlicher Gewalt bricht sein Treueversprechen und verletzt seine Treuepflicht. Mein Nächster nicht.
Das Fazit ist mithin paradox. An sich ist Diskriminierung nie verwerflich. Nur im Falle staatlicher Diskriminierung ist sie notwendigerweise verwerflich. Dort ist sie es aber aus einem anderen Grund: Machtmissbrauch. Es gehört also nicht die moralische Vorzüglichkeit des Einzelnen auf den Prüfstand, sondern die politische des Staates, wenn uns sowohl die Vermeidung verwerflicher Diskriminierung ein Anliegen ist als auch die Freiheit des Individuums.
Dr. Michael Oliva Córdoba ist wissenschaftlicher Koordinator des Fachbereichs Philosophie der Universität Hamburg. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Sprachphilosophie und der Handlungstheorie. Sein primäres Forschungsprojekt untersucht den praxeologischen Zusammenhang zwischen Handeln und Freiheit.
Thematisch Anschließendes zum Weiterlesen
„Die Theorie des gerechten Preises im Lichte von Codex Iustinianus 4.44.2 und 4.44.8“, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Bd. 105, Nr. 4, Oktober 2019, S. 553–575.