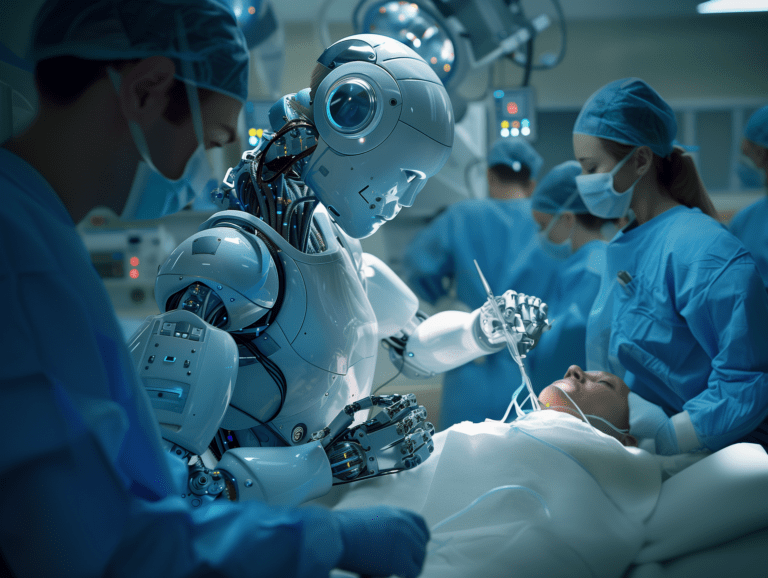Für Forschendes Lernen braucht man keinen Seminarraum
von Joschka Haltaufderheide (Potsdam) & Katja Kühlmeyer (München)
Eine typische Stellenanzeige, die über den Verteiler der medizinethischen Fachgesellschaften verschickt wird, sucht einen Postdoc für ein neues Drittmittelprojekt. Es soll um die ethischen, rechtlichen und sozialen Implikationen einer neuen digitalen Gesundheitsanwendung gehen. Es stellen sich sozial-empirische und ethisch-normative Forschungsfragen. Das Anforderungsprofil umfasst neben Kenntnissen der sozial-empirischer Forschung und philosophischer Theorie auch Erfahrung im interdisziplinären Arbeiten. Moment einmal – wie werden Forschende am Anfang ihrer Forschungskarriere eigentlich zu solchen komplexen Leistungen befähigt?
Als Forschende und Lehrende an medizinethischen Abteilungen und Lehrstühlen sehen wir eine unserer Aufgaben darin, Studierende, Promovierende und andere Mitarbeitende mit unserem Fach und seinen Forschungsmethoden vertraut zu machen. Die Begeisterung für ein Forschungsgebiet oder eine bestimmte Fragestellung ist oft der erste Schritt in Richtung einer Promotion, die wiederum neue Karrierewege eröffnet. Der zweite und ebenso notwendige Schritt besteht im Erwerb methodischer Kompetenzen mit denen solche Fragen beantwortet werden können. Als Lehrende sehen wir jedoch auch ein strukturelles Desinteresse an guten und innovativen Lehrformaten, die einen Kompetenzerwerb ermöglichen können. Wir sehen, wie sich fakultativ organisierter Lehr- und Lernkulturen beharrlich unverändert fortsetzen. Gleichzeitig sind wir mit vielen Hindernisse in der Implementierung neuer Lehrformate konfrontiert, die insbesondere interdisziplinäres Lehren und Lernen schwierig machen. Vor allem aber sehen wir das Fehlen von didaktischen Konzepten, die den Besonderheiten medizinethischer Forschung Rechnung tragen. Folgende Klagen haben viele schon einmal gehört, die in ähnlichen Situationen innovativ lehren wollen: Die curricularen Vorgaben: zu streng, der Stundenplan: zu eng, die Differenz der Lernkulturen: zu groß, der Aufwand: zu hoch. Und dann auch noch Nachwuchs für die Arbeitsgruppe aus der Lehre heraus rekrutieren? Warum denn? Ist der Arbeitsmarkt nicht groß genug, um Drittmittel-Stellen zu besetzen?
Tatsächlich ist der Arbeitsmarkt sehr heterogen und oft können Bewerber:innen nur einen Teil der Anforderungen erfüllen. Das andere werden sie schon im Projekt lernen – aber werden sie das, und wenn ja wie? Noch weigern wir uns beharrlich, uns vor der Kraft des Faktischen in der universitären Lehre im vorauseilenden Gehorsam zu beugen. Wir möchten vielmehr dafür werben, das Verständnis der medizinethischen Lehre zu überdenken. Es mag schwierig sein, die strukturellen Gegebenheiten zu verändern. Das konzeptuelle Vakuum lässt sich allerdings beheben: Was es braucht sind Lehrende, die nicht nur als Vermittelnde gewisser Inhalte sondern auch als Vermittelnde einer bestimmten Art der Forschung sichtbar werden. Was gelehrt werden muss ist nicht nur Medizinethik als ein Bestand von Wissen, sondern Medizinethik als eine methodische Praxis, die dabei helfen soll, mit praktischen Problemen ethisch angemessen umzugehen.
Wie das gehen könnte, haben wir kürzlich auf Grundlage eines Konzeptes des Forschenden Lernens dargelegt. Die Arbeit ist das Ergebnis eines langen Prozesses der Klärung der Konzepte und der Reflexion der praktischen Erfahrungen mit Formaten des forschungsorientierten Lernens. Wir sind zu der Überzeugung gelangt, der beste Weg dafür medizinethische Forschung zum Lehrgegenstand zu machen ist, interessierten Menschen die Gelegenheit zu geben, durch ein eigenes Forschungsprojekt eine Lernerfahrung mit dem Fach zu machen: Ethikbildung als Selbstbildung. Wer wissen will, wie Medizinethik-Forschung funktioniert, der soll Forschung erfahren. Zunächst haben wir uns darum bemüht, Seminarangebote auf die Beine zu stellen. Studierende sollten in Lehrforschungsprojekten eigene Fragstellungen und ein eigenes Forschungsdesign entwickeln oder ein Forschungsdesign realisieren, und die gemachten Erfahrungen reflektieren. Das Lehrangebot war freiwillig, entweder ein Wahlfach unter vielen anderen oder ein Zusatzangebot. Die Studierenden, die sich dafür interessiert haben, waren oft intrinsisch motiviert und es war eine beglückende Erfahrung, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Es waren Fragestellungen, die eine Relevanz für medizinethische Diskurse hatten, aber nicht notwendigerweise normativ-ethische Fragen, die wir dabei in den Blick genommen haben. Public Health Studierende haben Impfgegener:innen zu ihrer Einstellung zum Impfen befragt oder Studierende aus Medizin, Sozialwissenschaft und Philosophie haben sich mit Psychiatrie-Erfahrenen über den Krankheitsbegriff in der Psychiatrie ausgetauscht.
Daraus ist schließlich die Idee entstanden, systematischer zu beschreiben, worum es uns gerade in der Medizinethik gehen sollte, wenn wir Prozesse ermöglichen und begleiten, bei denen empirische Forschung mit normativen Überlegungen verbunden wird. John Dewey beschreibt Forschen (und auch Lernen) als eine aktive Auseinandersetzung mit den Unsicherheiten und Unwägbarkeiten der Welt und deren Überwindung. Das Ziel, so haben es die pragmatischen Lerntheoretiker nach ihm formuliert, ist es, Handlungsfähigkeit im Angesicht von Unsicherheit und Ambiguität herzustellen. Wir verstehen medizinethische Forschung als das Erlernen bestimmter methodischer Reaktionsmuster auf solche Ungewissheiten.
Der Vorteil dieser Betrachtungsweise liegt erstens darin, die Methodizität dieser Reaktionsmuster zerlegen und beschreiben zu können. Das mag nicht ganz leicht sein, da die Medizinethik immer durch eine gewisse Methodenpluralität gekennzeichnet ist. Im Grundsatz läuft forschendes Handeln in der Medizinethik jedoch auf eine Verzahnung empirischer Daten und normativer Theorieelemente hinaus, die jeweils eine spezifische Haltung voraussetzen, die wir als reflektiv (in Bezug auf die Methode) und reflexiv (in Bezug auf den Forschenden selbst) beschreiben. Dies ermöglicht es zweitens den Forschungsprozess unter dem Zielsystem „Lernen“ zu betrachten und zu fragen, welche Unterstützung es braucht, damit bestimmte Schritte dieser Reaktionsmuster ausgeführt und die entsprechende Haltungen erfahren werden können. Das Ergebnis dieser Überlegungen sind zielgerichtete Empfehlungen für das Handeln von Lehrenden in bestimmten Lehrsituationen.
Der Rekurs auf die pragmatischen Lerntheorien, der sich in unseren Überlegungen andeutet, hat bei uns nicht nur zu einem anderen Verständnis von Lehre geführt. In seiner Allgemeinheit illustriert er die Nähe, die zwischen Prozessen der Forschung, der Lehre und der (unterstützten) ethischen Urteilsbildung bestehen. Ein konkretes Beispiel, wie Forschen, Lernen und sogar Beratung zusammenfallen kann, ist die ethische Fallberatung im klinischen Kontext. Hier wird der Einzelfall zum Lernobjekt. An ihm kann mehr erfahren werden, als nur die Lösung des konkreten Problems, mit dem eine Ärztin gerade betraut ist. Ethikberater:innen werden im Vorfeld der Beratung und im Moderationsprozess zu Forschenden, und sie werden zu Dozierenden, die inhaltliche und methodische Orientierung ermöglichen und die Entwicklung einer Lösungsstrategie befördern. Am Ende stoßen sie einen Reflexionsprozess an, der aufzeigen soll, wo das Vorhaben womöglich (noch) nicht gelungen und das Ergebnis verschiedenen Ansprüchen (noch) nicht gerecht geworden ist.
Durch die Skizzierung dieses Arbeitsprozesses hat sich für uns die Art und Weise verändert, wie wir diese Aufgaben begreifen. Der Blick auf den Output, das Ergebnis der Forschung, das Paper, die Monographie, das Poster oder die Kongresspräsentation weicht dem Blick auf unterschiedliche Lern- und Erfahrungsprozesse, die in den Vordergrund gerückt werden. Daran anschließend stellen sich neue Fragen: (Wie) kann man die Forschenden motivieren, sich mit einer medizinethischen Fragestellung zu beschäftigen? Was brauchen sie, um zu einem (Zwischen-)Ergebnis zu kommen aus dem andere wiederum etwas lernen können? Wie können wir sie darin fördern, ihren eigenen Erkenntnisweg zu reflektieren?
Was wir beschreiben und wofür wir im Rahmen unseres Konzeptes werben möchten ist eine Art humanistischer Pragmatismus. Wir verstehen die beschriebenen Abläufe als einen universellen Prozess, der nicht an einen Seminarraum oder ein bestimmtes didaktisches Setting gekoppelt ist, sondern der in unterschiedlichem Rahmen (z.B. in einem Forschungspraktikum, einer Qualifizierungsarbeit, in der Anleitung von Mitarbeiter:innen oder im beruflichen Alltag als klinische Ethikberater:in), wieder und wieder zu erkennen ist. Wir sehen Forschendes Lernen als eine zentrale Methode zum Erwerb von medizinethischen Problemlösekompetenzen. Wir hoffen, mit diesem Gedankenanstoß einen Beitrag zu leisten, der Bewusstsein für das eigene Tun und Orientierung schafft. Wir denken, dass diese nicht nur, aber auch, für die Befähigung und Förderung von Forschenden und Praktiker:innen am Anfang ihrer Karriere in der Medizinethik von Bedeutung ist.
Dieser Blogbeitrag basiert auf einem Aufsatz, der in Ethik in der Medizin erschienen ist.
Joschka Haltaufderheide ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juniorprofessur für Medizinethik mit Schwerpunkt auf Digitalisierung an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg, Universität Potsdam. Er hat unter anderem an der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Duisburg-Essen gelehrt. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Ethik neuer Bio- und Gesundheitstechnologien.
Katja Kühlmeyer ist Akademische Rätin am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie ist dort Studienbeauftragte und unterrichtet neben Medizinethik und -theorie auch Methoden der qualitativen Sozialforschung. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich vor allem mit der Translation von Ethik in die medizinische Praxis.