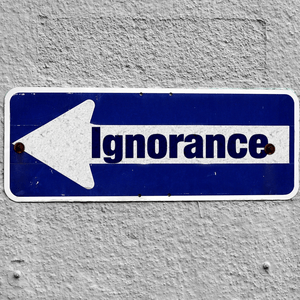
„Chaos in Ordnung bringen“. Zum Umgang mit Unsicherheit und Ungewissheit im Recht
Von Ino Augsberg (Kiel)
I. Einleitung
Rudolf Wiethölter, einer der wichtigsten deutschen Rechtstheoretiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, charakterisiert sein Verständnis des Rechts gerne mit einer Formel, die er selbst von Adorno übernommen haben will. Diese Quellenangabe ist allerdings eher Reverenz als Referenz. Denn sie unterschlägt, dass der entscheidende Witz jener Formel erst durch Wiethölter geschaffen wird. Erst seine Streichung eines bei Adorno noch gegebenen bestimmten Artikels subvertiert die Ordnung des originalen Satzes und bringt dessen ursprünglich eindeutige Aussage in die Schwebe einer gegenwendigen Doppelbedeutung. Aus Adornos etwas bemüht antibürgerlicher Formulierung, „Aufgabe von Kunst heute“ sei es, „Chaos in die Ordnung zu bringen“ (Adorno 1994, 298), wird bei Wiethölter die knappere, auch imperativisch zu lesende Formel: „Chaos in Ordnung bringen“ (Wiethölter 1994, 107; dazu näher Zabel 2019), die sich in beide Richtungen zugleich lesen lässt, weil sie sowohl Ordnen des Chaos wie Chaotisierung der Ordnung heißen kann.
Wiethölters Formel bildet nicht nur eine prägnante Kennzeichnung für die Ambiguität des Rechtssystems im Ganzen. Sie lässt sich insbesondere auch zur näheren Erläuterung des juristischen Umgangs mit Unsicherheit und Ungewissheit verwenden. Klassisch besteht die Aufgabe des Rechts natürlich vor allem darin, das Chaos zu ordnen, indem Ordnung und Sicherheit gewährleistet, also mögliche Unsicherheitsfaktoren eliminiert werden (II.). Weil Unsicherheit und Ungewissheit allerdings nicht überall und stets vollkommen verhindert und überwunden werden können, müssen die rechtlichen Mechanismen auch Strategien beinhalten, wie mit unbewältigbarer, chronifizierter Ungewissheit, also mit Nichtwissen umzugehen ist (III.). Noch über eine solche bloße Akzeptanz von Ungewissheit hinausgehend kann Umgang mit Ungewissheit im und durch Recht schließlich noch etwas Drittes heißen: In dem Maße, in dem Ungewissheit für die moderne Gesellschaft vielfach nicht nur eine Bedrohung, sondern eine wesentliche Funktionsbedingung bildet, muss es den rechtlichen Mechanismen auch darum gehen, diese spezifischen Formen von Ungewissheit zu erhalten und sogar selbst erst zu schaffen. Recht dient danach auch dazu, Tendenzen zu übermäßiger Ordnung mit den Gegenkräften einer Re-Chaotisierung zu konfrontieren (IV.). Ein knappes Fazit fasst den Gedanken noch einmal zusammen (V.).
II. Ordnung und Sicherheit durch Recht
Die Bekämpfung von Unsicherheit oder positiv formuliert, die Gewährleistung von Sicherheit, zählt zu den klassischen Kernfunktionen des Staates (vgl. nur BVerfGE 49, 24 [56 f.]; ausführlich Möstl 2002). Die Rede von der „Sicherheit“ hat hier den Sinn, bestimmte äußerliche Bedrohungslagen von vorneherein zu verhindern oder zumindest zu entschärfen. Das Recht ist in dieser Hinsicht ein besonders bewährtes Mittel, um in Gestalt eines allgemein verstandenen „Sicherheitsrechts“, oder etwas genauer gefasst, eines Gefahrenabwehrrechts, mögliche Bedrohungen von als besonders schützenswert postulierten Rechtsgütern – klassischerweise vor allem: die Individualrechtsgüter der Bürgerinnen und Bürger, Bestand und Funktionsfähigkeit des Staates und seiner Einrichtungen sowie die Rechtsordnung selbst, sofern sie konkrete Verhaltensge- und -verbote enthält – fernzuhalten (vgl. nur BVerfGE 69, 315 [352]).
Die Gewährleistung zureichender Sicherheit kann aber auch in einer epistemischen Hinsicht eine Rolle spielen. Es geht demnach nicht primär um Sicherheit qua securitas, sondern um Gewissheit, certitudo. Die Rationalität staatlicher Entscheidungsprozesse setzt eine zureichende Kenntnis der zu regelnden Sachverhalte voraus. Wenn das Recht als ein Hauptmedium im Kontext der Erfüllung dieser Regelungsaufgaben eingesetzt wird, müssen auch für seine Entscheidungen jeweils umfangreiche, hinreichende Sachkenntnisse bestehen. Einzelne Mechanismen, wie insbesondere die Offizialmaxime im Verwaltungsrecht, die die Behörden zu einer umfangreichen Sachverhaltsaufklärung verpflichten, und ebenso etwa die Notwendigkeit der Einbeziehung von Sachverständigengutachten, tragen diesem Gedanken Rechnung. Sie dienen dazu, auf der Seite der Entscheidungsträger zunächst noch bestehendes Nichtwissen in Wissen zu transformieren (vgl. Wollenschläger 2009; Augsberg 2014, 41 ff.).
Schließlich kann sich die zu gewährleistende Sicherheit auch noch auf das Recht selbst beziehen. Als „Rechtssicherheit“ bezeichnet sie den Grundpfeiler nicht allein der Rechtsstaatsidee, sondern genauer betrachtet des Rechtsbegriffs überhaupt, weil nur ein sich von Willkür freihaltendes, auf eine bestimmte interne Konsistenz seiner eigenen Entscheidungspraxis verpflichtetes System sich hinreichend von lediglich politisch zu nennenden ad hoc-Entscheidungen abgrenzt (vgl. ausführlich von Arnauld 2006).
III. Umgang des Rechts mit irreduziblem Nichtwissen
Gerade das moderne Recht muss allerdings auch anerkennen, dass Unsicherheit und Ungewissheit nicht vollständig bewältigbar sind. Weil Sicherheit qua securitas immer auch Einschränkung von Freiheit bedeutet, ist maximale Sicherheit weder sinnvoll noch wünschenswert; ein gewisser Rest an Unsicherheit muss daher stets bleiben. Noch deutlicher ist das Problem bei der certitudo: Der enorme Zuwachs an wissenschaftlichem Wissen führt nicht etwa nur dazu, dass Wissenslücken geschlossen werden, also eine immer größere epistemische Sicherheit erreicht wird. Im Gegenteil: Mehr Wissen kann sogar zu mehr Nichtwissen führen, insofern sich neue, bis dahin nicht einmal bekannte Fragehorizonte öffnen. Ungewissheit bildet daher nicht nur ein epistemisches im Sinne eines quantitativen Problems, das heißt einer noch unzureichenden Menge an Wissen, das lediglich aus Zeitnot nicht vollständig beim zuständigen Entscheider gesammelt und verarbeitet werden kann. Ungewissheit präsentiert sich vielmehr auch als epistemologisches Problem, dem zufolge die Gewinnbarkeit des erforderlichen Wissens überhaupt nicht länger möglich erscheint.
Juristisch erforderlich sind damit Strategien, die trotz fortbestehender epistemischer Unsicherheit rationale Entscheidungen ermöglichen. Benötigt werden dafür Verfahren, die Ungewissheit nicht durch Gewissheit beseitigen, sondern funktionale Äquivalente etablieren, durch deren Einsatz so entschieden werden kann, als ob hinreichende Gewissheit bestünde. Im Anschluss an James March und Herbert Simon (March/Simon 1958, 165) sowie Helmut Willke (Willke 2002, 77) lassen sich in dieser Hinsicht Verfahren der Ungewissheitsabsorption und der Etablierung von Ignoranzderivaten unterscheiden (vgl. zum Folgenden ausführlich Augsberg 2014, 237 ff.).
Ungewissheitsabsorption meint Techniken, die zwar nicht die Ungewissheit als solche, aber doch ihre die Entscheidungsfindung paralysierenden Effekte verschwinden lassen. Das typische Beispiel ist die Substitution von epistemischer durch kompetenzielle Autorität: Die Entscheidung des Chefs ist nicht mehr in Frage zu stellen, unabhängig davon, ob für sie hinreichend plausible Gründe angegeben wurden (vgl. Luhmann 2000, 20 f.). Ganz analog funktionieren Subjektivierungsstrategien. Ausreichend ist danach nicht allererst ein absolutes, objektives Wissen, sondern das notwendigerweise begrenzte Wissen eines konkreten Entscheiders zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa eines zuständigen Polizeibeamten bei der Beurteilung einer etwaigen Gefahrenlage. Beweislast- und Vermutungsregeln und Legalfiktionen dienen unter diesem Blickwinkel betrachtet derselben Funktion der Ungewissheitsabsorption. Typisch ist zudem die Sequenzialisierung von Entscheidungsprozessen, der gemäß jeweils für einzelne kleinere Abschnitte Entscheidungen getroffen werden, die dann in den nachfolgenden Sequenzen nicht mehr in Frage gestellt werden dürfen.
Während die „Absorption“ von Ungewissheit in diesen Konstellationen demnach vorwiegend eine Verdeckung fortbestehender Ungewissheit bezeichnet, folgen die Ignoranzderivate einem anderen Grundansatz. Ungewissheit wird hier sogar stärker hervorgehoben und vervielfältigt. Sie soll gerade dadurch aber wiederum in ihren destruktiven Auswirkungen neutralisiert werden. Durch die Aufspaltung einer scheinbar einzigen, monolithischen Ungewissheit in zahlreiche kleinere Ungewissheiten wird in der Summe die Gesamtungewissheit vielleicht sogar noch erhöht. In jedem einzelnen Verfahrensabschnitt oder jeder einzelnen Teilentscheidung jedoch macht sich der hemmende Aspekt des Ungewissheitsmoments weniger gravierend bemerkbar. In diesem Sinne lassen sich die Techniken der Punktualisierung oder Sequenzialisierung von Entscheidungsprozessen nicht nur als Ungewissheitsabsorption, sondern zugleich auch als Ignoranzderivate lesen. Noch deutlicher wird das Verfahren dort, wo unterschiedliche Formen von Ungewissheiten konstruiert werden. Versicherungen etwa reduzieren nicht lediglich das Sachrisiko eines bestimmten, durch den Versicherten verursachten Schadenseintritts, indem sie sich selbst mit einem komplementären finanziellen Risiko für den Eintritt des Haftungsfalls belasten. Sie schaffen vielmehr zugleich ein zusätzliches finanzielles Risiko auf der Seite des Versicherten, der im Fall des ausbleibenden Haftungsfalls frustrierte Aufwendungen in Gestalt der Versicherungsprämien zu tragen hat. Die entsprechende Grundkonstruktion lässt sich dann weiter verkomplizieren, etwa durch die Einführung gesetzlicher Haftungsobergrenzen oder eine Rückversicherung der Versicherer selbst. Das entscheidende Muster bleibt dasselbe: Wiederum werden Ungewissheiten nicht beseitigt, sondern vervielfältigt, aber zugleich auf verschiedene Träger verteilt und durch diese Streuung für jeden einzelnen Beteiligten leichter tragbar.
IV. Ungewissheit durch Recht
In der modernen Gesellschaft ist Ungewissheit aber nicht ausschließlich eine Bedrohung, die so weit wie möglich beseitigt, verdrängt oder zumindest durch Streuung erträglich gestaltet werden muss. Ungewissheit ist vielfach auch eine Funktionsbedingung für bestimmte gesellschaftliche Prozesse. Sie muss deswegen an diesen Stellen mit Hilfe des Rechts auch bewusst geschaffen und erhalten werden.
Exemplarisch verdeutlichen lässt sich dieser Zusammenhang an der ökonomischen Grundsituation des Börsengeschäfts einerseits und dem demokratischen Verfahren andererseits. Beide Konstellationen sind durch Ungewissheit nicht nur bestimmt, sondern bedingt. Eine positive Kenntnis, sogar nur die Annahme einer objektiven Erkennbarkeit, der wirtschaftlichen Entwicklung und der daraus resultierenden Situation an der Börse würde den Gesamtprozess zerstören. Wenn sich Aktienkurse sicher vorhersehen ließen, entfiele jeder Anreiz zur Spekulation und damit der Sinn von Aktien(ver)käufen (jenseits der Dividendenzahlung) überhaupt (vgl. Esposito 2007, 100 ff.). Entsprechendes gilt für das demokratische Verfahren (vgl. Lefort 1990). Auch dieses ist nur insoweit sinnvoll und erforderlich, wie expertokratische Muster sich als unzureichend erweisen oder sich zumindest in der historischen Erfahrung bislang erwiesen haben. Wären Fragen des Gemeinwohls wahrheitsfähig und damit unmittelbar wissenschaftlicher Expertise zugänglich, bedürfte es keiner demokratisch-prozeduralen Ausgestaltung politischer Entscheidungsfindung. Man müsste überhaupt nicht mehr im engeren Sinne entscheiden, sondern nur noch erkennen. Mehr noch: Gäbe es eine höhere Einsicht in das politisch Notwendige, die von den gewählten Entscheidungsträgern jedoch ignoriert wird, wäre ein Festhalten an den demokratischen Verfahren nicht nur entbehrlich, sondern sogar schädlich. Demokratie setzt demnach strukturell Ungewissheit voraus.
Aus dieser Perspektive wird deutlich, warum die Aufforderung, politische Entscheidungen eng an wissenschaftliche Expertise anzubinden, etwa in Gestalt der für die Durchsetzung bestimmter (klima-)politischer Ziele erhobenen Forderung „unite behind the science“, auch eine dunkle Seite hat, die sie als potentiell demokratiefeindlich markiert: In dem Maße, in dem eine derartige Aufforderung bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse als absolut setzt, also als nicht mehr verhandelbar bestimmt, lässt sie der Politik keine eigene Bedeutung mehr, sondern schließt politische Legitimation mit spezifischen inhaltlichen Positionen kurz. Slogans wie „Die Natur verhandelt nicht!“ richten sich gegen Verhandlung und Kompromissbildung als typische Elemente demokratischer Entscheidungsfindung. Das demokratische Verfahren bildet keinen Eigenwert mehr; die in ihm zustande gekommene Entscheidungen gelten nicht länger per se als gerechtfertigt. Sie erscheinen nur dann als akzeptabel (und nicht als bloß „faule“ Kompromisse), wenn sie mit jenen bestimmten Erkenntnissen „der“ Wissenschaft übereinstimmen.
Die rechtlichen Mechanismen des modernen Verfassungsstaats deuten demgegenüber in eine andere Richtung. Sie zeugen von einem Gesellschaftsverständnis, in dem die Existenz absoluter Wahrheiten auch und gerade durch Wissenschaft nicht gewährleistet werden kann und eben deswegen Alternativstrategien gesucht, gefunden und schließlich mit Hilfe des Rechts eingerichtet und stabilisiert wurden.
Das betrifft zunächst die Ausgestaltung des demokratischen Prozesses im Allgemeinen und des Wahlrechts im Besonderen. Dass für demokratische Wahlen das Prinzip „one man, one vote“ gilt, das keine Differenzierung nach allgemeinen intellektuellen Fähigkeiten oder speziellen, idealerweise wissenschaftlich fundierten Kenntnissen der Wahlberechtigten zulässt, verweist auf ein Modell, dessen normative Grundannahme offensichtlich darin besteht, dass alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen fähig – oder: unfähig – sind, politische Konflikte kognitiv zu bewältigen.
Eine ganz analoge Funktion zeigt sich in den grundrechtlichen Schutzmechanismen. Insbesondere, aber nicht nur die Wissenschaftsfreiheit macht das deutlich. Gerade die wissenschaftliche, theoretisch über sich selbst aufgeklärte Wahrheit ist danach von absoluter Gewissheit zu unterscheiden. Sie muss vielmehr im klassischen Humboldt’schen Sinn als etwas stets Aufgegebenes, immer weiter zu Suchendes, „nie ganz Aufzufindendes“ verstanden werden (vgl. BVerfGE 35, 79 [113]). In der Konsequenz dieses Grundverständnisses liegt es, dass die Grundrechte nie nur die jeweils bestehende Mehrheitsauffassung schützen. Sie sind vielmehr immer auch als eine Art über den engeren Bereich des Ökonomischen hinausgehendes, systemspezifisches Kartellrecht zu verstehen, das dazu dient, die Existenzberechtigung auch kleiner dissentierender Auffassungen gegen Monopolisierungstendenzen des jeweiligen mainstream zu verteidigen. Sie erhalten Ungewissheit, indem sie das, was zu einer bestimmten Zeit unter Vernünftigen als ausgemacht gilt, seiner scheinbaren Selbstverständlichkeit entkleiden und als lediglich eine von mehreren grundsätzlich möglichen Perspektiven zu erkennen geben. Auf diese Weise muss der mainstream seine eigene Überzeugungskraft stets neu belegen. Wo ihm dies nicht mehr gelingt, wird er durch die besseren Argumente der Gegenseite überwunden.
Dass eine derartige systematische Selbst-Labilisierung selbst innerhalb des Rechtssystems sinnvoll sein kann, weil durch die so konzedierte Ungewissheit Pfadabhängigkeiten entgegengewirkt und Freiräume für innovative Neuansätze geschaffen werden kann, zeigt sich an der Institution der „dissenting opinion“ bei Höchstgerichten. Auf der einen Seite unterlaufen derartige offen zur Schau gestellte Minderheitenvoten, die der die Entscheidung tragenden Mehrheitsauffassung mit teilweise harschen Worten entgegentreten, den Glauben an die Rationalität der Rechtsprechung. Denn sie heben die im Übrigen gerne verdeckte Ambiguität des Entscheidungsprozesses hervor. Auf der anderen Seite überwiegen offensichtlich die Vorteile, die eine derartige Technik für ein modernes Rechtssystem hat: Als Strategie der Selbstrelativierung gewährleistet sie eine auf Selbständerungsfähigkeit eingestellte Dynamik.
V. Fazit
Wiethölters Formel „Chaos in Ordnung bringen“ lässt sich damit auch für eine epistemische Analyse des Rechts und seiner Funktionen sinnvoll einsetzen. Recht hat danach zwar auch die (konservative) Funktion, dysfunktionales Chaos zu verhindern. Ihm kommt jedoch zugleich noch eine andere, gegenläufige Funktion zu: Indem es sich einer (Über-)Szientifizierung der Gesellschaft entgegenstellt, fungiert das Recht als Garant eines produktiven und kreativen Chaos, das jenseits der Grenzen des (derzeit) kognitiv Fassbaren liegt.
Ino Augsberg ist Inhaber des Lehrstuhls für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Christan-Albrechts-Universität zu Kiel. Seine Hauptforschungsinteressen gelten den Rändern des Rechts.
Literatur
Adorno, Theodor W. 1994: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, 22. Aufl., Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Arnauld, Andreas von 2006: Rechtssicherheit. Perspektivische Annäherungen an eine „idée directrice“ des Rechts, Tübingen: Mohr Siebeck.
Augsberg, Ino 2014: Informationsverwaltungsrecht. Zur kognitiven Dimension der rechtlichen Steuerung von Verwaltungsentscheidungen, Tübingen: Mohr Siebeck.
Esposito, Elena 2007: Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Lefort, Claude 1990: Die Frage der Demokratie, in: Ulrich Rödel (Hrsg.), Autonome Gesellschaft und libertäre Demokratie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 281–297.
Luhmann, Niklas 2000: Organisation und Entscheidung, Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
March, James G./Simon, Herbert A. 1958: Organizations, New York: Wiley & Sons.
Möstl, Markus 2002: Die staatliche Garantie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Tübingen: Mohr Siebeck.
Wiethölter, Rudolf 1994: Zur Argumentation im Recht: Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe?, in: Gunther Teubner (Hrsg.), Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe. Folgenorientiertes Argumentieren in rechtsvergleichender Sicht, Baden-Baden: Nomos, S. 89–120.
Willke, Helmut 2002: Dystopia. Studien zur Krisis des Wissens in der modernen Gesellschaft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Wollenschläger, Burkard 2009: Wissensgenerierung im Verfahren. Tübingen: Mohr Siebeck.
Zabel, Benno 2019: „Chaos in Ordnung bringen“ – Versuch über das reflexive Recht, in: Kritische Justiz 52 (2019) (Sonderheft: Rechtsbrüche. Spiegelungen der Rechtskritik Rudolf Wiethölters), S. 657–669.


