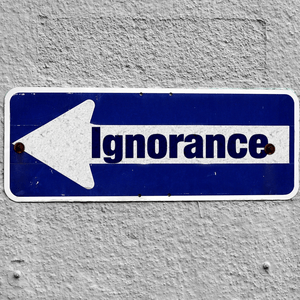
Die Grenzen unseres Wissens vom Guten
Von Falk Hamann (Frankfurt am Main)
Der Hinweis darauf, dass unser Wissen vom Guten beschränkt ist, ist kein Vorrecht des ethischen Skeptikers, der grundsätzlich die Möglichkeit objektiver Erkenntnis in ethischen Fragen bestreitet. Auch wenn wir an der Objektivität ethischer Urteile festhalten wollen, kommen wir nicht umhin anzuerkennen, dass unserem Erkennen im Bereich des Handelns Grenzen gesetzt sind – Grenzen, die sich so in anderen Bereichen der Wirklichkeit nicht finden. Eine Auseinandersetzung mit ihnen ist durchaus fruchtbar und für die Ethik gewinnbringend. Das soll hier anhand von zwei Denkern gezeigt werden – zum einen Aristoteles, der speziell das ethisch Gute in den Blick nimmt, zum anderen Franz Brentano, dem es allgemein um die Weise geht, wie wir Gutes erkennen. Beide liefern uns Einsichten, die zu einer Selbstvergewisserung und erkenntnistheoretischen Absicherung der Ethik beitragen.
Aristoteles über das ethisch Gute
Aristoteles betont zu Beginn der Nikomachischen Ethik, dass „nicht bei allen Fragen die gleiche Präzision zu verlangen“ sei (NE I.1, 1094b13). Anders als etwa in der Mathematik, in der wir zu exaktem Wissen gelangen könnten, müssten wir uns in der Ethik damit begnügen, eher „in groben Umrissen das Richtige anzudeuten“ (b19–21). Unser Erkennen vermag hier nicht bis zu dem Grad an Exaktheit vorzudringen, den wir mit der Idee des Wissens verbinden. Somit kann es aus Aristoteles’ Sicht kein Wissen vom ethisch Guten geben. Warum genau aber ist das so?
Wenn Aristoteles von „Wissen“ (epistēmē) spricht, verwendet er den Ausdruck in einem anspruchsvollen Sinn, der eng mit seiner Idee der Wissenschaft verknüpft ist. Wissen haben wir genau dann von einer Sache, „wenn wir sowohl die Ursache, durch die sie ist, als solche zu erkennen glauben, wie auch die Erkenntnis uns zuschreiben, daß es sich unmöglich anders verhalten kann“ (Anal. Post. I.2, 71b10–12). Seiner Form nach ist Wissen mithin mehr als die Kenntnis einzelner Tatsachen; es besteht vielmehr in einem Verständnis allgemeiner Gesetzmäßigkeiten. Zu einem solchen Verständnis gehören zwei Dinge: die Erkenntnis der unmittelbaren Ursache des betreffenden Phänomens und die Einsicht, dass der betreffende Kausalzusammenhang notwendig ist, also den Status eines Gesetzes hat. Schon außerhalb des idealen Bereichs der Logik und Mathematik haben Gesetze jedoch nicht die Form strikt allquantifizierter Aussagen, sondern gelten nur ceteris paribus, d. h. unter bestimmten Bedingungen. Dass Wasser beispielsweise durch Zufuhr von Wärme bei 100 °C den Aggregatzustand ändert, gilt nur bei einem gewissen Luftdruck und einem geringen Salzgehalt. Um solche Gesetzmäßigkeiten zu erfassen, müssen wir daher vom konkreten Einzelfall und allem, was in ihm mit Blick auf das untersuchte Phänomen kontingent ist, abstrahieren. Das Notwendige findet sich erst auf der Ebene des Allgemeinen.
Dies ist der Grund, warum Aristoteles gegenüber dem Anspruch auf ein Wissen in der Ethik Bedenken äußert. Der spezifische Gegenstand der Ethik, das gute Handeln, ist mit einem solchen Anspruch nämlich unvereinbar. Das ethisch (oder moralisch) Gute ist zunächst und zuerst das Gute des Handelns. Je nachdem, welcher ethischen Theorie man anhängt, kann das bedeuten zu fragen, was eine Handlung z. B. gerecht oder mutig, pflichtgemäß oder einfach richtig macht. Die für ein Wissen notwendige Abstraktion vom konkreten Einzelfall ist aber, so argumentiert Aristoteles, gerade im Fall des ethisch Guten nicht möglich: „Denn in den Untersuchungen über das Handeln sind die Allgemeinheiten zwar umfassender, die Einzelheiten aber wahrer. Denn die Handlungen betreffen das Einzelne, und dem müssen die Aussagen entsprechen.“ (NE II.7, 1107a29 ff.) Was es heißt, gut oder schlecht zu handeln, lasse sich nicht auf allgemeine Gesetze zurückführen, sondern erfordere im Gegenteil ein Eingehen auf die konkreten Gegebenheiten der betreffenden Situation. Ethische Regeln können bestenfalls als grobe Orientierungen für unser Handeln dienen, die aber stets auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen sind. Aristoteles hebt deshalb immer wieder die Bedeutung der Klugheit (phronēsis) hervor, einer intellektuellen Tugend, die aus Erfahrung erwächst und ihrem Besitzer eine Sensibilität für ethisch relevante Unterschiede von Situationen verleiht (vgl. Aubenque 2007).
Dieser Vorbehalt gegen ein exaktes Wissen in der Ethik schlägt sich am deutlichsten in Aristoteles’ sogenannter Mesotēs-Lehre nieder, der zufolge tugendhaftes Handeln als eine Mitte zwischen zwei ethisch schlechten Extremen beschrieben werden kann. In unserem Handeln spielen Emotionen wie Furcht, Begierde oder Zorn eine zentrale motivationale Rolle, insofern sie uns dazu geneigt machen, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen. Aus ethischer Sicht kann es deshalb in Bezug auf sie ein Übermaß bzw. einen Mangel geben. Mutig z. B. handelt derjenige, der in einer Gefahrensituation weder aus übermäßiger Furcht vorschnell die Flucht ergreift, noch aus mangelnder Furcht die tatsächliche Gefahr für ihn und andere unterschätzt. Mut ist somit die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Aristoteles betont aber, dass die Rede von der ethischen Tugend als Mitte nicht formal zu verstehen ist, so als wäre sie für alle Personen und Situationen ein und dieselbe. Was es heißt, z. B. mutig zu handeln, müsse vielmehr im Blick auf die betreffende Person in der jeweiligen Situation bestimmt werden: „Wer aushält und fürchtet, was man soll und weswegen man es soll und wie und wann, […] der ist mutig. Der Mutige nämlich empfindet und handelt, wie es angemessen ist und wie es die Vernunft will.“ (ebd. III.10, 1115a17–20; Übersetzung verbessert, F. H.) Tugendhaftes Handeln ist allgemein ein solches, das der betreffenden Situation bzw. den durch sie gestellten ethischen Anforderungen angemessen ist und daher beim Handelnden selbst ein korrektes Verständnis derselben (den sogenannten orthos logos) voraussetzt. Tugend ist, wie Aristoteles schreibt, die Mitte zwischen Übermaß und Mangel „gemäß der rechten Einsicht“ (ebd. VI.1, 1138b23–25).
Die Angemessenheit der Handlung an die Situation gliedert sich in eine Reihe verschiedener Hinsichten, die traditionell auch als „Umstände“ (circumstantiae) einer Handlung bezeichnet werden. Dazu rechnet Aristoteles den Handelnden selbst, die Art der Handlung, den Ort und die Zeit, gegebenenfalls das Mittel, mit dem die Handlung vollzogen wird, den Handlungszweck und schließlich die Weise, in der gehandelt wird (ebd. III.2, 1110b31–11a21; vgl. Sloan 2010). Nur eine Handlung, die in jeder dieser Hinsichten als richtig zu bewerten ist, gilt im Vollsinn als ethisch gut. Dieser Bezug auf die konkrete Handlungssituation schließt aus Aristoteles’ Sicht ein Wissen vom ethisch Guten aus, weil damit gerade eine Formulierung situationsübergreifender ethischer Gesetze unmöglich wird. Thomas von Aquin illustriert diesen Punkt gern mit folgendem Beispiel: Im Allgemeinen müsse man zwar fremdes Eigentum seinem Besitzer auf dessen Wunsch hin zurückgeben, das gelte aber z. B. nicht, wenn dieser damit ein schweres Verbrechen begehen will. Einem Straßenräuber etwa, der es auf unser Geld abgesehen hat, müssen wir seine Waffen nicht aushändigen.
Für Aristoteles gibt es nur spezielle Fälle, in denen sich etwas allgemeingültig über das ethisch Gute sagen lässt. Diese betreffen sogenannte moralische Absoluta, d. h. Emotionen oder Handlungsweisen, die in sich schlecht und deshalb in keiner Situation richtig bzw. gut sein können. Dazu zählt er z. B. Schadenfreude, Schamlosigkeit, Ehebruch oder Mord, bei denen schon ihr Begriff enthalte, dass ein solches Verhalten falsch sei (vgl. ebd. II.6, 1007a9–12). Es ist kein Zufall, dass es sich hier durchgängig um ethische Übel handelt. Moralische Absoluta betreffen Handlungen bzw. Emotionen, die schon ihrer Art nach schlecht sind und deshalb durch keinen der anderen Umstände ethisch gut gemacht werden können. Ein ethisches Wissen wäre von ihnen demnach möglich, erforderte aber zusätzlich noch die Einsicht, warum diese Dinge jeweils in sich schlecht sind. Jenseits dieser speziellen Fälle und gerade im Hinblick auf das gute Handeln schließt aber für Aristoteles der Bezug auf die konkrete Handlungssituation eine Formulierung allgemeiner Gesetzmäßigkeiten und damit ein Wissen im strengen Sinne aus.
Franz Brentano zur Erkenntnis des Guten im Allgemeinen
Unserer Erkenntnis sind nicht allein in Bezug auf das ethisch Gute Grenzen gesetzt. Auch das Gute im Allgemeinen, also letztlich alles, was wir im Handeln erstreben oder uns ersehnen, wirft erkenntnistheoretische Probleme auf. Vom Guten in diesem umfassenderen Sinne spricht auch Aristoteles, beispielsweise wenn er Freunde, Ehre, Lust oder Erkenntnis als Güter bezeichnet. Das Gute im Allgemeinen charakterisiert er deshalb als dasjenige, „wonach alles strebt“ (NE I.1, 1094a3; Top. III.1, 116a18 f.). Man könnte meinen, dass außerhalb der Ethik durchaus ein Wissen vom Guten möglich ist. Denn vieles von dem, was wir als gut und erstrebenswert erachten, scheint in seinem Gutsein nicht von den konkreten Gegebenheiten einzelner Situationen abzuhängen und allgemeingültige Aussagen zuzulassen. Freilich können all diese Dinge auf eine ethisch schlechte Weise erstrebt werden, wie z. B. ein Jugendlicher, um die Anerkennung seiner Altersgenossen zu erhalten, kriminell werden und so seine Zukunft zerstören kann. Schlecht ist dann aber das betreffende Handeln, nicht unbedingt das in ihm erstrebte Gute, z. B. die Anerkennung und Wertschätzung anderer. Ist also vom Guten in diesem allgemeinen Sinne ein Wissen möglich?
Aristoteles selbst geht auf diese Frage nicht weiter ein. Anders ist das bei Franz Brentano, der in seiner Studie Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis (1889) eine Antwort auf sie zu geben versucht. In diesem Text untersucht Brentano die erkenntnistheoretischen Grundlagen unseres Begriffs des Guten und geht auch auf die Grenzen unseres Wissens in diesem Bereich ein. Ihm zufolge ist unser Begriff des Guten nicht allein aus theoretischen Akten des Wahrnehmens, Vorstellens oder Urteilens gewonnen, sondern erfordert zugleich gewisse Gemüts- oder Willensakte. Das Bewusstsein von etwas Gutem werde, allgemein gesprochen, durch ein „Gefallen“ oder „Lieben“ mitkonstituiert (vgl. Brentano 1889, § 23). Diese These Brentanos schließt durchaus an Aristoteles an, der ebenfalls das Gute aus einer praktischen Perspektive erläutert und es etwa in seiner Psychologie als das Objekt des Willens kennzeichnet (vgl. DA III.10, 4333a26–29).
Gerade diese konstitutive Rolle der Gemütsakte setzt unserem Wissen im Bereich des Guten enge Grenzen. Denn unser Gefallen oder Lieben kann nur dann eine Quelle von Wissen sein, wenn es kein kontingenter Akt ist, der sich z. B. bloß subjektiven Präferenzen verdankt. Die Frage ist, ob und wie wir erkennen können, dass uns etwas notwendigerweise gefällt und als gut erscheint. Erst dann wäre ein Wissen vom Guten in Aristoteles’ Sinne möglich. Brentano argumentiert aber, dass uns in den meisten Fällen die Gründe unseres Gefallens oder Liebens nicht durchsichtig sind. „Unser Gefallen und Mißfallen sind oft,“ schreibt er, „ganz ähnlich wie die blinden Urteile, nur instinktive und gewohnheitsmäßige Triebe“ (Brentano 1889, § 27). Mithin lasse sich in diesen Fällen nicht sagen, ob das entsprechende Gefallen oder Missfallen einen notwendigen, d. h. in der Sache selbst begründeten, Charakter habe.
Brentanos originäre Entdeckung ist jedoch, dass es einzelne Fälle gibt, in denen das Gefallen phänomenal eine besondere Gestalt hat, insofern es sich uns unmittelbar als richtig darstellt. Im Vollzug dieser Akte bemerken wir, so Brentano, „daß ihr Objekt nicht bloß geliebt und liebbar und seine Privation und sein Gegensatz gehaßt und haßbar sind, sondern auch, daß das eine liebenswert, das andere hassenswert, also das ein gut, das andere schlecht ist“ (ebd.). Was Brentano hier im Blick hat, ist eine Form von Evidenz im Bereich der Gemütsakte – eine Richtigkeit des Gefallens oder Missfallens, die am betreffenden Akt unmittelbar eingesehen werden kann. Als Beispiel für ein derart als richtig charakterisiertes Gefallen führt Brentano unsere Liebe zur Erkenntnis an. Hier sei es absurd zu denken, dass das Gefallen bloß kontingent sei, d. h. umgekehrt auch Irrtum oder Unwissenheit als solche geliebt werden könnten (vgl. ebd.). Brentano weist zwar auf diesen Unterschied zwischen blinden und evidenten Akten des Gefallens hin, liefert selbst aber keine Erklärung desselben. Erst Edmund Husserl bemüht sich, diesen Unterschied phänomenologisch aufzuklären und so zugleich verständlich zu machen, warum bestimmte Dinge notwendigerweise bei uns Gefallen hervorrufen.
Brentano zufolge verlaufen die Grenzen unseres Wissens vom Guten entlang der als richtig charakterisierten Akte des Gefallens oder Liebens. Wir haben, so schreibt er, „keine Gewähr dafür, daß wir von allem, was gut ist, mit einer als richtig charakterisierten Liebe angemutet werden. Wo immer dies nicht der Fall ist, versagt unser Kriterium, und das Gute ist für unsere Erkenntnis und praktische Berücksichtigung soviel wie nicht vorhanden“ (ebd.). Anders als bei Aristoteles sind die von Brentano behaupteten Grenzen somit nicht dem spezifischen Gegenstand der Ethik geschuldet, sondern entspringen der Beschränktheit unseres Zugangs zu jeder Form des Guten. Sie gelten so auch für das ethisch Gute, dessen Erkenntnis bei uns ebenfalls keine rein theoretische ist. Jüngere Ansätze weisen beispielsweise Gemütsakten wie Bewunderung oder Dankbarkeit eine zentrale Rolle in unserer ethischen Erkenntnis zu (vgl. etwa Zagzebski 2017).
Grenzen des Wissens und Skeptizismus
Die Thematisierung der Grenzen, die unserer Erkenntnis im Bereich des Guten gesetzt sind, läuft nicht auf einen Skeptizismus hinaus. Im Gegenteil dient sie vielmehr einer Selbstvergewisserung und erkenntnistheoretischen Absicherung der Ethik. Indem Aristoteles auf die Situationsgebundenheit des ethisch Guten verweist, wendet er sich gerade gegen überzogene Wissensansprüche, die andernfalls das Vertrauen in unsere Erkenntnisfähigkeit bei ethischen Fragen unterminieren könnten. Nicht ein strenges Wissen von ethischen Gesetzen, sondern vielmehr Klugheit und Erfahrung ermöglicht uns ihm zufolge eine verlässliche Orientierung im Handeln. Brentano liefert eine wertvolle Ergänzung und Vertiefung dieser erkenntnistheoretischen Überlegungen, indem er unseren allgemeinen Zugang zum Guten zum Thema macht. Die phänomenologische Unterscheidung zwischen blinden und evidenten (als richtig charakterisierten) Formen des Gefallens oder Liebens dient der Isolierung exemplarischer Instanzen einer objektiven Erkenntnis des Guten, die unsere, wenngleich letztlich beschränkten Wissensansprüche in diesem Bereich gegen vorschnelle skeptische Einwände absichern sollen. Die Beschäftigung mit den Grenzen unseres Wissens vom Guten hat mithin sowohl bei Aristoteles als auch Brentano eine zutiefst antiskeptische Pointe.
Falk Hamann ist PostDoc in Philosophie und arbeitet als Redaktionsassistent der Zeitschrift „Theologie und Philosophie“ an der Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Sozialontologie und Ethik. Gegenwärtig beschäftigt er sich vor allem mit erkenntnistheoretischen Fragen zum Begriff des Guten.
Literatur
Aristoteles (1922). Zweit Analytiken, übers. von Eugen Rolfes. Hamburg: Meiner. [Anal. Post.]
–––––– (1968). Topik, übers. von Eugen Rolfes. Hamburg: Meiner. [Top.]
–––––– (1995). Über die Seele, übers. von Horst Seidl und Willy Theiler. Hamburg: Meiner. [DA]
–––––– (2014). Nikomachische Ethik, übers. von Olof Gigon. Düsseldorf: de Gruyter. [NE]
Aubenque, Pierre (2007). Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles, übers. von Nicolai Sinai und Ulrich Johannes Schneider. Hamburg: Meiner.
Brentano, Franz (1889). Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis. Hamburg: Meiner 1955.
Sloan, Michael C. (2010). „Aristotle’s Nicomachean Ethics as the Original Locus for the Septem Circumstantiae“. Classical Philology 105/3, 236–251.
Zagzebski, Linda (2017). Exemplarist Moral Theory. Oxford: Oxford University Press.


