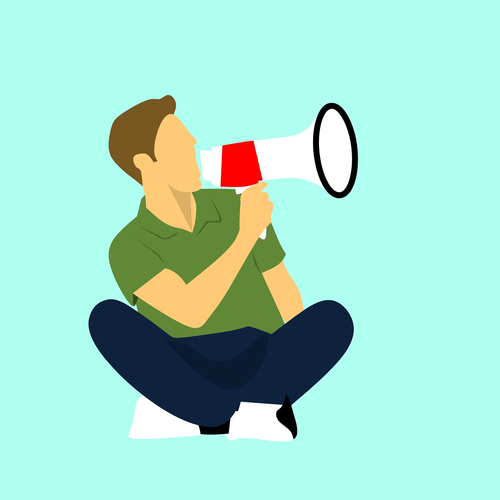
Die Notwendigkeit einer Popularität. Performative Philosophie in ihrem wissenschaftlichen Unverstand
von Christoph Müller (Leipzig)
Die Philosophie befindet sich im Wandel. Immer mehr Philosoph*innen scheinen sich von der klassischen akademischen Art des Philosophierens entfernen zu wollen. Am besten bestätigen können dies wohl die Student*innen, denen geradezu dürstet nach einer anderen, einer zugänglicheren Art des Philosophierens. Wer kennt sie nicht, die hochtrabende Sprache der akademischen Philosophie, die penible Einhaltung korrekter Begriffsverwendung? Die Philosophie der Universitäten scheint sich vor allem mit dem bereits Gesagten zu beschäftigen. Es geht um das Verständnis von Theorien und Systemen, die aus einer Logik heraus und deren Nachvollziehbarkeit entstehen. Zur Grundlage für ein solches Verstehen und das daraus resultierende Philosophieren wird die Aneignung der jeweiligen Begriffswelt erklärt. Allein in der Sprache der jeweiligen philosophischen Theorie wird Philosophieren überhaupt erst möglich. Die Student*innen werden hierbei zu den Fragenden und Unwissenden, die Dozent*innen zu den Wissenden und Belehrenden.
Natürlich möchte ich nicht die Notwendigkeit einer gemeinsamen Bezugsebene für das Verwenden und Verstehen von Begriffen und Sprache bestreiten. Aber was hier passiert, geht weit darüber hinaus. Es ist die Verwissenschaftlichung der Philosophie selbst, die, obgleich das angestrebte Ideal des Wissenschaft-Seins eine Notwendigkeit der Philosophie darstellt, das Philosophieren zu einem reinen Sprechen über das Bisherige macht. Mit Sicherheit ist es erstrebenswert das Vorhandene zu verstehen, sich anzueignen, es zu verbessern und zu erweitern. Doch das eigentlich Ideale innerhalb einer jeden Philosophie, die Ideen in ihrer ursprünglichen, motivierenden und zum Denken anregenden Form, sind allein in ihrer Bewegtheit, ihrem Gedanken-Sein verstehbar und entstanden. Das Gedachte eröffnet in seiner Denkbarkeit ein zeitliches Feld, welches überhaupt erst Denken ermöglicht. Die Struktur des Verstehens, des Begreifens von Begriffen ist nicht das Beziehen-auf-etwas, sondern gerade das Beziehen-auf-nichts. Die Entzogenheit des eigentlich Thematisierten in seiner Idealität ermöglicht allererst die Nachvollziehbarkeit des Gemeinten. Selbst die komplexeste und detaillierteste Beschreibung einer philosophischen Theorie, eines Gedankens, schafft es nicht das Gedachte in eine begriffliche bzw. ideale Unabhängigkeit und somit ideelle Entität zu überführen. Gerade hierfür schaffen und kreieren wir immer wieder neue Begriffe und Systeme, deren Verweisungszusammenhänge ihre Geschichte und Bedeutung transportieren.
Der eigentliche Punkt jedoch ist die notwendige Unvollständigkeit des Gedankens, denn sie ist seine Ermöglichung. Unser ständiger Versuch das Erdachte in der Philosophie in die Nachvollziehbarkeit, in die Formelhaftigkeit zu überführen ist Ausdruck genau jener unerreichbaren Idealität des Gedachten, die in ihrer Entzogenheit ihr eigenes Streben nach Festigkeit bedingt. Diese widersprüchliche Figur des Verstehens und Denkens ist untrennbar mit dem Gedanken, der Idee, verbunden. Es ist nicht möglich, die Philosophie vom Verständnis zu trennen, den Ideen eine Unabhängigkeit zuzuschreiben, die sie auf eine andere Art verstehbar machen würde als durch ihre Nachvollziehbarkeit. Alles Denkbare eröffnet Zeitlichkeit und somit ideale Unvollständigkeit, die in ihrer Selbst-Idealisierung, ihrem aus dem Widersprüchlichen hervorgehenden Streben nach Abgeschlossenheit und Vollständigkeit, eine Bewegung ermöglicht bzw. vollzieht, welche stets im Widerspruch von unerreichbarer Abgeschlossenheit und notwendiger Vervollständigung des Gedachten gipfelt. Diese sich-entziehende Widersprüchlichkeit, die die Eindeutigkeit des Erdachten in seiner Unvollständigkeit bedingt, äußert sich auch in dem zu Beginn beschriebenen “Problem” mit der Philosophie. Es scheint, als sei es oberstes Ziel der Philosophie dieses uneinholbare Sein des Gedachten, diese untrennbare Verbundenheit von Nachvollziehbarkeit und zugleich unerreichter Idealität zu überwinden, indem sie das vorher im Werden Ermöglichte versucht in die Festigkeit einer Struktur und Verständlichkeit zu überführen, um so ideelle Entität und ständige Wiederholbarkeit zu schaffen. Die Aufmerksamkeit liegt dabei jedoch darauf, das Hervorgebrachte festzuhalten und es in eine Systematik einzuordnen, und nicht auf dem Moment, der und in dem das Gedachte hervorgebracht bzw. ermöglicht wird. Dabei ist es doch dieser Moment, der die Verständlichkeit der Philosophie hervorbringt. Mehr noch, es ist das eigentlich Ermöglichende der Philosophie, das in seinem widersprüchlichen Entzug von der Idealität des Inhalts ablassend zur Überbrückung des Unüberbrückbaren wird.
Genau hier muss die Popularität der Philosophie ansetzen, wenn sie sich selbst widerspricht, wenn ihre Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit in deren Nicht-Erreichbarkeit liegt. Dieser Umgang mit der Philosophie versucht den Gedanken im Moment seines Entstehens zu begreifen, ihn noch vor seinem eigentlichen Gedanken-Werden als Ausdruck einer Ermöglichung innerhalb bisheriger Selbst-Widersprüchlichkeit zu empfinden. Popularität ist demnach ermöglichte Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit, die nicht aus der Logik einer überlieferten Geschichte, sondern aus der Ermöglichung vermittelnder Geschichtlichkeit und Logik hervorgeht. Diese Gelöstheit von Voraussetzungen und somit auch Wissenschaftlichkeit ist zwar eine widersprüchliche, jedoch hervorbringende Verbindung von Empfindung und Abstraktion, Subjekt und Objekt, Individuum und Intersubjektivität. Selbstverständlich schmälert das hier beschriebene keinesfalls den Wert der Vorgehensweise und der Methodik klassischer akademischer Philosophie, doch ich sehe in ihr tatsächlich die Gefahr eines möglichen Stillstandes und reiner Selbstreferenzialität. Wo bleibt sonst Raum für das Noch-Un-Gedachte? Wie schaffen wir es, offen zu bleiben für Verweisungen und Anknüpfungspunkte, die noch nicht im Bisherigen zu erkennen oder nicht vorhanden sind?
Die Angst vor der populären Philosophie ist ja oft die vor der ihr anhaftenden Trivialität und das zu Recht. Mir geht es jedoch nicht um eine Popularität, die gleichbedeutend ist mit einem Weglassen gedanklicher Tiefe oder einer Degradierung der Philosophie zu einer Technik reiner Selbstoptimierung und Selbstfindung. Popularität sollte vielmehr Offenheit gegenüber dem Denken selbst bedeuten, denn dieses zeigt uns mehr als deutlich, dass es weit über lediglich rationales Erschließen und Analysieren hinausgeht. Popularität heißt demnach, sich den Momenten des Erdenkens und Hervorbringens von Gedachtem zuzuwenden, die eben nicht allein der*m Wissenschaftler*in vorbehalten sind, sondern in ihrem Werden und ihrer versuchten Inhaltslosigkeit Momente des Hervorbringens in jedem von uns darstellen. Diese Lösung vom Inhaltlichen ist hierbei keine Trivialisierung und auch nicht der Wunsch alles zu Philosophie zu erklären. Sie eröffnet uns vielmehr eine weitere Dimension philosophischer Tiefe, indem sie sich mit dem Bewusst-Werden, dem Hervortreten von Ideen und Gedanken beschäftigt, welches sich in seiner Uneinholbarkeit und Selbstwidersprüchlichkeit der klassischen Methodik wissenschaftlicher Philosophie entzieht. Zugleich zwingt uns eine solche Herangehensweise der Popularität uns mit dem bisher Un-Philosophischen innerhalb der Philosophie zu beschäftigen. Welche Rolle spielen unsere Körper, unsere Um-Welt beim Denken? Was findet da eigentlich seinen Ausdruck in der versuchten Idealisierung und Verfestigung von sich widersprechendem Entzug? Ist nicht die Ermöglichung von Philosophie Philosophie? Das Populäre, das ich versuchen möchte zu umreißen, ist selbst nichts Konkretes. Es ist der Hinweis, unseren Blick zu wenden, uns als Philosoph*innen als Ausdrückende von Bisherigkeiten zu verstehen, uns unserer Ausdruckshaftigkeit selbst bewusst zu werden. Neben aller Logizität und Wissenschaftlichkeit der Philosophie, scheint mir eine Beschäftigung mit der Philosophie in ihrer Ausdruckshaftigkeit sehr empfehlenswert. Genau dieser Ausdruck nämlich ist es, den wir nicht zu Wort kommen lassen, wenn uns ein Mitspracherecht innerhalb der Philosophie erst bei Erreichen eines hoch professionalisierten Sprachgebrauchs zugeteilt wird. Dabei ist jener Ausdruck höchst interessant und wichtig, denn allein hier scheint sich das Unsagbare noch in seiner Vor-Sprachlichkeit zu zeigen.
Letztendlich komme ich auch jetzt in diesem Text zu einem Punkt, an dem ich meinen Ausdruck ändern müsste, an dem ich merke, dass ich mit allein auf Logik und Grammatik basierendem Sprachgebrauch nicht mehr weiter komme. Nein! – es geht nicht um ein Begriffe-Tanzen und auch nicht um Seelenwanderung! Ein Versuch, mitnichten der Einzige und auch nicht der Letzte, diesen Ausdruck innerhalb der Philosophie in den Vordergrund zu rücken finden wir in der Performativen Philosophie, die sich des künstlerischen Ausdrucks bedient und ihn sich philosophisch zu eigen macht. Es geht dabei darum, die Philosophie für ihre eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu öffnen, zu verstehen, dass auch der sprachlich dominierte Teil der Philosophie nur eine Art des Ausdrucks ist. Selbst der komplexeste Satz ist untrennbar mit uns Selbst, unserem Körper und unserer Um-Welt verbunden. Durch einen solchen Blick auf die Dinge ergibt sich eine Fülle von Fragestellungen und Herangehensweisen, die nicht mehr sprachlich sind, sondern sich vielmehr im Moment des Erlebens und des jeweiligen Ausdrucks erfahren und wahrnehmen lassen. Dabei geht es nicht mal mehr um einen Mehrgewinn oder eine neue philosophische Erkenntnis, sondern um das Sich-Einlassen-auf, um das fragende Hinein-Hören in die Ermöglichung selbst. All die manifestierenden Versuche, Erdachtes in wiederholbare Idealität und Nachvollziehbarkeit zu überführen, verweisen zugleich und in eben diesem Streben auf ihren selbst-ermöglichenden Charakter. Gehen wir diesem nach, gelangen wir nicht an eine begründende Ursache, jedoch stoßen wir auf ein widersprüchliches Wechselspiel eigener Grenzerfahrungen, deren Überschreitungen oder Begrenzungen uns als Philosophisches selbst ermöglicht. Bewege dich, stolpere, falle, verharre, um die Bewegung selbst zu verstehen. Doch wir werden es nicht schaffen die Bewegung vollständig zu begreifen, sie in ein System einzugliedern, dessen Schlüssigkeit und Abgeschlossenheit ein weiteres kritisches Nachfragen zunichte macht, es überflüssig macht. Dennoch ist dieses Streben in seiner Unabschließbarkeit notwendige Grundlage für jedes Reden über Bewegung und auch für das Bewegen selbst. Wir können also weiterreden über Bewegung und ihr theoretisches Fundament oder wir lassen uns immer wieder auf sie und ihre eröffnende Widersprüchlichkeit ein, indem wir sie im Vollzug als Be- und Entgrenzung erfahren. Die Popularität der Bewegung liegt nicht allein darin, dass wir alle über sie zu reden wissen, sondern auch und insbesondere darin, dass sie unser Selbst-Sein in und als Sich-Bewegende ermöglicht, gerade indem sie sich des Stillstands entzieht.
Christoph Müller hat in Leipzig Philosophie studiert. Während eines Erasmusaufenthaltes in Wien hat er bei Arno Böhler die Performative Philosophie kennen und schätzen gelernt. Seitdem arbeitet er vor allem mit der Künstlerin und Philosophin Evi Jägle gemeinsam als Performance-Philosophie-Kollektiv Philomation an einer filmisch-philosophischen Ausdrucksweise. Seit 2017 sind Evi Jägle und er zudem Mitglieder im Verein Expedition Philosophie, der der Internationalen Gesellschaft für Performative Philosophie angehört.


