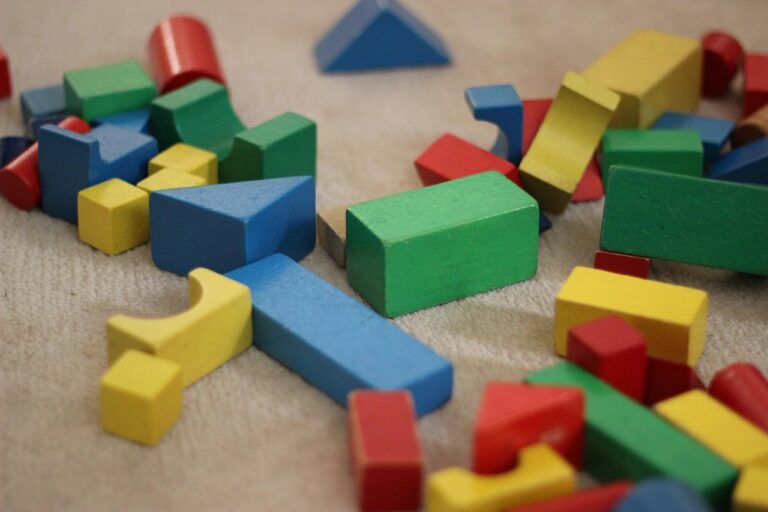Das Leiden der Nutztiere – eine Frage des Verstehens?
Von Janine Borcherding (Bremen)
Alljährlich werden allein in Deutschland Hunderte Millionen sogenannter ‚Nutztiere‘ – meist unter grausamen Bedingungen – für unsere Nutzung getötet[1]. Für diesen ethisch bedenklichen Umgang gibt es sicherlich vielfältige psychologische, soziologische und ökonomische Gründe. Aber gehen wir vielleicht auch deshalb so mit ‚Nutztieren‘ um, weil wir sie nicht verstehen? Und ist dieses Missverstehen womöglich selbst schon eine Ungerechtigkeit ihnen gegenüber? In diesem Beitrag möchte ich zeigen, dass der Begriff der epistemischen Ungerechtigkeit auch etwas zur Erklärung unseres Verhaltens gegenüber Nutztieren beitragen kann.
In ihrem 2007 erschienenen Buch Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing beschreibt Miranda Fricker zwei Formen epistemischer Ungerechtigkeit: hermeneutische und testimoniale Ungerechtigkeit. ‚Hermeneutische Ungerechtigkeit‘ bezeichnet dabei – vereinfacht gesagt – eine Ungerechtigkeit, die darauf zurückgeht, dass in einer Gesellschaft keine adäquaten Begriffe vorhanden sind, die es marginalisierten Gruppen ermöglichen würden, ihre eigenen Erfahrungen angemessen zu verstehen und zum Ausdruck zu bringen. Nun könnte man ‚Nutztiere‘ zwar als marginalisierte Gruppe begreifen, es ist jedoch mindestens fraglich, ob sie Begriffe verwenden. Für mein Vorhaben ist daher allein die sogenannte testimoniale Ungerechtigkeit von Belang, der wir uns nun zuwenden.
Testimoniale Ungerechtigkeit wird für gewöhnlich bestimmt als eine Ungerechtigkeit, die darin besteht, dass einer Person wegen ihres Geschlechts, ihrer ‚race‘ oder vergleichbarer Eigenschaften ein geringerer Grad an Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird, als angemessen wäre. Diese Form der epistemischen Ungerechtigkeit lässt sich an Beispielen wie dem folgenden veranschaulichen:
Beispiel 1:
Auf einer internationalen Konferenz hält eine Professorin einen französischsprachigen Vortrag zu einem Thema, für das sie als ausgewiesene Expertin gilt. Im Publikum befindet sich eine Person, die die vorgestellten Inhalte zwar versteht, aber allein deswegen für unplausibel hält, weil sie von einer weiblichen Person vorgetragen wurden. Sie glaubt nicht, was sie sagt, weil eine Frau es gesagt hat.
Für das gängige Verständnis testimonialer Ungerechtigkeit ist es also wesentlich, dass eine oder mehrere Aussagen getätigt werden, die sodann als unplausibel abgetan werden. Nur insofern handelt es sich um eine epistemische Ungerechtigkeit, also eine solche, die mit einem Wissensanspruch verbunden ist. Um dies zu verdeutlichen, genügt es, das Beispiel leicht zu variieren:
Beispiel 2:
Auf einer internationalen Konferenz hält eine Professorin einen französischsprachigen Vortrag zu einem Thema, für das sie als ausgewiesene Expertin gilt. Im Publikum befindet sich eine Person, die des Französischen nicht mächtig ist und somit nichts von dem versteht, was gesagt wird.
Eine testimoniale Ungerechtigkeit kann in diesem Szenario gar nicht zustande kommen. Was unverständlich ist, kann nämlich gar nicht erst auf seine Plausibilität hin beurteilt werden. Dies zeigt sich schon bei unverständlichen Aneinanderreihungen von Wörtern wie „Berlin Pferd blau“[2], die eben weder wahr noch falsch, sondern einfach sinnlos sind. Wer gar nicht erst versteht, was gesagt wird, kann auch nicht darüber urteilen und infolgedessen auch die Sprecherin nicht auf Basis des Gesagten verurteilen. Tut der Zuhörer dies trotzdem – ganz unabhängig vom Gehalt des Gesagten – ist dies keine testimoniale Ungerechtigkeit, sondern blanker Sexismus.
Nach diesem gängigen Verständnis testimonialer Ungerechtigkeit ist diese also daran gebunden, dass eine sinnvolle Aussage getätigt wird, die vom Zuhörer hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit beurteilt werden kann. Insofern scheint testimoniale Ungerechtigkeit an Sprache und somit an die Fähigkeit des Sprechens gebunden zu sein, da es andernfalls nichts gäbe, was überhaupt auf seine Glaubwürdigkeit hin geprüft werden könnte. Wenn man unser Beispiel abermals geringfügig abwandelt, könnte es sich jedoch zeigen, dass dieses Verständnis testimonialer Ungerechtigkeit womöglich zu eng gefasst ist:
Beispiel 3:
Auf einer internationalen Konferenz hält eine Professorin einen französischsprachigen Vortrag zu einem Thema, für das sie als ausgewiesene Expertin gilt. Im Publikum befindet sich eine Person, die des Französischen nicht mächtig ist und somit nichts von dem versteht, was gesagt wird. Kurz nach Beginn des Vortrages gerät die Vortragende ins Stocken, hektisch sortiert sie ihre Unterlagen, von denen sie immer wieder kurz nervös aufblickt. Offenkundig hat sie, das bemerkt auch unser Zuhörer, den Faden verloren.
Obwohl unser Zuhörer nichts von dem versteht, was gesagt wird, versteht er doch, wie unangenehm die Situation für die Vortragende ist. Er weiß, wie es ihr geht, auch wenn sie nichts darüber sagt, wie es ihr geht. Um einander zu verstehen, muss also nicht unbedingt verstanden werden, was gesagt wird. Es ist, wie das Beispiel bezeugt, noch nicht einmal nötig, dass überhaupt etwas gesagt wird.
Das Verstehen des anderen ist folglich nicht notwendig an sprachlichen Ausdruck gebunden, wie es sich schon im Umgang mit Säuglingen zeigt. Auch sie sprechen nicht mit uns, gleichwohl erkennen wir ganz umstandslos, ob sie sich freuen oder ob sie leiden. Analog zum Fall des sprachlichen Ausdrucks könnte eine testimoniale Ungerechtigkeit also auch dann vorliegen, wenn ein solcher nicht-sprachlicher Ausdruck nicht hinreichend ernst genommen oder gänzlich als unglaubwürdig abgetan wird. Erkennt etwa der Zuhörer in unserem Beispiel das Unwohlsein der Vortragenden, tut es jedoch z. B. als ‚weibisches Getue‘ oder ‚Übersensibilität‘ ab, geht er fehl darin, den Ausdruck ihres Leidens angemessen zu verstehen. So zeigt sich, dass auch jemandem, der etwas nicht-sprachlich zum Ausdruck bringt, eine testimoniale Ungerechtigkeit widerfahren kann.
Hiermit sollte der Übergang zu unserem eigentlichen Thema nachvollziehbar sein: dem Leiden der ‚Nutztiere‘. Obwohl sich Tiere nicht sprachlich ausdrücken, können wir sie verstehen. Dies zeigen viele Menschen im täglichen Umgang mit ihren ‚Haustieren‘, wenn sie etwa ganz selbstverständlich verstehen, dass diese spielen möchten, müde sind oder Schmerzen haben[3]. Auch sogenannte ‚Nutztiere‘ bringen sich derart zum Ausdruck, und auch sie könnten wir ganz genauso verstehen, würden wir uns in ähnlicher Weise darum bemühen. Insofern sie ihr Leid aber zum Ausdruck bringen, ist an uns der Anspruch gestellt, sie angemessen zu verstehen. Kommen wir dieser Forderung nicht nach, indem wir den Ausdruck ihres Leides abtun oder gänzlich ignorieren, tun wir ihnen Unrecht. Dieses Unrecht ist, so möchte ich behaupten, eine Form testimonialer Ungerechtigkeit. Wie eine solche Form des Verstehens zustande kommen kann, möchte ich abschließend wenigstens andeuten. Allein durch die Anhäufung von biologischem und ethologischem Wissen stellt sie sich jedoch nicht ein: Etwas über jemanden zu wissen, heißt nicht, ihn zu kennen. Vielmehr kann sich eine solche Form des Verstehens nur im direkten Umgang entwickeln, nämlich indem ich in eine Beziehung mit dem Individuum trete und es nicht als Exemplar einer zu erforschenden Art ansehe.
[1] Vgl. Statistisches Bundesamt, 2023.
[2] Carnap, 2005, S. 27.
[3] Vgl. Midgley, 1984.
Literatur
Carnap, Rudolf: Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften, Hamburg: Meiner. 2005.
Fricker, Miranda: Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing, Oxford: Oxford University Press. 2007.
Midgley, Mary: Animals and Why They Matter, Athens: University of Georgia Press.
Statistisches Bundesamt: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei – Tiere und tierische Erzeugung, in: destatis, 2023, https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Tiere-Tierische-Erzeugung/_inhalt.html#sprg238652 (10.04.2024).
Janine Borcherding studierte Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, derzeit ist sie Doktorandin am Lehrstuhl für Angewandte Philosophie der Universität Bremen.