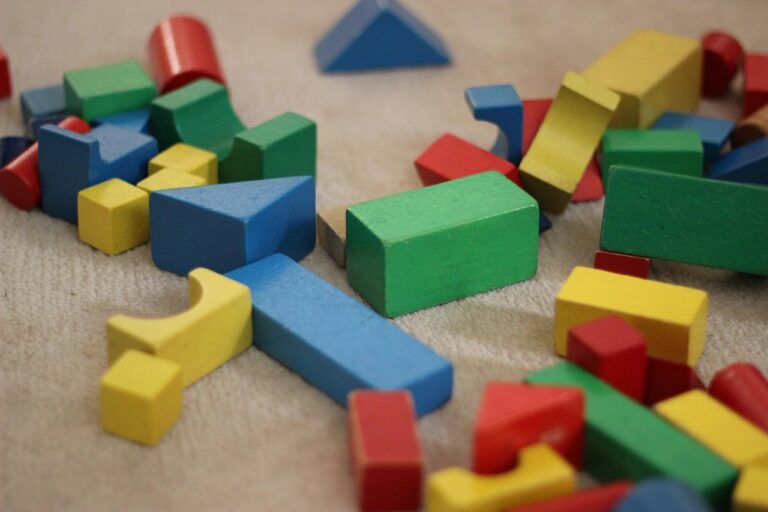Das Postfaktische und der Perspektivismus
von Dieter Thomä (St. Gallen)
Die Herausgeber dieses Blogs schreiben: „Postfaktisches Denken […] scheint für die Demokratietheorie eine erhebliche Herausforderung darzustellen.“ Bei allem Respekt erlaube ich mir hier Widerspruch anzumelden. Er richtet sich nicht gegen den Befund, dass die Demokratie – also auch die Demokratietheorie – heute vor enormen Herausforderungen steht. Diesen Befund teile ich. Doch der Ausdruck „Postfaktisches Denken“ leuchtet mir aus zwei Gründen nicht recht ein.
- Wenn denn „postfaktisches Denken“ heute ein Problem darstellt, dann muss es bis vor kurzem so etwas wie faktisches Denken gegeben haben. Hier wird man jedoch von dem Verdacht beschlichen, dass es sich dabei um ein Oxymoron handelt. Selbst wenn man sich an vermeintlich einladende Voten hält wie diejenigen Giambattista Vicos („verum et factum convertuntur“), Georg Wilhelm Friedrich Hegels („Das Vernünftige ist das Wirkliche“) oder Ludwig Wittgensteins („Die Welt ist alles, was der Fall ist“) – ein Denken als verlängerter Arm der Fakten kommt dabei ebenso wenig heraus wie ein Denken, das von sich aus faktisch ist. Das heißt: Wenn Denken sowieso nicht faktisch ist, dann gibt es auch kein postfaktisches Denken.
- Die Lage wird kaum annehmlicher, wenn man die Verbindung zwischen dem Postfaktischen und dem Denken auflöst und stattdessen – wie weit verbreitet – von „postfaktischen Zeiten“ oder von „postfaktischer Politik“ spricht. Damit wird weiterhin unterstellt, früher habe es so etwas wie eine „faktische“ Zeit oder Politik gegeben. Ein Blick in Karl Mannheims Buch Ideologie und Utopie von 1929 genügt, um zu dem Ergebnis zu gelangen, dass schon damals das „Methodischwerden des Verdachtes und des Mißtrauens“ grassierte, wonach man „in der ganzen Haltung“ eines politischen Gegners „eine Unwahrhaftigkeit wittert[e]“. Dieser ubiquitäre Verdacht klingt auch schon bei Mannheim ziemlich postfaktisch. Wann hat die postfaktische Politik begonnen? Bei Machiavelli?
Mit dem Postfaktischen verhält es sich so wie mit anderen Attributen, die mit der Vorsilbe „post-“ operieren. Die Sequenz, die unterstellt wird, wirkt oft ein bisschen gewollt, und der Status quo ante ist schwer greifbar. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Ist die Moderne wirklich vorbei? Oder gilt: „Wir sind nie modern gewesen“ (Bruno Latour)? Manchmal klingt das „post“- eher nostalgisch und will einen Verlust anzeigen (postromantisch, Postdemokratie etc.), manchmal wirkt es offensiv (postdramatisch, Postmoderne), manchmal auch ambivalent (Posthumanismus). Statt mich nun aber in den Abgründen des Postfaktischen zu verlieren, will ich versuchen, einige klärende Bemerkungen zu einem Begriff zu machen, der in der aktuellen Debatte eine prominente Rolle spielt: zum Perspektivismus.
Dieser Begriff kommt an einer Schlüsselstelle dieser Debatte zum Einsatz – nämlich dort, wo ein Zusammenhang zwischen der Postmoderne und dem Postfaktischen hergestellt wird. Von der Postmoderne heißt es, sie habe einer Vervielfältigung von Perspektiven den Boden bereitet, die nun postfaktisch zur Abschaffung seriöser Wahrheitsansprüche genutzt werde. (Ich verwende hier und im Folgenden die in der Diskussion gängigen Begriffe „Postmoderne“ und „postfaktisch“ mit dem Vorbehalt, dass ich sie nur für beschränkt plausibel halte.)
Um eine seriöse Grundlage für die Beurteilung der obengenannten Behauptung zu schaffen, möchte ich zwei verschiedene Konzeptionen des Perspektivismus unterscheiden und hierzu gelegentlich auf denjenigen Philosophen zurückgehen, auf den sich diese Konzeptionen zurückführen lassen und der eine starke Wirkung auf die Postmoderne ausgeübt hat: Friedrich Nietzsche.
Das erste Modell des Perspektivismus – ich nenne ihn Perspektivismus 1.0 – besagt: Jeder hat seine Sicht der Dinge. Die Erkenntnis ist nicht die Sache eines neutralen, reinen Subjekts, das den Überblick über die Welt hat, sondern bleibt an Individuen gebunden. Sie nehmen eine bestimmte Position ein und entwickeln ihre Sichtweise. Nach der fröhlichen Version dieses Perspektivismus, die der frühe Nietzsche in seiner Schrift „Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne“ entwickelt, tritt das Individuum als „künstlerisch schaffendes Subjekt“ auf, bricht mit „festen Conventionen“ und schafft sich – gestützt auf „einmalige ganz und gar individualisirte Urerlebniss[e]“ – eine eigene Welt als „höchst subjectives Gebilde“. „Niemand“ muss demnach noch von der „Gesetzmässigkeit der Natur reden“.
Nehmen wir – im Sinne einer Unterstellung, die ich sogleich zurücknehmen werde – an, dass sich dieser Perspektivismus 1.0 in der sogenannten Postmoderne ausgebreitet habe. Welche Vorgaben ergeben sich dann für das Verhältnis der Menschen zueinander, die ihre individuellen Perspektiven pflegen? Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können sich mit der sich ergebenden Vielfalt arrangieren, den Austausch untereinander suchen, ggf. ihre Positionen verschieben und vielleicht die Annäherung oder gar die Verschmelzung von Horizonten anstreben. Es ergeben sich Vielstimmigkeit und Vielfalt. Wenn die Menschen diesen guten Willen nicht aufbringen, dann beharren sie auf ihren Perspektiven und verkapseln sich in ihrer Partikularität.
Bei den Vertretern dieser zweiten Gruppe breitet sich nun eine Bequemlichkeit aus, die den Perspektivismus 1.0 demontiert und dementiert. Im Sinne dieser Bequemlichkeit kann jemand darauf beharren, dass seine Perspektive die einzig wahre sei, und posaunt heraus, was ihm gerade gut und richtig erscheint. Indem er seine Perspektive absolut setzt, leugnet er die Vielfalt, die seine Position nur als eine neben vielen anderen gelten lässt. Statt seine Perspektive mit einem Wahrheitsanspruch zu versehen, kann er aber auch ganz auf einen solchen Anspruch verzichten und ohne Rücksicht darauf, ob sie nun stimmen oder nicht, seine Meinungen verbreiten. Diese Gleichgültigkeit stellt, wie Harry Frankfurt in seinem Essay Bullshit zeigt, die schärfste Absage an epistemische Ansprüche dar. Denn anders als derjenige, der die Wahrheit kennt und vorsätzlich unterläuft, verhält sich derjenige, der Bullshit verbreitet, gleichgültig gegenüber der Frage, ob das, was er sagt, nun stimmt oder nicht.
Auffällig ist, dass der derzeit prominenteste Vertreter postfaktischer Politik – Donald Trump – beide Strategien einsetzt. Auf der einen Seite betreibt er eine massive Kampagne gegen die sogenannten fakenews – eine Kampagne also, die nur Sinn ergibt, wenn der vermeintlichen Lügenpresse irgendwelche Wahrheitsansprüche entgegengehalten werden. Auf der anderen Seite gibt es bekanntlich eine täglich umfangreicher werdende Liste von Behauptungen Trumps, in denen er nachweislich die Unwahrheit sagt– und zwar mit einer derart krassen Gleichgültigkeit gegenüber den Fakten, dass er auf geradezu idealtypische Weise Harry Frankfurts bullshitter verkörpert.
So oder so kommt es dabei letztlich zu einer Demontage des Perspektivismus. Gemäß der ersten Variante wird eine Perspektive absolut gesetzt, also die Vielfalt von Perspektiven geleugnet. Gemäß der zweiten Variante wird der epistemische Anspruch, der doch in jeder Perspektive als Sichtweise auf die Dinge enthalten ist, komplett fallen gelassen. Bestätigt wird diese Gleichgültigkeit gegenüber epistemischen Geltungsansprüchen durch sozialwissenschaftliche Forschungen, die bei Trump-Anhängern durchgeführt worden sind. Sie wurden beispielsweise zu Trumps Behauptung befragt, wonach bei seiner Amtseinführung – allen eindeutigen Belegen zum Trotz – mehr Zuschauer in Washington D.C. versammelt gewesen seien als bei derjenigen Obamas. Auffällig war hier die Bereitschaft der Befragten, Trumps Behauptung wider besseres Wissen zu stützen. Erklären lässt sich dies durch ein Phänomen, das als kognitiver „Tribalismus“ (Dan Kahan) bezeichnet worden ist. Die Frage, ob Trump mit der obengenannten Behauptung recht hat, wird von seinen Anhängern bejaht – aber nicht, weil sie ihm auf der epistemischen Ebene folgen, sondern weil sie diese Ebene verlassen und ihre Identität als Mitglieder seiner Bewegung aufrechterhalten wollen. Soziale Zugehörigkeit wird stärker gewichtet als epistemische Angemessenheit.
Ein Zwischenresümee ergibt demnach den folgenden Befund: Der Perspektivismus 1.0 enthält Vorgaben zur Pluralität und zum epistemischen Anspruch individueller Sichtweisen. Diese Vorgaben werden von den Vertretern der sogenannten postfaktischen Politik mit Füßen getreten. Damit ist es unplausibel, eine direkte Verbindung zwischen diesem postmodernen Perspektivismus und der postfaktischen Politik zu ziehen. Gleichwohl ist der Perspektivismus 1.0 nicht ganz ‚aus dem Schneider‘. Denn es hat sich gezeigt, dass sich die Strategie Trumps und ähnlich gesinnter Zeitgenossen im Zuge einer bestimmten Verdrehung aus diesem Perspektivismus ableiten lässt – im Sinne der oben geschilderten Bequemlichkeit und Selbstgefälligkeit. Trump setzt den Perspektivismus 1.0 nicht glatt um, aber er kann ihn als Ausgangspunkt nutzen und dann pervertieren.
Nun bleibt zu prüfen, ob eine bislang gemachte (schon mit Vorbehalt versehene) Unterstellung überhaupt zutrifft – nämlich die Unterstellung, dass der Perspektivismus 1.0 als postmoderne Vorgabe auf die postfaktische Politik einwirke. Diese Unterstellung muss man deshalb fallen lassen, weil die sogenannte Postmoderne noch über ein zweites Modell des Perspektivismus verfügt, das ihr von Friedrich Nietzsche überliefert worden ist – ein Modell, das mit ihren eigenen Annahmen wesentlich besser vereinbar ist. Im Anschluss an James Conant (Friedrich Nietzsche. Perfektionismus und Perspektivismus) ist daran zu erinnern, dass Nietzsche seinen Perspektivismus im Lauf der Jahre überdacht und verändert hat. Er gelangt zu einer Position, die man als Perspektivismus 2.0 bezeichnen kann.
Bislang schien es so, als sei der Perspektivismus mit der Vorstellung verbunden, dass Menschen mit ihren verschiedenen Sichtweisen jeweils unterschiedliche Aspekte der Wirklichkeit wahrnehmen und sich in irgendeiner Weise mit dieser Vielfalt arrangieren. Diese Auffassung greift an einem entscheidenden Punkt zu kurz: nämlich bei der Annahme des erkennenden Subjekts, das sich auf seine Sichtweise kapriziert.
Damit wird übersehen, dass ein Perspektivist keineswegs darauf festgelegt ist, einen Gegenstand von einer bestimmte „Ecke“ aus anzusehen. Zum einen kann er selbst in Bewegung geraten oder muss damit leben, ohne festen Standplatz auszukommen. Zum anderen kann er sich auch anstacheln, einen Gegenstand von verschiedenen Seiten aus zu betrachten. Die friedliche oder feindliche Koexistenz der Perspektivisten, die ihre Sichtweisen nebeneinanderstellen, ist damit in Frage gestellt. Der Perspektivismus besteht nicht nur – sozialtheoretisch – in einer Akzeptanz verschiedener Sichtweisen, die sich mehr oder minder tolerant, gleichgültig oder interessiert zueinander verhalten. Mit dem Perspektivismus verbindet sich – erkenntnistheoretisch – die Forderung, ein Ding auf vielerlei Art und von verschiedenen Positionen aus zu sehen. Diese Pluralisierung ist nur durch eine innere Anstrengung der erkennenden Instanz selbst zu leisten.
Nietzsche schreibt in Zur Genealogie der Moral: „Einmal anders sehn, anders-sehn-wollen ist keine kleine Zucht und Vorbereitung des Intellekts zu seiner einstmaligen ‚Objektivität‘. […] Es giebt nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches ‚Erkennen‘; und je mehr Affekte wir über eine Sache zu Worte kommen lassen, je mehr Augen, verschiedne Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, um so vollständiger wird unser ‚Begriff‘ dieser Sache, unsre ‚Objektivität‘ sein.“ Wichtig an diesen Bemerkungen ist zweierlei. Zum Ersten liegt in diesem Perspektivismus 2.0 die Aufforderung an das Individuum, von sich aus viele Sichtweisen einzunehmen, sich also nicht auf eine eigene Weltsicht festzulegen und sie allenfalls mit den Sichtweisen anderer zu konfrontieren. Zum Zweiten lässt Nietzsche – anders als in seiner frühen Rede vom „subjectiven Gebilde“ – den Begriff der „Objektivität“ nicht fallen, sondern nimmt ihn offensiv für sich in Anspruch. Er pocht auf die Möglichkeit des Zugangs zum „Objekt“. Es liegt gewissermaßen eine eigene Borniertheit darin, sich mit der Unerreichbarkeit eines Objekts, welches jenseits unseres Erkenntnisvermögens liegen soll, abzufinden.
Nicht nur dem Objekt, das man sieht, wird man nicht gerecht, wenn man sich im Perspektivismus 1.0 einrichtet, auch der Instanz, die sieht, ergeht es in diesem Modell schlecht. Wer sich nämlich in seiner Weltsicht einrichtet, tut so, als hätte er eben dies – eine einzige Weltsicht. Oder anders gesagt: Er tut sich dies an, nur eine Weltsicht zu haben. Damit wird eine Unterstellung gemacht, die Nietzsche aufs Schärfste attackiert: die Unterstellung, der Mensch verfüge über eine festgefügte Identität und einen festgelegten Standpunkt. In seinen späten Schriften schlägt Nietzsche diese Auffassung dem von ihm kritisierten „Egoismus“ zu.
Diese Subjektkritik, die in der Genese der sogenannten Postmoderne eine Schlüsselrolle spielt, lässt sich sozialtheoretisch in einer Weise nutzen, die Nietzsche selbst nicht näher ausgeführt hat. Demnach kann man sagen, dass die Zuschreibung einer festen Identität zu einer Borniertheit führt, die sich in einer von Konventionen, Rollenzuschreibungen und habituellen Verhaltensmustern beherrschten Welt verfestigt. Gegen das Ich, welches genau zu wissen meint, was für es gut ist, setzt Nietzsche eine Person, der sich immer wieder andere Seiten ihrer selbst zeigen. Diese jeweils neuen Seiten verdanken sich der Bereitschaft, sich von äußeren Anregungen und Aufregungen affizieren zu lassen. Die objektive und die subjektive Seite dieses Perspektivismus 2.0 greifen ineinander. So wie ein Ding viele Seiten hat, die ich in ihrer „Objektivität“ (Nietzsche) besser erkenne, wenn ich die innere Bereitschaft aufbringe, Perspektiven zu wechseln und zu vervielfachen, so hat die Welt vieles im Repertoire, was mich dazu bringt oder sogar zwingt, jeweils andere Seiten von mir zu zeigen.
Ich halte die Weiterentwicklung des Perspektivismus von der Version 1.0 zur Version 2.0 für einen großen systematischen Fortschritt. Man richtet sich nicht mit seiner kleinen Sicht auf die Dinge in der gesellschaftlichen Pluralität von Perspektiven ein, sondern erhebt den Anspruch, die Dinge in ihrer Vielfältigkeit zu erkennen und hierbei die eigene Vielfältigkeit auszutesten und auszukosten. Dieser Perspektivismus 2.0 ist ein anspruchsvolles Programm, das auf mannigfache Weise in die Kultur und die Theorie des 20. und 21. Jahrhunderts hineingewirkt hat. Seine Spuren sind im polyphonen Roman (Michail Bachtin) ebenso anzutreffen wie in der Theorie des Kinos (Gilles Deleuze) oder in breit gefächerten Überlegungen zu Identität und Alterität.
Der Perspektivismus 2.0 ist mit den Phänomenen, die unter der Überschrift „postfaktische Politik“ verhandelt werden, inkompatibel. Weder geht er einher mit der Absage an Erkenntnis oder der Abschaffung von „Objektivität“, noch gibt er sich her für eine trotzige Behauptung partikularer Sichtweisen. Bei Nietzsche heißt es: „Wir sind heute zum Mindesten ferne von der lächerlichen Unbescheidenheit, von unsrer Ecke aus zu dekretiren, dass man nur von dieser Ecke aus Perspektiven haben dürfe.“ Leider wird ebendiese „lächerliche Unbescheidenheit“ heute von Trump exzessiv praktiziert. Wenn die sogenannte Postmoderne der Kompromittierung durch Trump und Konsorten entgehen will, dann muss sie dem Perspektivismus 2.0 die Treue halten. Wenn sie dies nicht tut, dann muss man ihr keine Träne nachweinen.
Dieter Thomä ist Professor an der Universität St. Gallen. In seinem jüngstem Buch, Puer robustus (Suhrkamp 2016), widmet er sich der Philosophie des Störenfrieds.