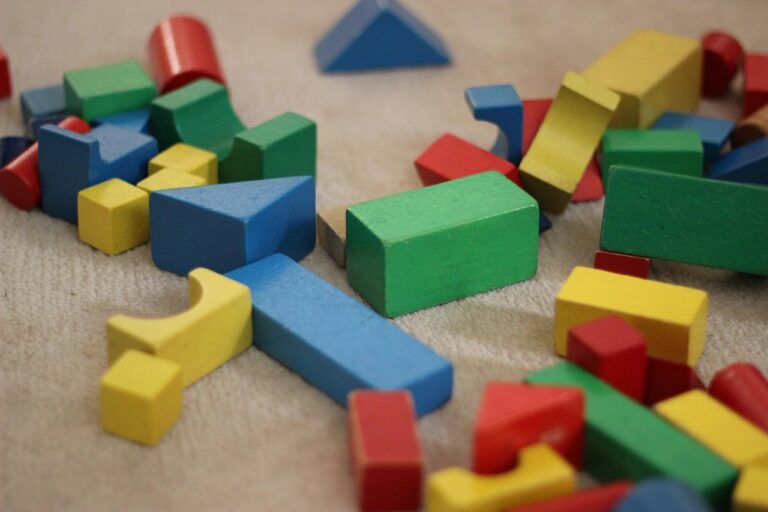Expertenherrschaft oder Wissenschaftskommunikation? Wissenschaftliche Politikberatung in Zeiten der Corona-Krise
Von Alexander Reutlinger (München)
Was ist die Rolle von Wissenschaftler/innen in der Corona-Krise? Sie beraten Politiker/innen, lautet die schnelle Antwort. Aber was bedeutet das genau? Und ist das überhaupt eine demokratisch legitimierte Aufgabe für Wissenschaftler/innen? Es gibt Stimmen, die Bedenken äußern: Haben Wissenschaftler/innen die gewählten Volksvertreter/innen unrechtmäßig ersetzt? Diese Befürchtung legt z.B. die provokante Frage „Ist das unser neuer Kanzler?“ (in Die Zeit) in Bezug auf den Virologen Christian Droste nahe. Ganz ähnlich gelagert werden auch mediale Äußerungen von Wissenschaftler/innen kritisch reflektiert: Beraten Wissenschaftler/innen lediglich, wenn sie in ihrer Rolle als Wissenschaftler/innen beispielsweise öffentlich verkünden, sie seien ganz klar für die Maskenpflicht? Diese und weitere Bedenken werfen eine politische Frage auf, die im Zentrum der Corona-Krise steht: Wo hört eine durch wissenschaftliche Expertise gerechtfertigte Beratung auf? Wo fängt eine demokratisch nicht mehr legitimierte Einmischung in die Regierungspolitik an?
Wer sich fragt, ob Wissenschaftler/innen als „neue Kanzler“ die Regierung übernehmen, denkt zu vorschnell, zu pauschal. Die Frage legt nahe, wissenschaftliche Politikberatung sei immer eine demokratisch nicht zu rechtfertigende Form von Expertokratie (Expertenherrschaft). Letztere ist eine Regierungsform, in der Wissenschaftler/innen allein aufgrund ihrer Expertise die politische Entscheidungsmacht innehaben. Expertokratie ist aus vielen Gründen zu kritisieren – insbesondere aber, weil Wissenschaftler/innen nicht demokratisch gewählt wurden, um politische Entscheidungen treffen zu dürfen. Ihnen fehlt schlicht das Mandat. Die Angst vor expertokratischen Verhältnissen ist jedoch sicherlich nicht immer gerechtfertigt und schüttet meist das wissenschaftliche Beratungskind mit dem Bade aus. Der Grund liegt auf der Hand: natürlich können Wissenschaftler/innen ihr Expertenwissen an Politiker/innen vermitteln, ohne den gewählten Volksvertreter/innen ihre demokratisch legitimierten Entscheidungsbefugnisse zu entziehen. Trotzdem ist eine Angst vor expertokratischen Tendenzen insofern hilfreich, als sie die Frage aufwirft, wie wissenschaftliche Politikberatung aussehen sollte, damit sie nicht ins Expertokratische abrutscht.
Sollten Wissenschaftler/innen, wenn sie beraten, eine konkrete Handlungsempfehlung für politische Entscheidungen abgeben – z.B. indem sie eine Maskenpflicht befürworten? In einem solchen Fall läuft etwas falsch und zwar im Selbstverständnis der Wissenschaftler/innen. Wissenschaftliche Politikberater/innen fallen durch solche Aussagen aus ihrer sozialen Rolle. Ihre Expertise berechtigt Wissenschaftler/innen dazu, bestimmte Einschätzungen zu verschiedenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus abzugeben. Zum Beispiel können und dürfen Wissenschaftler/innen Antworten auf die folgenden Fragen so vermitteln, dass sie auch Leuten zugänglich gemacht werden, die nicht über die relevante wissenschaftliche Expertise verfügen: Wie effektiv ist eine bestimmte Maßnahme? Welche Risiken bringt sie mit sich? Wie fällt der Vergleich von verschiedenen, möglichen Maßnahmen in Bezug auf deren Effektivität und Risikobehaftung aus? Antworten auf solche Frage können auf der Grundlage des gegenwärtigen Forschungsstandes einer oder – noch realistischer – mehrerer wissenschaftlicher Disziplinen gegeben werden. Aber mit der Parteinahme für eine bestimmte Maßnahme verlassen Wissenschaftler/innen als Berater/innen ihre demokratisch vertretbare Rolle. Sie wandeln sich von Politikberater/innen zu politischen Akteur/innen. Natürlich könnten Wissenschaftler/innen sagen, sie gäben diese oder jene Empfehlung nicht als Wissenschaftler/innen sondern als politisch engagierte Bürger/innen ab. Aber diese Haltung würde auf einem Missverständnis der eigenen Rolle fußen. Denn Wissenschaftler/innen werden nicht als engagierte Bürger/innen zur Politikberatung herangezogen, sondern als wissenschaftliche Experten/innen.
Daher sollten sich Wissenschaftler/innen gut überlegen, wie sie die Inhalte ihrer Beratungen formulieren und wie sie über ihre Beratungstätigkeit öffentlich sprechen. Sie sollten sich nicht selbst als weitere, „externe“ Entscheidungsträger/innen, die aktiv konkrete Handlungsvorschläge vertreten verstehen und präsentieren. Politische Entscheidungen zu fällen ist (in diesem Kontext) die Aufgabe von Politiker/innen, die durch Wahlen dazu autorisiert sind. Wissenschaftler/innen sollten sich hingegen vielmehr als Wissenschaftskommunikator/innen verstehen, die wissenschaftliches Spezialwissen möglichst verständlich an Politiker/innen und Bürger/innen vermitteln. Diese äußerst anspruchsvolle Aufgabe schließt mit ein, dass Wissenschaftler/innen z.B. die Effektivität verschiedener Anti-Corona-Maßnahmen kommunizieren. Das gibt der politischen Debatte Auswahlmöglichkeiten und damit Argumentationsspielraum, nimmt aber keine Entscheidung über die Auswahl vorweg. Das IPCC hat diese Haltung in der wissenschaftlichen Politikberatung durch den griffigen Slogan „policy-relevant and yet policy-neutral, never policy-prescriptive“ auf den Punkt gebracht. Wissenschaftler/innen sollten sich verstärkt von diesem Slogan leiten lassen. Sie sollten in der Öffentlichkeit zu verstehen geben, dass ihre Beraterrolle vor allem in Wissenschaftskommunikation zu politikrelevanten Themen besteht. Dann nehmen sie eine Rolle ein, die der Wissenschaft mit guten Gründen Glaubwürdigkeit verleiht und Ängste vor expertokratischen Zustände zerstreuen kann.
Alexander Reutlinger arbeitet als Akademischer Rat (a. L.) an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er forscht und lehrt zu Themen der Wissenschaftsphilosophie und angrenzenden Bereichen der Philosophie. Link zu meiner LMU-Homepage.