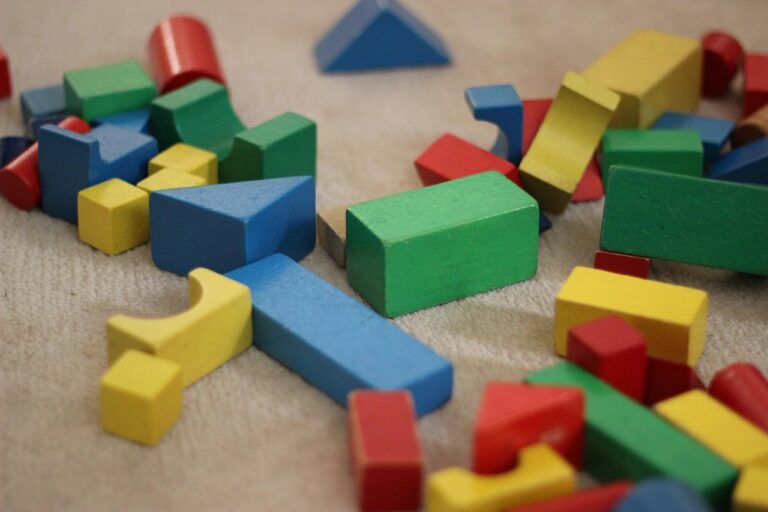Philosophieren in postfaktischen Zeiten
von Patrick Zoll SJ (München)
Was kann man als Philosoph in postfaktischen Zeiten tun? Nun, am besten wohl das, was man immer tut: analysieren, klassifizieren, kritisieren und konstruktiv etwas zur Lösung der identifizierten Probleme beitragen.
Kommen wir zur ersten Aufgabe. Der Begriff „postfaktisch“ bzw. „postfaktische Politik“ ist in aller Munde. Nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil das Adjektiv und seine englische Entsprechung „post-truth“ sowohl von den Herausgebern der Oxford Dictionaries als auch von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres 2016 gewählt wurden. Aber was bedeutet dieser Begriff eigentlich genau?
Liest man die Begründungen für diese Wahl, so sticht heraus, dass man diesen Begriff gewählt hat, weil er eine neue Epoche, ein neues Zeitalter charakterisieren soll. Dieses soll sich vor allem dadurch auszeichnen, dass in gesellschaftlichen und politischen Debatten Emotionen, Lügen („Fake News“) und eine „gefühlte Wahrheit“ („truthiness“) an Bedeutung gewinnen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Umkehrt soll ein Rekurs auf Wahrheit, Objektivität oder Fakten sich als zunehmend irrelevant für die politische Meinungsbildung erweisen.
Als „postfaktische Politik“ wird in diesem Zusammenhang eine Politik bezeichnet, die Mittel wie das Schüren von Emotionen und die Verbreitung von Fake News bewusst einsetzt, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und demokratische Abstimmungsprozesse zu gewinnen.
Natürlich ist es kein neues Phänomen, dass derartige Mittel – wie z.B. Lügen – für den Machterhalt oder -gewinn eingesetzt werden. Das besorgniserregend Neue, auf das der Begriff „postfaktisch“ hinweisen will, ist jedoch der Erfolg einer derartigen Politik, wozu zur Illustration gewöhnlich exemplarisch auf den Brexit oder die Wahl Donald Trumps verwiesen wird.
Doch selbst wenn man dieser zeitdiagnostischen Charakterisierung der Lage zustimmt, so erklärt sie als solche doch recht wenig. Denn warum ist der Einsatz solcher Mittel jetzt so erfolgreich im Gegensatz zu früheren Zeiten? Es muss also eine Veränderung, ein Wandel stattgefunden haben, der diesen Erfolg erklären kann.
Hier lassen sich nun zwei ergänzende Erklärungsansätze ausmachen, womit wir zur philosophischen Aufgabe der überblickschaffenden Klassifikation kommen. Ein erster Ansatz versucht den Erfolg postfaktischer Politik mit Theoremen wie „Filterblasen“ oder „Echokammern“ zu erklären, also mit einer Veränderung der Medienlandschaft und der Mediengewohnheiten. Das eigentliche Problem ist gemäß diesem Ansatz der Mangel an einer wirklich informierten Öffentlichkeit, die es durch den Erwerb von Medienkompetenz herzustellen gelte (vgl. z.B. Stephan Russ-Mohl, Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde: Warum die Digitalisierung unsere Demokratie gefährdet).
Ein zweiter Erklärungsansatz fokussiert sich weniger auf die Medien, sondern vielmehr auf die Rezipienten postfaktischer Botschaften. Um den Erfolg postfaktischer Politik erklären zu können, muss man beim Menschen ansetzen. Intellektualistische Versionen dieses Erklärungstyps sehen in einer relativistischen Postmoderne mit ihrer globalen Skepsis an Wahrheits- und Erkenntnisansprüchen den ideologischen Paten und Vorbereiter des postfaktischen Zeitalters. Dementsprechend komme der Philosophie die zentrale Aufgabe zu, diesen Skeptizismus und Relativismus durch eine neue Emphase auf Rationalität, Argumentation und Wahrheit zu korrigieren (vgl. z.B. Paul Boghossian, Angst vor der Wahrheit; Maurizio Ferraris, Manifest des neuen Realismus; Daniel-Pascal Zorn et al., mit Rechten reden und Logik für Demokraten).
Voluntaristische Versionen dieses Ansatzes argumentieren hingegen, dass intellektualistische Erklärungen von der falschen Vorstellung ausgehen, dass das Handeln des Menschen vornehmlich rational gesteuert ist. Der Erfolg postfaktischer Politik bestätige vielmehr die voluntaristische Idee, dass die Vernunft eine Dienerin der Leidenschaften bzw. Emotionen ist und belege, dass politische Theorien und philosophische Analysen auf falschen rationalistischen Prämissen fußen (vgl. z.B. Jonathan Haidt, The Righteous Mind; Christopher H. Aachen et al., Democracy for Realists; Elisabeth Wehling, Politisches Framing). Postfaktisch agierende Politiker seien demnach einfach erfolgreicher als ihre Kontrahenten, weil ihre Kampagnen besser die moralischen Geschmacksrezeptoren (Haidt) oder politikfremden Interessen (Aachen) von BürgerInnen bedienen oder einfach besser in der Lage sind, Fakten zu „framen“ und ihre Botschaft durch Metaphern an den Mann und die Frau zu bringen (Wehling). Der Philosophie wird in diesen Ansätzen naturgemäß eine geringe Analyse- und Lösungskompetenz zuerkannt. Methodisch dominieren hier vielmehr sozialpsychologische, soziologische oder neuro-linguistische Zugänge zur Thematik.
Die kritische Aufgabe der Philosophie kann in postfaktischen Zeiten meiner Ansicht nach auf verschiedenen Ebenen zum Zuge kommen. Auf der Ebene der Begriffsanalyse kann man als Philosoph zunächst einmal Zweifel daran äußern, ob eine Verwendung des Begriffs „postfaktisch“ wirklich hilfreich ist, um die aktuellen Herausforderungen und Probleme westlicher Demokratien zu beschreiben und zu erklären. Problematisch erscheint mir insbesondere, dass der Begriff als Erfolgsbegriff pauschalisierend unterstellt, dass für den Erfolg der Brexit-Kampagne und der Wahl von Trump normativ zu missbilligende postfaktische Mittel verantwortlich sind. Kann es nicht sein, dass für diese politischen Erfolge ganz andere Faktoren und vielleicht sogar genuin demokratische Motive ausschlaggebend waren? Zum Beispiel scheint im britischen Wahlkampf mitentscheidend gewesen zu sein, dass die Remain-Kampagne dem positiven demokratischen Slogan der Brexiter „Take our country back again!“ fast nur negative ökonomische Botschaften über die Gefahren und Kosten eines Brexit entgegenzusetzen hatte.
Eine postfaktische Erklärung läuft somit Gefahr weiter zu emotionalisieren und zu polarisieren und damit letztlich dem demokratischen Miteinander zu schaden, weil sie einer demokratischen Mehrheit abspricht, gute Gründe für eine legitime Wahloption gehabt zu haben und ihnen unterstellt, dass sie sich in ihrer Wahl übermäßig von Emotionen oder Fake News haben beeinflussen lassen. Unwillentlich wird damit das Erfolgsnarrativ postfaktischer „Täter“ bestätigt und diejenigen, die – vielleicht aus ganz anderen Gründen – für den Brexit oder Trump gestimmt haben, werden zu bemitleidenswerten Opfern („basket of deplorables“) entmündigt. Dies kann in kontraproduktiver Weise zu einer Identifizierung und Solidarisierung dieser Wähler mit postfaktisch agierenden Politikern führen, weil sie sich durch die Verachtung, die ihnen mit der Erklärung ihres Wahlverhaltens entgegentritt, auf einmal von jenen Politikern repräsentiert fühlen, denen auf der öffentlichen Bühne ebenfalls Verachtung für die Wahl ihrer postfaktischen Mittel entgegengebracht wird (vgl. dazu Jan-Werner Müller, Was ist Populismus?).
Des weiteren lässt sich kritisch rückfragen, ob es wirklich wahr ist, dass Lügen und Emotionen heute in einem höheren Ausmaß die öffentliche Meinungsbildung beeinflussen als zu früheren Zeiten. Stellt es also eine Wahrheit dar, dass wir in neuen postfaktischen Zeiten leben oder ist dies nicht vielleicht selbst eine nur „gefühlte“ Wahrheit („truthiness“) gerade derjenigen, die gegen den Brexit oder Trump waren bzw. sind?
Neben einer Reflexion auf die Bedeutung, die Diagnosefähigkeit und die Nützlichkeit einer Verwendung von Trendbegriffen wie „postfaktisch“ kommt der Philosophie noch auf einer höherstufigen Ebene eine unverzichtbare kritische Aufgabe zu. Gerade die derzeit sehr populären voluntaristischen Erklärungsansätze, die sich auf Forschungsergebnisse verschiedenster empirischer Wissenschaften berufen, treffen an entscheidenden Stellen philosophische Vorentscheidungen – z.B. akzeptieren sie die Humesche Unterordnung der Vernunft unter die Leidenschaften im Falle von Haidt –, die bedeutsame Implikationen für unser Selbstverständnis als rationale Akteure haben, die es philosophisch zu reflektieren und nicht einfach unkritisch hinzunehmen gilt.
Kommen wir damit abschließend zur konstruktiven Aufgabe der Philosophie. Wer sich vergewissern möchte, dass die Philosophie etwas Genuines zur Erklärung und Lösung der Probleme beitragen kann, die Begriffe wie „postfaktisch“ zu identifizieren versuchen, dem empfehle ich die Lektüre von Jason Stanleys How Propaganda Works. Der in Tradition der analytischen Sprachphilosophie stehende und derzeit in Yale lehrende Philosoph argumentiert dafür, dass es nicht der Gebrauch von Fake News oder ein Rekurs auf Emotionen ist, der unsere Demokratie gefährdet, sondern diese nur Teile einer komplexeren politischen Rhetorik sind, die er als „Propaganda“ bezeichnet. Sein Anspruch ist es zu erklären, was Propaganda ihrer Natur nach ist und warum sie so effektiv ist.
Propaganda ist für ihn eine politische Rhetorik, die sich als ein Beitrag zum öffentlichen Diskurs präsentiert, der an politische Ideale demokratischer Gesellschaften appelliert, aber dies mittels einer Botschaft und Mitteln tut, die die Realisierung dieser Ideale unterminieren. Im Grunde funktioniert derartige Propaganda wie Werbung: Mit schönen, schlanken und gesunden Körpern wird für zucker-, fett-, oder alkoholhaltige Produkte geworben, deren Konsum die Realisierung des Ideals eines schönen, schlanken und gesunden Körpers unterminiert. Im politischen Bereich beruft man sich dann z.B. auf das demokratische Ideal einer Erinnerungskultur und tut dies aber mit einer Botschaft von einem „Denkmal der Schande“, die genau diese Erinnerungskultur diskreditiert und abschaffen will.
Doch wenn propagandistische Rhetorik ihrer Natur nach derart widersprüchlich ist, wie kann sie dann so effektiv sein? Stanleys Antwort hierauf ist, dass die Effektivität von Propaganda von tiefsitzenden ideologischen Überzeugungen auf Seiten der Zuhörer abhängt, die sie unempfänglich und resistent macht gegen Fakten und Belege, die diesen Widerspruch aufdecken könnten. Und diese ideologischen Überzeugungen werden wiederum durch große und strukturell verfestigte Ungleichheiten materieller wie immaterieller Art in demokratischen Gesellschaften hervorgebracht und erhalten.
Wenn Demagogen mit ihrer propagandistischen Rhetorik in demokratischen Gesellschaften zunehmend Erfolg haben, so ist dies gemäß Stanley ein Alarmzeichen. Es ist also voluntaristischen Ansätzen zu widersprechen, die mit ihren Analysen den Eindruck erwecken, dass es nicht besonders besorgniserregend ist, wenn Menschen nicht bereit sind ihre Überzeugungen aufgrund von Fakten oder Evidenz zu revidieren oder zu korrigieren, weil im Menschen der Wille die Vernunft dominiere und nicht umgekehrt.
Aber auch intellektualistische Ansätze greifen auf der Grundlage von Stanleys Analyse zu kurz, weil es eben nicht einfach damit getan ist, argumentative Fehler, Widersprüche oder Lügen in propagandistischer Rhetorik aufzudecken. Um Propaganda effektiv bekämpfen zu können, muss man die Ursachen für ihre Wirksamkeit beseitigen. Dies bedeutet in letzter Konsequenz laut Stanley aber auch unangenehme Fragen in Bezug auf verfestigte Strukturen von Privilegierung, Eliten, Diskriminierung und ungerechter Verteilung und Besteuerung von Vermögen und Reichtum zu stellen.
In postfaktischen Zeiten zu philosophieren bedeutet demnach vor allem die richtigen unangenehmen Fragen zu stellen, womit der Philosophie eine unausweichlich politische Dimension zukommt. Aber dieses Ergebnis sollte eigentlich nicht verwundern. Denn am Anfang des abendländischen Philosophierens über Gerechtigkeit und unser politisches Zusammenleben steht ja Platons Staat. Ein Werk, das auf den Skandal der Ermordung des Sokrates reflektiert und danach fragt, warum die politische Gemeinschaft diesen Philosophen der unangenehmen Fragen lieber umbrachte, als ihre eigenen Überzeugungen einer Revision und Korrektur zu unterziehen.
Mit Blick auf ihre eigene reiche und lange Tradition kann die Philosophie somit auch die Perspektive mancher Debatten weiten. Aus ihrer Sicht ist das Phänomen „postfaktische Politik“ nicht gänzlich neu, sondern stellt ein wiederkehrendes Problem politischer Gesellschaften dar, das es aber jeweils neu zu bewältigen gilt. Ich hoffe angedeutet zu haben, was die Philosophie hier und jetzt dazu beitragen kann.
Patrick Zoll studierte Philosophie und Theologie in München, Madrid und Bonn. Zu seinen Veröffentlichungen zählen: Ethik ohne Letztbegründung? Zu den nicht-fundamentalistischen Ansätzen von Alasdair MacIntyre und Jeffrey Stout und Perfektionistischer Liberalismus. Warum Neutralität ein falsches Ideal der Politikbegründung ist. Er lehrt Metaphysik und Politische Philosophie an der Hochschule für Philosophie in München.