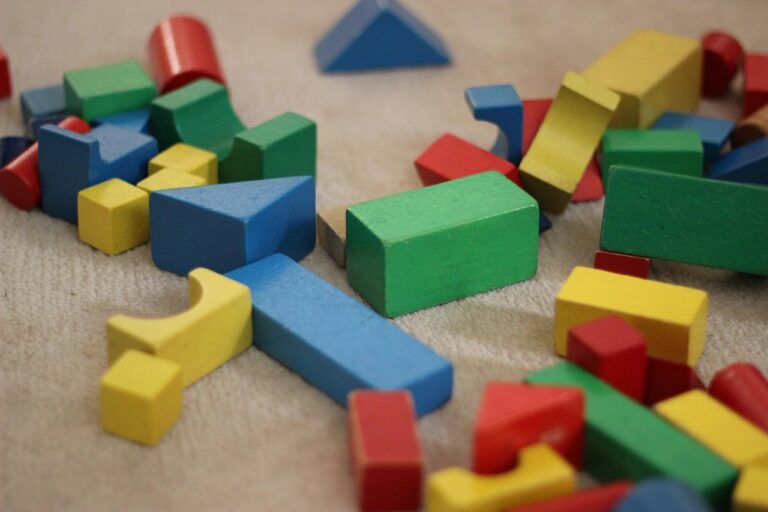Verdammt(e) Gefühle!? Vorschläge gegen Indifferenz und Gleichgültigkeit
Von Peggy H. Breitenstein (Jena)
Etwa zeitgleich mit Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus haben sich eigentümlich widersinnige Reden im politischen Diskurs eingenistet: Paradoxe Formulierungen wie „alternative Fakten“, „postfaktische Politik“, „Postwahrheit“ zeigen ernsthafte Zweifel darüber an, dass über Tatsachen und Tatsachenwahrheiten eigentlich nicht gestritten werden kann. Zugleich wird diesem Zweifel auch vehement widersprochen. Dabei jedoch geraten immer wieder die Gefühle bzw. Emotionen in den Fokus, wird ihnen doch die Schuld an der Verwirrung zugeschrieben. Das Politische werde „emotionalisiert“ und Wahrheiten nur noch „gefühlt“, heißt es. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass der eigentliche Fehler im Intellekt selbst liegt: im Versäumnis, begrifflich sorgfältig und verantwortungsvoll zwischen Meinung, Tatsachen und Tatsachenwahrheiten zu unterscheiden.
Erinnern wir uns kurz, was die jüngste Kontroverse um das Verhältnis von Politik, Emotion und Wahrheit auslöste und befeuerte. Die Rede von „alternativen Fakten“ geht bekanntlich auf Kellyanne Conway zurück, die im Januar 2017 als Beraterin des damaligen US-Präsidenten Donald Trump mit dieser Formulierung offensichtlich falsche Aussagen des Pressesprechers des Weißen Hauses Sean Spicer rechtfertigte, der behauptet hatte, während Trumps Amtseinführung vor dem Kapitol wären mehr Menschen anwesend gewesen als zu der von Barack Obama.
Im gleichen Jahr noch wurde der Ausdruck „alternative Fakten“ von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Unwort des Jahres gekürt. Und schon die Rechtfertigung dieser Auswahl wirft kein gutes Licht auf die Gefühle. Dort heißt es: „Alternative Fakten“ sei ein „neuer Ausdruck für eine neue Zeit. Eine Zeit, in der Menschen nur noch meinen wollen. Und in der Meinung und Gefühle mehr zählen als Fakten.“ [1] Demnach sind Meinungen also lediglich erlogene oder eingebildete Fakten und dienen dem eigenen, gefühlten Wohlbefinden.
Auf wenigstens zwei weitere Zeugnisse des angedeuteten ‚Anklagelieds‘ sei verwiesen: Dass in postfaktischen Zeiten die Gefühle Diskursmacht beanspruchen, behauptete 2016 bereits Angela Merkel in einer Rede, in der sie diesen Ausdruck überhaupt erstmals öffentlich erwähnte: „Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten, sondern folgen allein den Gefühlen.“ [2] Und zieht man etwa die britische Wörterbuchreihe Oxford Dictionaries zu Rate, deren Herausgeber*innen ebenfalls 2016 „Post-truth“ zum internationalen Wort des Jahres wählten, so liest man, der Ausdruck beziehe sich auf „circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief.“ [3]
Das Gefühlsbashing findet sich also sowohl im politischen wie auch wissenschaftlichen Diskurs. Und es passt auch allzu gut zur uns vertrauten „aufgeklärten“ Tradition, zu unserem ungebrochenen Glauben an die Vernunft sowie die schlagende Kraft und Durchsichtigkeit vernünftiger Argumente. Vor diesem Hintergrund kann geflissentlich darüber hinweggesehen werden, dass der Fehler gar nicht in den Gefühlen und ihrem Einfluss liegt und auch nicht in einer erneuten „Emotionalisierung des Politischen“. Schon die Diagnose einer Zunahme des Emotionalen müsste zunächst genauestens geprüft und analysiert werden. Es könnte sich hierbei selbst um eine medial erzeugte Fiktion handeln, beruhend auf der allerdings nachweisbaren immensen Beschleunigung und quantitativen Zunahme digital verfügbarer oder ins Bild gebrachter Gefühlsausbrüche (insbesondere Hasskommentare, offene Drohungen oder Wutausbrüche), die vor allem dazu dienen, in den sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erhaschen sowie die ‚Ware‘ Information mit möglichst geringer Halbwertszeit und großer Gewinnspanne loszuschlagen.
Meiner Diagnose zufolge liegt die Ursache der Ver(w)irrung hingegen im Verstand selbst. Genauer im Versäumnis einer verantwortungsvollen und differenzierten Begriffsverwendung, die mit der Unterlassung einhergeht, zwischen Meinung und Manipulation, Tatsachen und Tatsachenwahrheiten zu unterscheiden. Um Gefühle ihren angemessenen Ort im Diskurs sichern, bedarf es daher zunächst einer genaueren Begriffsklärung.
Eine recht klare und überzeugende Unterscheidung von Tatsachen, Tatsachenwahrheiten und Meinungen findet sich in Hannah Arendts berühmtem Vortrag „Wahrheit und Politik“. [4]
Als „Tatsachen“ bzw. „Fakten“ bezeichnet Arendt dort nicht einfach alles, was sich beobachtend oder schließend feststellen lässt, sondern im ganz wörtlichen Sinne das von Menschen Gemachte, die Ergebnisse menschlicher Tätigkeiten, in diesem Sinne „Facta“ (d.i. der Plural des substantivierten Partizips von lateinisch „facere“, d.h. „machen“). Da Menschen nie allein leben, sondern immer schon eine Pluralität Vieler sind, handelt es sich bei diesen Tat-Sachen zugleich um elementare Sachverhalte oder Ereignisse der sozialen Welt, des „menschlichen Zusammenlebens und -handelns“. Dazu gehören auch elementare geschichtliche Ereignisse, wie die Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1789 oder der Mauerfall am 9. November 1989. Über diese kann es keine Uneinigkeit geben: Sie sind, wie sie sind, „in einer nackten, von keinem Argument und keiner Überzeugungskraft zu erschütternden Faktizität.“
Diese Tatsachen sind allerdings darauf angewiesen, festgehalten und erinnert zu werden. Dies geschieht mittels Tatsachenwahrheiten, worunter Hannah Arendt einfache behauptende Aussagen versteht, mit denen lediglich ausgesprochen wird, was war oder ist, also z.B.: „Deutsche Truppen marschierten im August 1914 in Belgien ein.“ Oder: „Am 20. Januar 2017 wurde Donald Trump als 45. Präsident der USA vereidigt.“
Dass sie auf diese Bezeugung, Fixierung und Artikulation angewiesen sind, begründet Arendt zufolge aber auch die Prekarität von Tatsachenwahrheiten: Anders als Vernunftwahrheiten, z.B. mathematische oder logische Wahrheiten (z.B. dass die Summe aus zwei Paaren vier ergibt oder dass die Aussage, dass dies von allen Dingen der Welt gilt, nur entweder wahr oder falsch sein kann), die zeitlos gelten und beliebig oft ‚wieder-entdeckt‘ werden können, unterliegen Tatsachen der Gefahr, vergessen oder gar verleugnet werden. Sie verschwinden, wenn es keine Zeugen oder Zeugnisse (Dokumente, Urkunden etc.) gibt oder keine Menschen, die ihnen glauben. Ihr Verschwinden wiederum ist so fatal, weil sie der Boden des Politischen sind bzw. „die eigentliche Beschaffenheit des Politischen aus[machen]“.
Von den elementaren Tatsachenwahrheiten unterscheidet Arendt einerseits ihre Einbindung oder Verstrickung in Geschichten, die selbst immer von spezifischen Perspektiven aus erzählt werden und von Interpretationen abhängig sind, die daher je nach Zeit, Kultur, Einstellung variieren können und über die sich selbst Historiker gewöhnlich uneins sind. Beispielsweise mögen sich Menschen darüber uneins sein, ob die Amtseinführung und Präsidentschaft Trumps Höhepunkt einer Verfallsgeschichte der amerikanischen Demokratie darstellt oder nicht – eine Uneinigkeit, die sich durch Tatsachenwahrheiten gerade nicht schlichten lässt, auch nicht durch zukünftige. Tatsachenwahrheiten kommen in der Regel überhaupt nur im Rahmen von Geschichten zur Darstellung, nicht isoliert. Dennoch haben sie gerade in diesen Zusammenhängen eine „Vetomacht“, wenn sie verbürgt sind und sich daher mit ihnen offensichtlich falsche Darstellungen der Fakten korrigieren lassen.
Von Tatsachenwahrheiten und auch Interpretationen wiederum sorgsam zu unterscheiden sind Arendt zufolge Meinungen. Zwar sind Tatsachen der Boden des politischen und ihre Sicherung und Bezeugung selbst schon politisch. Erst Meinungen aber, ihre Bildung im Durchgang durch andere Meinungen und auch im Konflikt mit anderen Meinungen finden auf dem Feld des Politischen statt bzw. machen dieses überhaupt aus.
„Meinungen“ heißen bei Hannah Arendt allerdings nicht einfach alle möglichen subjektive Ansichten, also das, was in der philosophischen Tradition gewöhnlich als „doxa“ abgewertet wird. „Doxai“ seien – so etwa heißt es in der Sicht rationalistischer Erkenntnistheorien – unsicher, weil sie im Unterschied zu Vernunftwahrheiten auf fehlbaren Erfahrungen oder sinnlichen Wahrnehmungen konkreter Gegenstände beruhen.
Der Meinungsbegriff Arendts jedoch ist von vorn herein nicht subjektivistisch: Zunächst beruht er darauf, dass der Mensch zu einem und demselben Sachverhalt verschiedene Einstellungen (z.B. beobachtend oder handelnd) einnehmen kann und dass sich dabei auch die mit entsprechenden Urteilen verbundenen kognitiven Fundierungen ändern. Sie können je nachdem z.B. in rechtlichen Begründungen oder in unmittelbaren, sei es emotionalen oder rationalen Evidenzen gefunden werden. Vom Gesichtspunkt der politischen Praxis aus kommt es zudem in jedem Falle immer darauf an, je spezifische Handlungssituationen, die Pluralität der daran beteiligten Menschen, die Vielfalt verwobener Interessen, Normenkonflikte etc. angemessen zu beurteilen und im Streitfalle Lösungen zu entscheiden oder vorzuschlagen. In Bezug auf dieses Konkrete und dessen gemeinsame Einschätzung müssen Meinungen gebildet werden, die wiederum je nach Anspruch, Erfahrung, Geduld oder Muße ganz verschieden fundiert ausfallen können.
So sind Arendt zufolge also nicht Tatsachen selbst in ihrer nackten Faktizität Gegenstände von Meinungen, sondern Fragen danach, welche Perspektiven zur angemessenen Beschreibungen konkreter Situationen berücksichtigt werden müssen, welche Analysen adäquat sind, welche Prinzipien (Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit?) leitend für alle oder die meisten Beteiligten sein können, welche praktischen Lösung gut und auch machbar ist. Und hier geht es tatsächlich auch um die Überzeugungskraft guter Argumente, über die gestritten werden kann und die leider nicht nur von der Qualität der Argumente abhängig ist. Zwar lässt sich auch hier an Tatsachenwahrheiten, d.h. elementaren Daten und Fakten selbst nicht rütteln: Sie bleiben „zwingender Natur“ und können durch kein Argument ins Wanken gebracht werden. Schon das Begreifen der Situation selbst aber und erst recht der konkrete Umgang mit ihr beruht auf Meinungsbildung. Hier geht es darum, dass Menschen sich wechselseitig von wohlbegründeten Meinungen zu überzeugen versuchen müssen und dass Meinungen an Überzeugungskraft gewinnen, je mehr Menschen mit ihnen übereinstimmen (können).
Dieser Ansicht jedenfalls ist Hannah Arendt. Meinungsbildung hat ihr zufolge deshalb auch nichts mit Despotismus zu tun und ist mit Autoritarismus unvereinbar. Denn der Geltungsanspruch von Meinungen besteht darin, repräsentativ zu sein, das Denken anderer immer mit zu präsentieren. Obwohl es im Bereich des Politischen um eine gemeinsame Gestaltung und Veränderung der Welt geht und obwohl dabei der Streit und Kampf um bessere Begründungen wesentlich ist, setzt die Meinungsbildung daher verschiedene Fähigkeiten und Teilakte voraus, die an die „Maximen des Gemeinsinns“ bei Kant erinnern. Dazu zählen, dass man eine bestimmte umstrittene Sache von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet, d.h. sie sich so darstellen lässt, wie sie sich anderen Menschen zeigt. Sind die anderen Menschen nicht selbst präsent, sind ihre Ansichten mit Hilfe der Einbildungskraft zu fingieren und eine Meinung gewinnt an Repräsentativität, je mehr Standorte in der Welt bei ihrer Bildung durchlaufen wurden.
Was hat das wiederum mit Gefühlen oder Emotionen zu tun? Hannah Arendt zufolge wohl nichts. Sie vertritt sogar die Ansicht, dass Politik und Emotion in einem destruktiven Verhältnis zueinander stehen. [5] Dabei identifiziert sie allerdings Emotionen oder Gefühle von vorn herein mit „Mitleid“, bestenfalls „Empathie“ und reduziert damit die Rolle von Gefühlen ungemessen. Vernunft und Emotion müssen einander aber nicht dergestalt feindlich gegenüberüberstehen: Im Politischen spielen sie in meinen Augen in mindestens dreierlei Hinsicht eine zentrale und gleichwohl auch kontrollierbare Rolle.
Zum ersten ist politisches Handeln und Engagement ohne Enthusiasmus nicht möglich, d.h. ohne die Überzeugung von Menschen, dass die gemeinsame Welt eine bessere werden kann, wenn sie sich für ihre Ideale der Gerechtigkeit oder Freiheit etc. einsetzen und ihre Praxis an ihnen orientieren. Gefühlte Leidenschaft ist die Motivationskraft eines Handelns, das keinen äußeren Zwecken folgt und nicht dem Herstellungsmodell des Tätigseins entspricht.
Zum zweiten ist auch das Bedenken der Pluralität, der vielen anderen nicht möglich ohne ein gefühlsbasiertes Interesse an ihnen. Vernunft vermag dieses nicht zu begründen. Vereinfacht ausgedrückt gibt die Vernunft weder einen Grund, andere überhaupt als je eigenartige Mitmenschen anzusehen. Noch gibt sie einen Grund, mit anderen zu leben und das Zusammenleben auch auszuhalten, wenn es schwierig wird.
Zum dritten schließlich gibt es ohne Gefühle keinen Widerstand: weder gegen Grausamkeit, noch gegen Ungerechtigkeit, noch gegen Unrecht. Es gibt eine aufschlussreiche Stelle in der Dialektik der Aufklärung, an der Horkheimer und Adorno auf eine überzeugende Kritik gegen jeden falschen, weil einseitigen Vernunftglauben aufmerksam machen. Gerade die „dunklen Schriftsteller des Bürgertums“ – gemeint sind bspw. Nietzsche und de Sade – hätten auf blinde Flecken der Vernunft aufmerksam gemacht, darunter auch auf die „Unmöglichkeit, aus der Vernunft ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorzubringen“ [6].
Nicht zuletzt deshalb sollten wir die Gefühle vor erneuten Angriffen bewahren: Mit dem Wissen um richtige Unterscheidungen und Angemessenheit.
[1] Carolin Gasteiger: Eine Welt, in der alle nur noch meinen wollen. In: Süddeutsche Zeitung. 16.01.2018 [https://www.sueddeutsche.de/kultur/unwort-des-jahres-alternative-fakten-kuendigt-den-gesellschaftsvertrag-1.3827379?print=true]
[2] Angela Merkel: Wenn wir nicht gerade aus Stein sind. In: Tagesspiegel, 21.9.2016 [http://www.tagesspiegel.de/14576252.html]
[3] Neil Midgley, Post truth, in: Oxford Dictionaries, Oxford 2017 [en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth]
[4] Hier und in allen Zitaten beziehe ich mich auf Hannah Arendt: Wahrheit und Politik [1963]. In: Zwischen Vergangenheit und Zukunft. München 1994, S. 327-370.
[5] Siehe v.a. Hannah Arendt: Über die Revolution. München 1994, Kap. 2.
[6] Max Horkheimer/ Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. In: Max Horkheimer: Gesammelte Schriften. Band 5. Frankfurt/M. 1987, S. 141f.
Peggy H. Breitenstein lehrt und forscht am Institut für Philosophie der FSU Jena v.a. zu Fragen philosophischer Gesellschaftskritik und versucht sich immer wieder an Vermittlungen zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen und akademischer Philosophie.