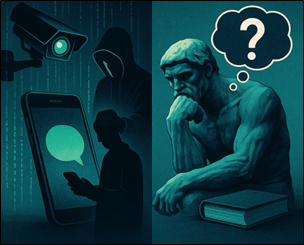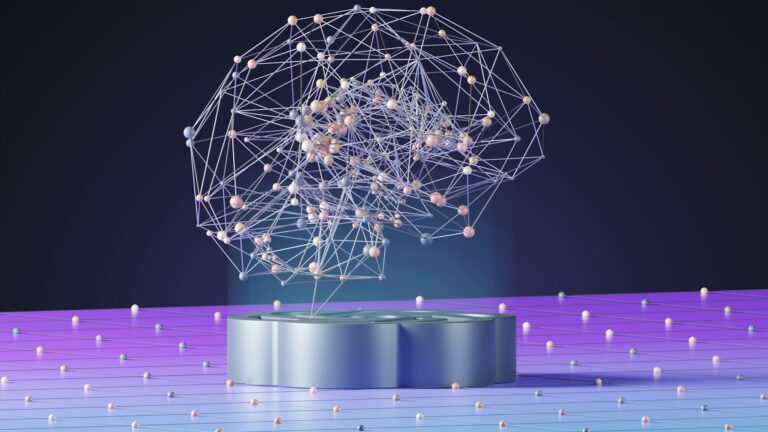„Karl May würde AfD wählen!“ Ein mutmaßlicher Wahlkampfslogan von 2023 und seine Vorgeschichte
Von Christian Niemeyer (Berlin)
Alles gackert, aber wer will noch still auf dem Neste sitzen und Eier brüten?
Nietzsche: Also sprach Zarathustra III
Mein Kriegspfad gegen Bellizist*innen aller Couleur (vorwiegende schwarze, aber auch gelbe wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die mir ausgerechnet heute, beim Schreiben dieser Zeilen, per Phoenix-TV ein Ohr abkaut pro Leopard II in der Ukraine), aber auch mein Eintreten pro Vernunft und Aufklärung lockten mich am 25. August 2022 um 14.20 in Berlin ins Kino, zwecks Besichtigung des allerneuesten Machwerks der Huldiger des politisch inkorrekten und deswegen mittels ‚kalter Bücherverbrennung‘ abzustrafenden Reiseschriftstellers Karl May. So ähnlich jedenfalls am 31.1.2022 Hadija Haruna-Oelker in der FR zum Film Der junge Häuptling Winnetou, der damals, parallel zu Karl Mays 180. Geburtstag, uraufgeführt werden sollte. Da sei Haruna-Oelker vor, die sich ganz weit aus dem Fenster lehnte: „Der Trailer verspricht Übles, was rassistische Klischees samt geschichtsrevisonistischer Romantisierung von Kolonialismus und dazugehörigen Völkermord angeht.“ Dass es ihr um das Ganze geht, zeigt der Nachsatz: „Aber wer will schon den Spirit von Karl May auflegen. Bravo! Oder Helau.“ (FR v. 31.1.22)
Inzwischen scheint mir dieser Rausch verflogen, folgt, wie mit dieser Glosse intendiert, der Kater. Hoffentlich auch jener des Kolonialismusexperten Jürgen Zimmerer, der, gänzlich unbesorgt um seinen bis dato recht akzeptablen Ruf, an eben jenem Tag, erkennbar im Sog von Haruna-Oelker, in jedes zweite Mikrophon quatschte, Rassismus und Kolonialismus gehörten quasi zu Karl Mays DNA, schlimmer: Hitler hätte seinen Kolonialismus May entlehnt. Schlimm, einen deutschen Professor, ein ‚Bleichgesicht‘ aus dem Bayerischen. so dumm und faktenfern daherreden zu hören. Fern auch jeden Versprechens, May und die Forschung dazu, erst einmal zu lesen, ehe man beide fertigmacht. Zu lesen gibt es wahrlich genug, den Karl-May-Forscher Hartmut Wörner beispielsweise. Der in seiner quellengesättigten Studie zur Rezeption Houston Stewart Chamberlain durch Karl May überzeugend darlegte, dass Mays humanitäres Credo ihn in Opposition trieb gegen dessen Rassismus und Antisemitismus. So dass – nur dieses eine Beispiel sei genannt – der Lektor beim Karl-May-Verlag in Radebeul (seit 1918) und überzeugte Nazi Otto Eicke (1889-1945) 1939 Winnetou 4 im Sinne der NS-Ideologie verändern musste, um ihn kompatibel zu machen mit Hitlers May (vgl. Wörner 2020: 127 ff.).
Fakten wie diese interessieren aber offenbar nicht mehr in Zeiten wie diesen, für die wohl kaum ein Credo passender ist als das im Motto aufgerufene Zarathustra-Wort: „Alles gackert, aber wer will noch still auf dem Neste sitzen und Eier brüten?“ (KSA 4: 233) Andererseits: Einem jeden bleibt es selbstredend vorbehalten, sich auf die je von ihm präferierte Art lächerlich zu machen – selbstredend auch dem in Rede stehenden Verlag (Ravensburg), der sich ausgerechnet am 11. August, zum Filmstart in Deutschland und Österreich veranlasst sah, das Buch zum Film zurückzuziehen, sich zugleich bei allen Unmöglichen entschuldigend. Im Kino wurde mir zwar nicht klar, was derlei irrationales, sprunghaftes, selbstschädigendes Agieren erklären könnte. Immerhin war der Film ganz okay – dies auch im Blick auf den Umstand, dass Strack-Zimmermann, hinzugerechnet den grünen Vor(hof)reiter in Sachen Bellizismus, einiges hätten lernen können aus diesem Film (falls man bei derart alten Leuten noch Bildsamkeit unterstellen darf). Denn zu besichtigen war am Ende, wie bei Karl May kaum anders zu erwarten, das große Indianerehrenwort: „Frieden schaffen ohne Waffen!“ Und auch der Chef der bösen weißen alten Männer, Putin mit Namen (oder so ähnlich, der Ton war leider nicht okay) wurde am Ende mitsamt seiner Bande dem Sheriff übergeben.
Andere Weisheiten, etwa solche nahe an Hitler („Macht Platz, ihr Alten!“), hätten vermutlich Wirkung erzielt beim kindlich-jugendlichen Publikum – wenn es nur dagewesen wäre: Ich zählte in der Nachmittagsvorstellung drei Interessierte außer mir (vermutlich keine FR-Leser). Vielleicht, so meine klammheimlich Kritik am Verleih, wäre Kevin allein im Indianerland der bessere Titel gewesen, denn das Skript war danach. Ganz klar und ganz May: Der junge, zwölfjährige Winnetou war der eigentlich Held, sein ‚Alter‘, der Häuptling, machte fast alles falsch – und Winnetous Gegner und späterer, gleichaltriger Blutsbruder, ein wirklich grandios aufspielender netter blonder Waisen-Junge, gespielt von Milo Haaf, war eigentlich nur seiner sozialpädagogisch aufschlussreichen Geschichte wegen böse, um am Ende, auf heroische Weise und äußerst pfiffig, Winnetou das Leben zu retten. Insofern: Alles gut, alles in gewohnten Bahnen, zumal um Winnetous Blutsbruder herum, der qua Indianervorbild zum Guten hinfindet, nur Weiße agieren, die dem Klischee des Verkniffenen, Falschen, schlecht Bezahnten, Trotteligen (s. Kevin) neue Glanzlichter aufsteckten. Lustig? Nein, eher albern und tausendmal gesehen (s. Kevin, aber auch Bud Spencer sowie Ottos Schneewittchenfilm).
Viel Lärm also um ein Nichts von Film? Und damit auch: Nichts weiter als ein sinnloser Skandal, darauf beruhend, dass das Buch zum Film von „sensitivity readers“ beim Ravensburger Verlag erst durchgewunken, schließlich aber doch, passend zum Filmstart, einkassiert wurde? Lächeln macht sie jedenfalls mindestens, diese Abfolge: Erst hatten sie, zähneknirschend, wie man mutmaßen darf, dem Karl-May-Mythos ihrer Kolleg*innen und jenem vom Karl-May-Verlag in Bamberg gehuldigt, auch alle mögliche Filmförderung requiriert, um dann, im von Haruna-Oelker warum auch immer entfachten Gegenwind, weitergeführt von irgendwelchen Leuten von Instagram (dieser Verlag ist mir unbekannt!), widerstandslos einzubrechen, das Buch zum Film aus dem Programm zu nehmen – und sich zu entschuldigen! Hoppla! So klein gleich – dass eigentlich nur ein blutig geschlagener Rücken als Folge des Geißelns à la Mekka oder in der großartigen Verfilmung von Hermann Hesses Narziss und Goldmund (2020) fehlt?
Deswegen hier, zur Beruhigung der Nerven aller Beteiligten, auch jener Jürgen Zimmerers, ausgewählte Einsichten eines zwar nicht „sensitiven“, wohl aber sachkundigen Karl-May-Lesers. Dabei[1] sei vorab gerne eingeräumt: Eigentlich kann ein Mythos eine feine Sache sein. George W. Bush beispielsweise, Spezialist für das Öffnen der Büchse der Pandora, wäre nach 9/11 wohl besser bei Karl May in die Lehre gegangen – dies selbstredend unter Beiseitesetzung der über diesen kursierenden Mythen. So verfocht May beispielsweise keineswegs eine „kitschige Blut- und Boden-Romantik“ (Klotter/Beckenbach 2012: 141). Auch stimmt nicht, dass Ferdinand Avenarius sein „glühender Verehrer“ (ebd.: 146) war, im Gegenteil: Avenarius, der seinem von ihm 1887 begründeten und von Nietzsche 1888 als „deutschthümelnd“ (1975-85, Bd. 8: 362) abgelehnten Kunstwart 1896 das von seinem Onkel Richard Wagner entlehnte Motto „Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen tun!“ verpasste (vgl. Bruch 1998: 431) und der allein deswegen mit dem Attributen wie „humorvoll-ironischer Sonderling“ (Reulecke 2013: 28) oder „Publizist und Kunstkritiker“ (Stambolis 2015a: 21) fraglos über Gebühr verharmlost ist, war einer von Mays heftigsten Gegnern. Dies wiederum empörte Ludwig Gurlitt (1919), 1903 Wandervogel-Protegé und später (nach dem Krieg) Herausgeber des Karl-May-Jahrbuchs, übrigens Ersteres, die Empörung, sehr zu Recht. Entsprechend hatte selbst der NS-Literaturhistoriker Josef Nadler, um Avenarius‘ May-Gegnerschaft wissend, ebenso um Mays nicht nur auf geraden Bahnen verlaufenen Lebenslauf, einige Schwierigkeiten, das Werk Mays nicht primär seinem ‚persönlichen‘, sondern seinem ‚völkischen‘ Sinn nach auszulegen (1938-41, Bd. 3: 568 f.). Auch der HJ-Führer Helmut Stellrecht (1898-1987), der nach 1945, unbelehrt wie so viele, die nationale Rechte zu sammeln suchte (vgl. Klee 2009a: 503 f.), hatte in seinem HJ-Schulungsbuch Neue Erziehung (1942) für May keine wirkliche Verwendung – abgesehen vom (erwartbaren) Rubrum ‚Abenteuersehnsucht‘, an welchem die NS-Wehrerziehung problemlos anknüpfen könne (vgl. 1942: 145), in der Linie Hitlers selbstredend, eines lebenslang begeisterten May-Lesers (vgl. Ryback 2010: 306), der sich nach Albert Speers Zeugnis via May darüber belehren ließ, „daß es nicht notwendig sei, die Wüste zu kennen, um die Truppen auf dem afrikanischen Schauplatz zu dirigieren.“ (Speer 1975: 523)
Wer May hingegen – um nach all dem ein erstes Zwischenergebnis zu sichern –, anders als Haruna-Oelker, Zimmerer, Stellrecht und Hitler, genau liest, nicht von vornherein fanatisiert und ersatzweise unter der treffenden Gattungsbezeichnung „ethnographischer Roman“ (Bartels 13,141934: 425), wird kaum etwas über Wehrerziehung (schon gar nicht im NS-Sinne) erfahren und eher den Eindruck gewinnen – wie der Volksschullehrer, May-Gegner und NS-Sympathisant Wilhelm Fronemann (1880-1954), der die NS-Prominenz beharrlich vor May warnte (vgl. Heinemann 1982) –, dass May als Anti-Rassist und Pazifist zu gelten hat und sich als Ergebnis einer tiefschürfenden und von Hans-Rüdiger Schwab (2002) exzellent rekonstruierten Auseinandersetzung mit Nietzsche insbesondere in seinem Spätwerk, etwa in Winnetou 4 (1910), als Verfechter eines ‚Rothäute‘ (Winnetou) wie ‚Bleichgesichter‘ (Old Shatterhand) gleichermaßen umgreifenden Übermenschen- resp. Edelmensch-Ideals verstand, das Platz ließ für die emporhebende Wirkung von Kirche wie Moschee gleichermaßen. Davon ganz abgesehen: Viel kann man übrigens auch heutzutage noch, etwa aus Mays ‚Orient-Erzählungen‘, lernen über den Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Auch Konfliktlösungen unter Vermeidung von Opfern könnten ihm beim Lesen in den Sinn kommen, dies unter den Bedingungen des offenbar schon vor gut einhundertfünfundzwanzig Jahren ziemlich islamistischen ‚wilden‘ Osten. Dabei sei gerne eingeräumt: Neben Mays alter ego Kara Ben Nemsi und dessen kleinem Freund Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd Al Gossarah wäre dem Texaner George W. Bush 2001 besser wohl und anfangs auf jeden Fall – passend für die Suche nach der smoking gun – Winnetou nebst Old Shatterhand anzuempfehlen gewesen. Dessen Henrystutzen schreit ja fast schon nach einer Moritat auf den – nach dem Mythos ground zero allerdings wohl nicht mehr vermittelbaren – Slogan: ‚Frieden schaffen mit einer Zauberwaffe!‘
Die Moritat aus dieser Mär: Männer können, wenn sie wollen und das Richtige lesen (George W. Bush gehört offenbar nicht dazu), lange von den Mythen ihrer Jugend zehren, ggfs. bis ins Weiße Haus hinein und durchaus mit der Pointe, dass ihnen bellizistisches Denken grundlegend verdächtig wird (was ja am Ende selbst Nietzsche gelang [vgl. Niemeyer 2011: 137 ff.]). Auch kleine Mädchen – um nun nicht nur, und sei es aus Gründen der gender correctness, der fikiven Helden vormals kleiner Jungen zu gedenken – können lange von und in Mythen leben, ehe sie, vielleicht mit fünf, vielleicht erst mit sechs oder sieben Jahren, einzuräumen beginnen, dass Ariel vielleicht doch nur ein Waschmittel ist und keine Meerjungfrau. Auch die Begeisterung für die Farbe Pink lässt in diesem Alter rapide nach, ebenso wie die für Einhörner, Elfen und, nicht zu vergessen: die Zahnfee. Man beginnt nun, es mit der Wissenschaft zu halten und sich Geschichten zu erzählen in der Absicht der Vergewisserung darüber, wie es wirklich war, nicht, wie es hätte sein sollen.
Beispielsweise die folgende: Wir schreiben das Jahr 1879/80, befinden uns im Sudan, zwei Jahre vor dem Mahdi-Aufstand, dem ersten und am Ende erfolgreichen Aufstand gegen den Kolonialismus. Unsere kleine Geschichte, eine Erzählung, skizziert das damals übliche Vorgehen bei einem Überfall von arabischen Sklavenhändlern auf ein Eingeborenendorf.[2] Ob alles – auch die Sache mit den Menschenfressern – so Wort für Wort stimmt, bleibe hier dahingestellt, schließlich geht es auch um Fiktion, in diesem Fall jene des Karl May, um genau zu sein (vgl. May 1889/90: 274 f.). Dessen Absicht in der durch Berichte des österreichischen Afrikaforschers Ernst Marno (1844-1883) angeregten (vgl. Kosciuszko 1981: 65) Erzählung Die Slawenkarawane ging auf Skandalisierung des in dieser exemplarischen Szene Geschilderten, allen Fehllektüren, namentlich jener der Kolonialismus-Skandalisierer David Olusoga & Casper W. Erichsen (2010) zum Trotz. Ihr May-Wissen reicht maximal bis zu Winnetou & Old Shatterhand ohne Orientzyklus und Kara Ben Nemsi – mit fatalen Folgen, etwa der belegfreien Zurechnung Mays („May was not a lone voice“) zu den „Völkisch mystics, promoted their firm belief […] that German’s colonies could save the Volk Ohne Raum from the misery of the industrial cities.“ (Olusago/Erichsen 2010: 108) Alles wird hier zusammengerührt, speziell: Karl May mit Hans Grimm, und dies, was May angeht, ohne jede Kenntnis seines Werkes […].
Ein wenig Sachverstand – statt ungehemmter Urteilsfreude – schiene mir also gerade in diesem Themenfeld durchaus erwünscht. Was auch gegen Haruna-Oelker und Zimmerer geht […]. Heißt: Der deutsche (europäische) Kolonialismus hätte durchaus profitieren können von einem christlichen, nicht-rassistischen Blick auf den Afrikaner resp. „die halbwilden Völker“, von denen, so May, die (deutschen) Gelehrten zu Unrecht behaupteten, dass sie „weder Herz noch Seel‘ besäßen!“ (May 1889/90: 475) Noch deutlicher ist die in Im Lande des Mahdi I (1891) nachgereichte Variante: „Wer den [N-Wort] nicht für erziehungsfähig hält, wer ihm die besseren Regungen des Herzens abspricht, der begeht eine große Sünde nicht nur gegen die schwarze Rasse, sondern gegen das ganze Menschengeschlecht.“ (May 1891: 46) Nichts indes zu diesem Punkt bei Anna Babka. Entsprechend leicht fällt es ihr im Zuge einer rein moralisierenden, kontextentbundenen und historisch uninformierten Lektüre, May wg. seiner Darstellung des Kara Ben Nemsi in In den Schluchten des Balkan (1892) aus dem Orientzyklus dem kolonialen, auf Abwertung der „Kolonialisierten auf der Basis ihrer ethnischen Herkunft“ abzielenden „kolonialen Diskurs“ (Babka 2015: 111) zuzurechnen – und dies, wo May in seiner Erzählung „auf heimatliche Verhältnisse und schlechte Erfahrungen mit Behörden und Beamten“ anspielte, „die er in seinen eigenen bewegten Jugendjahren am eigenen Leibe zu spüren bekam.“ (Pleticha 2003: 13) Kaum minder gravierend: Babka ignoriert, dass May Kara Ben Nemsi auch nach der Figur des Afrikaforschers Gerhard Rohlfs (1831-1896) zeichnete und mit der dunklen Seite des Kolonialismus und Rassismus nichts zu schaffen hat. (vgl. Lieblang 1998: 301 ff.) Ganz anders die NS- und AfD[3]-Kolonialismus-Ikone Carl Peters (1856-1918). So gab Peters noch im September 1915 seiner Hoffnung Ausdruck, der Ausgang des Kriegs werde „uns ein erweitertes und befestigtes Kolonialgebiet schaffen.“ (Peters 1915: 7) Ähnlich die Hoffnung einen Weltkrieg später, im Oktober 1941, im Vorwort zur zweiten Auflage eines Afrika-Ratgebers, der erstmals im März 1939 erschienen war und nun mit dem Wunsch neu an den Start ging, „daß eine dritte Auflage schon ein neu erstandenes Kolonialreich begrüßen dürfte!“ (Rohrbach/Rohrbach 21941: 8)[4] Auffällig an diesem Buch im Vergleich zu analog NS-affin argumentierenden Konkurrenzprodukten (etwa Haenicke [Hg.] 1937; Schnee 21941; zur Kritik: Graichen/Gründer 32005: 407 ff.): die klare Warnung vor der Syphilis als eine Gefahr vor Ort für den jungen Eroberer (vgl. Niemeyer 2021: 324).
Warnungen dieser Art finden sich bei Karl May – dem Sex nicht wirklich ein Thema war – nicht, auch nicht rassistisch untermauerte Eroberungs- und Herrschaftsgelüste, im Gegenteil: Mays Besonderheit insbesondere in der Sklavenkarawane sowie in seiner Mahdi-Trilogie ist eine wertschätzende, die Bildsamkeit des Afrikaners betonende. Wichtig dabei, als A & O für das Verständnis des Beginns der deutschen Kolonialgeschichte, und auch dies berücksichtigt die May-Kritikerin Anna Babka nicht mit einer Zeile: Die von May erzählerisch aufgegriffene, schon von Rohlfs angesprochene Problematik einer arabischen, schon über Jahrhunderte währenden Sklavenjagd in Afrika (vgl. Flaig 32018: 83 ff.). In Mays Lesart kommt dabei der Part des ‚Guten‘, was die Sklavenkarawane angeht, dem als Sohn jüdischer Eltern in Schlesien zur Welt gekommenen, später zum Islam konvertierten und bei einer Expedition im ägyptischen Dienst in den Kongo von arabischen Sklavenhändlern aus Rache ermordeten Arzt und Afrikaforscher Mehmed Emin Pascha (1840-1892; eigentl. Eduard Schnitzer) zu. May beschreibt ihn als „hochberühmten Mann, welcher alles tut, um den Wohlstand seiner Untertanen zu begründen und zu beheben. Besonders duldet er keinen Sklavenhandel, den er in seiner Provinz aufgehoben hat.“ (May 1889/90: 227) Der Konjunktiv im Satz „Die Figur des Emin Pascha könnte einem Karl-May-Roman entsprungen sein“ auf Seite U 2 der neueren Gesamtdarstellung von Patricia Clough (2012) steht, so betrachtet und in Fußballersprache geredet, für ein klassisches Eigentor (ersatzweise: für eine Blutgrätsche des Lektorats). Über May hinausgedacht kommt dem Dargestellten exemplarische Bedeutung zu, insofern die deutsche Kolonialpolitik – auch die britische, französische, belgische – ursprünglich von dem Versprechen profitierte, sie böte Schutz vor den zumeist arabischen Sklavenhändlern, ein Versprechen indes, in dessen Rücken sich die koloniale Praxis nicht eben selten als andere Form von (auch sexueller) Versklavung (gleichsam vor Ort) darstellte, mit der Folge einer anti-kolonialen Bewegung, die, dann notwendig, auch als sexualbefreiende zu deuten ist – und damit auch gegen die Syphilis aufzutreten hat. Heißt, im Blick auf unser Thema und unabhängig davon, dass May in seiner ihm eigenen Prüderie davon schweigt: Dem Kolonialismus eignet notwendig der Import des Toxischen in ein zuvor unverseuchtes Gebiet, etwa Tahiti. Wo „Cooks Reisebegleiter“ die „öffentlich vollzogene Begattung […] unter guten Rat der Umstehenden, namentlich der Weiber“ (Bloch 1903: 196), bestätigt haben sollen. Damit der Neugier in Europa Auftrieb gebend, mit der Folge, dass „die aus Europa eingeschleppten tödlichen Geschlechtskrankheiten“ dafür sorgten, „die Bevölkerung innerhalb weniger Jahrzehnte auf einen Bruchteil“ (Knöfel 2022: 123) schrumpfen zu lassen.
Soweit mein Befund nicht etwa – wie der Titel Rot-Weiß Winnetou nahelegen könnte – in Sachen der Frage, ob Winnetou zu seiner Currywurst „Ketchup oder Mayo“ bevorzugte; sondern in Sachen des Problems, ob Karl May „Rothaut“ sagen durfte und „Bleichgesicht“ sowie „Neger“: Ja, er durfte, denn er war, wie Nietzsche, ein ressentimentfreier Geist – dies allen ‚Bleichgesichte*innen‘ bei Ravensburg und anderswo ins Gemüt geschrieben, hinzugerechnet Hadija Haruna-Oelker, die, knapp vor Zimmerer, einen Rekord brach: Denjenigen in Sachen des Missverhältnisses zwischen Urteilsfreude und Faktenkenntnis. Und im Blick auf welche mich nur eine Hoffnung umtreibt: Die, dass sie endlich aufhören möge, ihren „Ich-bin-die-Gerechteste-unter-allen-Gerechten“-Wahn wie eine Monstranz vor sich herzutragen, ohne Kopf, nur mit Herz. Denn derlei Herzensweisheit, im Film vielfach beschworen als von Winnetous Oma gepredigte Indianerweisheit, leitet, wie schon Kant wusste, häufiger fehl als man glauben mag – und zuletzt das May-Bashing der Ravensburger offenbart. So es Ihnen nicht allein darum ging, einen ganz raffinierten Weg zu finden zwecks Außerkraftsetzung des heftigsten Bleichgesichter-Bashing der neueren Filmgeschichte, zu besichtigen in eben jenem Film.
Soweit gediehen mit meinen Überlegungen, hätte eigentlich alles ein gutes Ende nehmen können – wenn mir nicht die Wahnsinnsidee gekommen wäre, das bisher Geschriebene in meine neue Kolumne Spott-Light bei HaGalil.com einfließen und um den am gleichen Tag eingestellten Text[5] alle Welt wissen zu lassen, vor allem die in ihm Kritisierten. Um über die dabei erzeugten Reflexe zu berichten, der durch FW 324 nahegelegten Devise Nietzsches folgend: „Das Leben ist ein Experiment des Erkennenden!“ Am nämlichen Tag hatte ich, diesem Prinzip folgend, schon einmal im Berliner KaDeWe geübt, indem ich eine neben mir stehende Lady mit einem schneeweißen Pudelwelpen auf der Einkaufstüte aufgeregt fragte, in welcher Abteilung man denn derlei Entzückendes käuflich erwerben könne. Indes: Wie schon diese Generalprobe schief ging – die Security geleitete mich nach einigem Gekreisch der Lady heraus aus dem Kaufhaus, zum Glück hatte ich meinen Fachpresseausweis als Reporter von Hound & Dog, wie Hugh Grant in Notting Hill (1999), dabei –, war auch mein Experiment, die von mir Kritisierten um Ihre Meinung zu meiner Kritik zu fragen, nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Hadija Haruna-Oelker beispielsweise, die ich am 26. August nach ihrer Meinung zu Rot-weiß Winnetou fragte, war sich beispielsweise, ähnlich wie der ihrer Alterskohorte zugehörende perfekte Externalisierer Nick Kyriogos bei den US-Open, keinerlei Schuld bewusst, stellte schlicht in Abrede, im Januar 2022 einen falschen Aufschlag in Sachen des Kinderfilms Der junge Häuptling Winnetou gegeben zu haben und monierte, wie ein Polit-Profi, ich hätte sie falsch zitiert. Des Weiteren empfahl Sie mir „zur Anregung“ die Filmkritik Ihres Kollegen Daniel Kothenschulte von der Frankfurter Rundschau vom 16. August. Deren Eröffnungssatz allerdings durchaus irritierte: „Dies ist keine Filmkritik“, lautete der erste Halbsatz, weitergeführt mit: „denn nach einer Stunde hatte ich genug von rassistischen Darstellungen indigener Völker Nordamerikas.“ Hatte Kothenschulte möglicherweise im falschen Kino gesessen und einen Film mit Johne Wayne oder gar Ronald Reagan gesehen? Oder hatte er seiner jungen Kollegin Haruna-Oelker einen Gefallen tun wollen? Oder, um die schlimmste Variante zu bedenken: Hatte ich, der nach einer Stunde in diesem harmlosen Kinderfilm gerade einmal mein Eis aufgeschleckt hatte, womöglich das Gemüt eines Fleischerhundes (übrigens eine Diagnose meiner Frau, wobei ich allerdings hinzufügen muss, dass sie ein Faible hat für Hunde aller Art)? Zumal ich mich in meiner Antwort an Haruna-Oelker vom nämlichen Tag kaltlächelnd dagegen verwahrte, sie falsch zitiert zu haben.
Während ich ihr dies schrieb, zitierte ich still für mich noch einmal den Anfang dieser Kolumne und fragte in meiner zweiten Mail an Haruna-Oelker, Fleischerhund-gemäß, ob das „Helau!“ auf Karl May etwa nicht „auf Ihrem Mist gewachsen“ sei und dass sie mich mit Ihrem Filmkritiker verschonen möge, hinzusetzend: „Herr Daniel Kothenschulte hat ja noch nicht einmal den Film ganz gesehen, den er kritisieren sollte!“ Ich setzte noch hinzu, wiederum nicht sehr fein: „Und ein Claqueur aus eigenem Haus nutzt Ihnen gar nichts, handelt Ihnen und der FR eher den Vorwurf ein, des Kampagnenjournalismus zu frönen.“ Daraufhin kam – wem wundert’s? – eigentlich nichts mehr, abgesehen vielleicht von einem Abschiedsgruß („Alles Gute für Sie“) nach Art einer besorgten Krankenschwester – irgendwie cool, also passgenau zu meiner Diagnose ihres Problems: Popjournalismus.
Einmal so in Brast und aus Gründen der gender correctness versorgte ich gleich danach einen Mann, Haruna-Oelkers und Kothenschultes Chef Thomas Kaspar mit Rot-Weiß Winnetou und endete versöhnlich, nämlich mit: „Es wäre schön, wenn Sie auch einmal anderen Auffassungen Raum gäben, zumal die Debatte durch die Einlassungen von Zimmerer (Hitlers May) in immer flacheren Gewässern dümpelt.“ Hierauf kam keine Antwort – vermutlich, weil Kaspar nicht entgangen war, dass die Vokabel „flaches Gewässer“ auch auf seinen Filmkritiker anspielte. Deutlicher: auf den Umstand, dass Kothenschulte infolge seiner Weigerung, den Film, den er rezensieren sollte, sich überhaupt bis zum Ende anzuschauen, klugerweise auf gleichsam Vor-Filmisches sich beschränkte, etwa auf Kritik am „Redfacing“ der eigentlich weißen Schauspieler. Wo wir damit schon bei der Hautfarbe sind, ob aufgemalt oder, wie bei Ukraine-Reportern gängig, durch Sonnenbrand verschuldet oder wie auch immer: um den eigentlichen Skandal des Films Der junge Häuptling Winnetou konnte unser FR-Filmkritiker in seiner mit der Losung „Dies ist keine Filmkritik“ eröffneten Filmkritik natürlich nicht wissen; den nämlich – eben schon angedeutet –, dass dieser Film für das wohl heftigste, bis heute nicht geahndete Bleichgesichter-Bashing der neueren Filmgeschichte steht.
So betrachtet ist übrigens der Versuch von Susanne Koelbl[6], preisgekrönte Auslandskorrespondentin des Spiegel und PEN-Mitglied, zumindest doch gut zehn Tage später, nämlich am 3. September, als die Karawane schon längst weitergezogen war, endlich auch ein Wort zur inzwischen fast zu Tode gehechelten Causa beizutragen, vielleicht dem übergeordneten Ziel einzuordnen, aus Gerechtigkeitsgründen nicht nur ‚Bleichgesichtern‘, sondern auch ‚Rothäuten‘ den Zugang zum Titel „Trottel des Monats“ zu eröffnen. Wovon ich rede? Nun, natürlich vom Apachen Gonzo Flores. Der sich auf Koelbls Frage, wie er zur Kritik an Karl May vom Typ „Verharmlosung der Vernichtung der Ureinwohner“ stünde, zu der offenbar witzig sein sollenden Bemerkung verstieg: „Karl May […] ist besser als die Darstellungen hier in den USA, wo es bis 1993 ein Gesetz gab, das erlaubte, Apachen zu töten. Da ist Winnetou vergleichsweise fortschrittlich.“ (Der Spiegel Nr. 36 /3.9.2022: 80) Der Skandal ist nicht so sehr diese Antwort, sondern das Schweigen Koelbls nach dem Motto: „Lieber den O-Ton eines Betroffenen, zumal wenn er unterhaltsam ist, als ermüdende Rückfragen nach den Textgrundlagen des so Urteilenden.“ Eine Haltung, die das schleichende Eindringen des Popjournalismus auch in die einstige feste Burg des Investigativjournalismus erklären könnte. Dass die FR von derlei Verfall gleichfalls betroffen ist, haben wir eben angedeutet und in Rot-weiß Winnetou am Beispiel der FR-Kolumnistin Hadija Haruna-Oelker erläutert, endend mit dem Ratschlag: „Ein wenig Sachverstand – statt ungehemmter Urteilsfreude – schiene mir also gerade in diesem Themenfeld durchaus erwünscht.“ Gender correct, wir mir scheint, dass dieser Ratschlag nun auch adressiert werden kann in Richtung eines Mannes (Gonzo Flores), wenn nicht gar zwei: Jürgen Zimmerer.
Ihm, diesem berühmten Kolonialismusforscher von der Uni Hamburg, machte ich am 26. August mit Rot-weiß Winnetou sowie einem weiteren, am 2. November 2021 auf HaGalil eingestellten Text[7] bekannt – leider wieder einmal etwas undiplomatisch (Ich weiß: Meine große Schwäche, aber ich arbeite daran, schöpfe also die Parole „lebenslanges Lernen“ bis zum bitteren Ende aus). Ich eröffnete meine Mail nämlich mittels der Worte: „Mit Entsetzen habe ich gelesen, was Sie in verschiedenen Medien zum Komplex May/Hitler ausgesagt haben. Es ist fern jeder Sachkunde und ramponiert Ihr Image als renommierter Kolonialismusforscher nachhaltig.“ Einverstanden: Schriebe mir jemand in diesem Ton („Bitte, liebe Leser*innen, lassen Sie’s!“), würde ich natürlich auch sofort verstummen wie ein Fisch. Insofern, lieber Kollege Zimmerer: Es war nicht so gemeint – sondern eher wie folgt: Ihre am 26. August per Berliner Zeitung in Umlauf gebrachte These, es sei „kein Zufall, dass Adolf Hitler und SS-Chef Himmler große Karl-May-Fans waren“, ist nicht wirklich eine eines Wissenschaftlers würdige Aussage, wohl aber von starker Suggestivkraft, wie sie auch am Volksgerichtshof gängig, weil wirkungsvoll war. Bemühen Sie sich also bitte für die Zukunft wieder um die am Beginn Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn Ihnen zur Pflicht auferlegte, auf Argumente und Belege setzende Redeweise. Denn ansonsten schädigen Sie die Autorität des Arguments und mithin das darauf gründende Vertrauen, das der BZ offenbar Anlass gab, Sie um Auskunft zu bitten in der Causa May resp. des Films Der junge Häuptling Winnetou. Insgesamt nährt Ihre in jener Ausgabe der BZ zitierte, offenbar durch die FR-Kolumnistin Hadija Hanuta-Oelker angeregte Aussage, „der Rassismus und der Kolonialismus“ würden „quasi die DNA der Geschichten von Winnetou, Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi“ ausmachen, für mich den Verdacht, Sie hätten, wie Ihre Vorrednerin sowie Alina Schwermer von der taz[8], nichts von oder über May gelesen, nähmen also eine ausgewiesene Popjournalistin als jenes Maß, an welchem auch Sie sich in Zukunft messen lassen wollen. Dazu passt dann, dass Sie sich am 28. August um 7:10 nachm. per Twitter eine von 4.000 Menschen (inzwischen sind es weit mehr als 12.000) unterzeichnete, von meinem Kollegen Andreas Brenne (Uni Potsdam) dankenswerterweise (mit-) angeregte Petition pro differenzierter Winnetou-Debatte mittels der Worte verunglimpften: „Wow, 4000 Unterschriften für das Recht auf ein kolonialistisches und rassistisches Weltbild in der Jugendliteratur.“ Angesichts dieser Ihrer geradezu bösartigen Umdeutung einer auf Differenzierung pochenden Resolution will mir zu Ihren Gunsten eigentlich nur noch die Überlegung einfallen, dass Sie womöglich Karl May mit Carl Peters verwechselt haben – und auch andere Passagen aus dem Ihnen oben anempfohlenen Text Jenseits von Europa nicht zur Kenntnis nahmen.
Bleibt abschließend, in Rückerinnerung an das Motto und mithin Nietzsche, meine Bitte vor allem an Hadija Haguna-Oelker, Daniel Kothenschulte, Alina Schwermer, Susanne Koelbl und Jürgen Zimmerer, in Zukunft weniger laut zu gackern und ersatzweise, eine Zeitlang schweigend, ein Ei auszubrüten. In Gestalt etwa einer „richtige Meinung“. Die ja, laut Nietzsches buchstäblich „letzter Erwägung“ vom Dezember 1888/Januar 1889, geeignet sein sollte „der Kriege [zu] entrathen“. Vor allem des absurden Krieges um Karl May zugunsten des Kampfes gegen die wirkliche Gefahr; und die kommt, wie immer eigentlich schon in Deutschland, von rechts, wie neben dem Kunstpädagogen Andreas Brenne nur noch ein weiterer der von mir Angeschriebenen herausstellte: Der einleitend erwähnte Karl-May-Forscher Hartmut Wörner. Ihm auch danke ich die hier weiterentwickelte Idee, dass die AfD, womöglich infolge der neueren Winnetou-Debatte den 2017er Wahl-Slogan „Luther würde NPD wählen!“ 2023 toppen könnte mittels des Spruches: „Karl May würde AfD wählen!“ Zu diesem Zweck müsste man nämlich nur noch die aktuelle Freude der Neuen Rechte à la Jürgen Elsässers Compact (Cancel Culture . Staatsfeind Winnetou) über das im Winnetou-Bashing der Cancel Culture zum Ausdruck kommende Eigentor der Linken allmählich transformieren in Begeisterung ob eines eigenen Angriffs, etwa durch Aufbau eines dann in der Tat staatsfeindlichen, gleichsam ‚bösen‘ Karl May. Die Parole „Karl May würde AfD wählen!“ könnte dabei gute Dienste leisten, ebenso wie eine diese Parole vorbereitende Allianz mit Jürgen Zimmerer, der sich im Bayerischen Rundfunk (zit. wird hier n. Peter Jungblut, BR 24, 29.08.2022, 01:26 Uhr) dahingehend vernehmen ließen: „Teile ihrer (Hitlers und Himmlers; d. Verf.) Ostbesatzungspolitik […] orientiert sich an Vorstellungen von der ‚Eroberung des Wilden Westens‘, wie sie sie aus den Büchern Karl Mays entnommen haben“: Treibt Ihnen die Lektüre des bisher von mir Geschrieben bzw. Zitierten nicht wenigstens jetzt allmählich die Schamesröte ins Gesicht, wenn Sie also so wollen: eine Art Redfacing der neuen Art? Oder haben Sie schlicht keine Zeit für derlei, weil sie ja schon wieder auf dem Kriegspfad sind, diesmal, wie man so hört, gegen die soeben verstorbene Queen, ihrem verschwiegenen Kolonialismus und den gestohlenen Kronjuwelen auf der Spur? Dann wünsche ich Mut und Kraft und neige dem zu, was Jungblut gleichfalls über sie kolportierte: nämlich dass Sie in ihrer „Zunft nicht mehr ernstgenommen werden“ – ebenso wie Jürgen Elsässer von den Leser*innen von Compact 2023, so sie das Elefantengedächtnis aufbringen, sich des Elsässers Jg. 2022 zu erinnern…
Autor: Prof. Dr. Christian Niemeyer, Berlin. niem.ch2020@outlook.de
[1] Das Folgende entnahm ich meinen Büchern Mythos Jugendbewegung. Ein Aufklärungsversuch. 2. Aufl. Weinheim Basel 2018, S. 9-11 sowie, ab „Beispielsweise die folgende…“, meinem Schwarzbuch Neue/Alte Recht. Glossen, Essays, Lexikon. Weinheim Basel 2021, S. 325 f und schließlich, ab „Heißt….“, meinem Buch Sex, Tod, Hitler. Eine Kulturgeschichte der Syphilis (1500-1947) am Beispiel von Werken vor allem der französischen und deutschsprachigen Literatur. Heidelberg 2022, S. 207 f.
[2] „Dieser [Überfall] geschieht meist so, daß die das Dorf umschließende Dornenhecke an vielen Stellen angebrannt wird. Sie steht sehr bald rundum in Flammen. Die Bewohner erwachen; sie können nicht entkommen, weil sie umringt sind. Wer von ihnen sich zur Wehr setzt, wird niedergeschossen. Überhaupt werden gewöhnlich alle Männer getötet, weil sie sich selten in ihr Schicksal fügen und also den Transport erschweren. Auch die älteren Frauen werden erschlagen, weil niemand sie kauft. Die Knaben, Mädchen und jungen Frauen bilden die erwünschte Beute. Auch die Herden sind hoch willkommen. Es kommt vor, daß man schon auf dem Rückwege […] die erbeuteten Leute gegen Elfenbein vertauscht. Geht der Zug durch das Gebiet eines Stammes, welcher das Fleisch der Menschen demjenigen der Tiere vorzieht, so schlachten die Sklavenjäger die fettesten der erbeuteten Neger und verhandeln sie an die Menschenfresser.“
[3] Dieses Attribut erklärt sich mit der – auch auf die NS-Kolonialismus-Ikone Paul von Lettow-Vorbeck (1870-1964) ausgedehnte – Begeisterung von AfD-Politikern (wie Marc Jongen) und Neurechtsideologen (wie Erik Lehnert) für beide sowie für den rassistischen US-Neo-Kolonialisten Bruce Gilley (2021) (vgl. Niemeyer 2021: 312 ff.).
[4] Der Seniorautor Paul Rohrbach (1869-1956) war ein schon der Vorkriegsjugendbewegung vertrauter völkischer Kulturimperialist, dessen nach 1945 von Jugendbewegungshistoriographen in bewährt verharmlosender Manier gedacht wurde. (vgl. Niemeyer 2013a: 164 f.)
[5] Spott-Light: Rot-weiß Winnetou (s. https://www.hagalil.com/2022/08/winnetou/)
[6] Sie autorisierte mich am 22.09.2022 per Mail („Nur zu, lieber Herr Niemeyer!“), meine bisherigen, ihr zur Kenntnis gegebenen Überlegungen zum Thema Winnetou (vgl. Niemeyer 2022a,b) weiterzuführen, was ich, wie hier zu sehen, nur allzu gerne tue.
[7] Jenseits von Europa. Über Kolonialismus, sexualisierte Gewalt, rassistischen Sexualmord und Syphilis am Beispiel von Karl May und seines Antipoden Carl Peters (s. https://www.hagali.com/2021/11/jenseits-von-europa/), wiederum entwickelt aus meinem in Fußnote 1 erwähnten Schwarzbuch, diesmal: Kap. 10.
[8] Die uns schwer anheitert mit Sätzen wie: „Sie (May-Bücher, d. Verf.) sind dermaßen rassistisch, deutschtümelnd und frauenfeindlich, dass man nur hoffen kann, Sigmar Gabriel weiß gar nicht, was drinsteht.“ (taz v. 30. August, 10: 56) (Womit er, Gabriel, sich übrigens nicht unterschiede von seiner Antipodin).