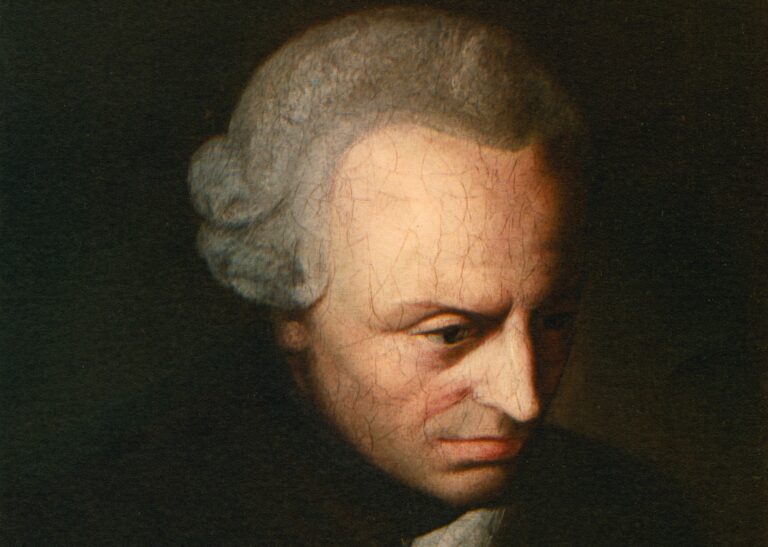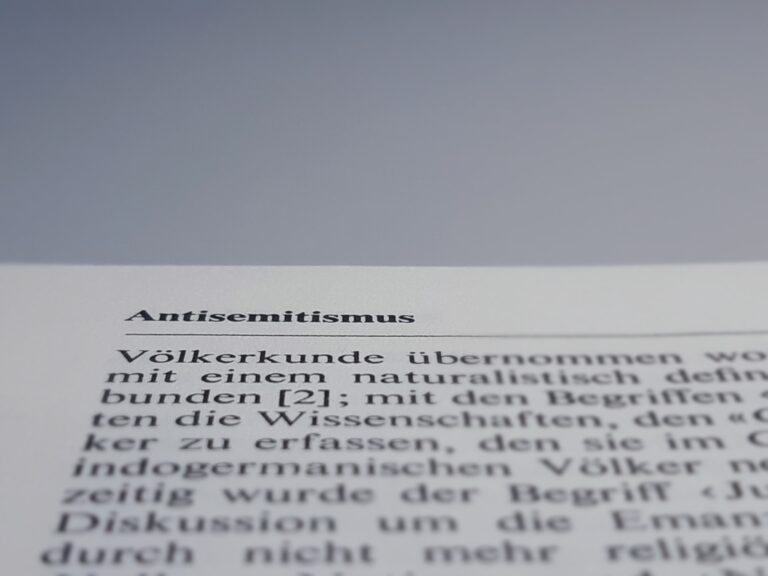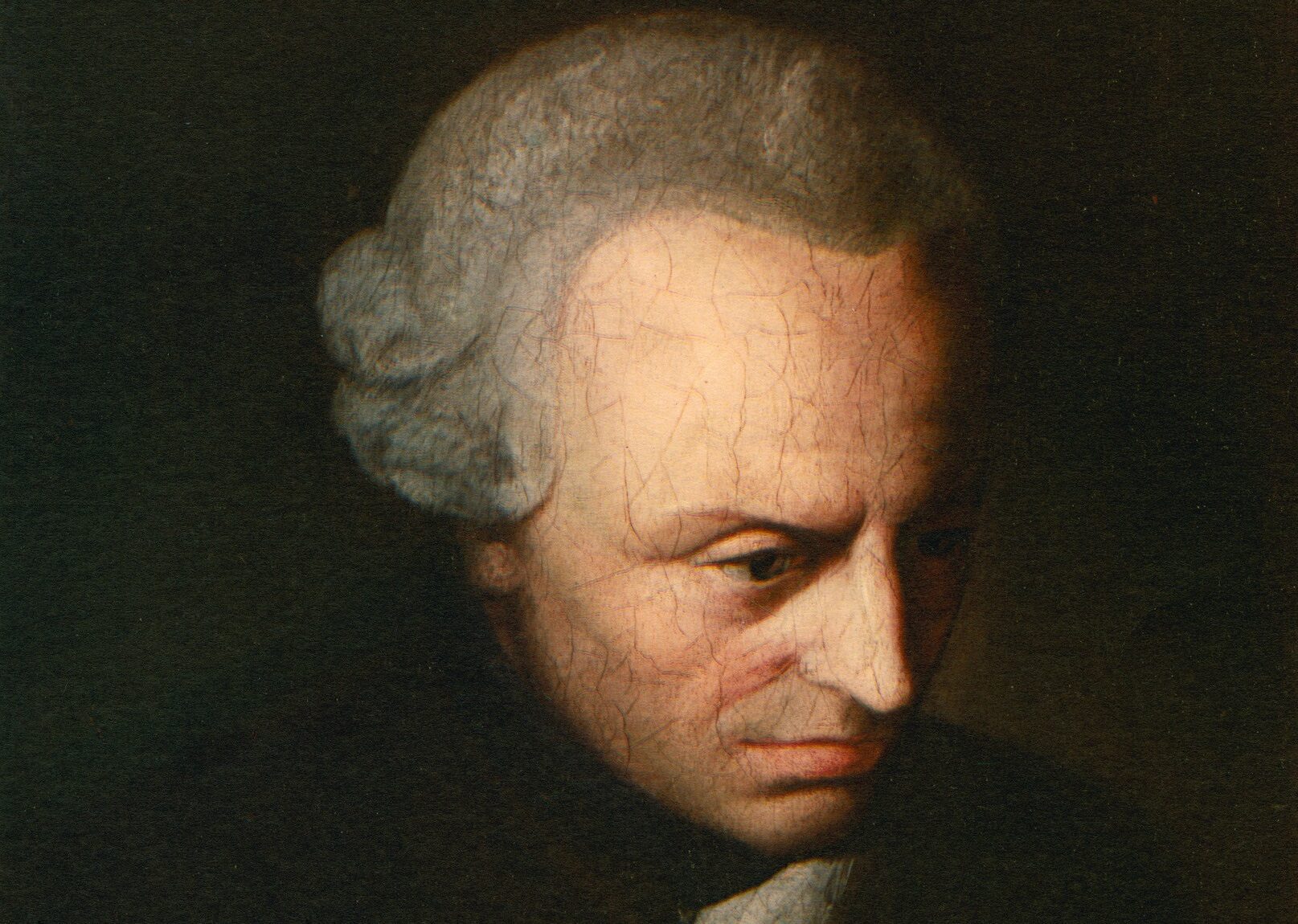
Kant und der Rationalismus
Von Sebastian Bender (Universität Göttingen) –
Wie ist Immanuel Kants sogenannte ‚kritische‘ Philosophie in die Philosophiegeschichte einzuordnen? Eine verbreitete Antwort auf diese Frage, der man gerade im ‚Kant-Jahr‘ häufiger begegnet, lautet in etwa wie folgt: Kant ist so etwas wie der „Vereiniger“ oder „Überwinder“ zweier philosophischer Strömungen – des Rationalismus und des Empirismus. Ursprünglich, sozusagen von Haus aus, war Kant ein Rationalist in der Tradition von Leibniz und Wolff. Unter anderem die Begegnungen mit Newtons Physik und Humes Überlegungen zu Kausalität stürzten Kant dann aber in eine philosophische Krise und führten letztlich zu einer vollständigen Abkehr vom rationalistischen Programm. Der ‚kritische‘ Kant – also der Kant ab 1781 (dem Erscheinungsjahr der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft) – verwirft die rationalistische ‚Leibniz-Wolffsche Schulmetaphysik‘ als ‚unkritisch‘ und ‚dogmatisch‘. Die Kritik der reinen Vernunft stellt demnach nicht zuletzt so etwas wie eine Generalabrechnung mit der (Leibniz’schen) rationalistischen Metaphysik dar. Verortet man Kant auf diese Weise in der Philosophiegeschichte, so besteht ganz offenbar eine größtmögliche Distanz zwischen der kritischen Philosophie Kants auf der einen Seite und der rationalistischen Metaphysik des 17. und 18. Jahrhunderts auf der anderen Seite.
In Teilen der Kant-Forschung gab und gibt es eine gewisse Tendenz, dieses philosophie-historische Narrativ zumindest in den Grundzügen mehr oder weniger unhinterfragt zu akzeptieren (wenn auch häufig in leicht abgeschwächten, weniger zugespitzten Varianten). Oft wird dies mit der weitergehenden systematischen These verbunden, dass Kant mit seiner Diagnose der rationalistischen Metaphysik im Großen und Ganzen auch Recht hat und dass diese Form Metaphysik zu betreiben somit seit Kant tatsächlich als überwunden gelten kann. Sollte sich dies als zutreffend erweisen, dann wäre Kants kritische Wende einer der entscheidenden Brüche in der Geschichte der westlichen Philosophie.
Aber stimmt das wirklich alles so? Obwohl die skizzierte Art und Weise, Kant in der Philosophiegeschichte zu verorten, nach wie vor große Popularität genießt, ist in der jüngeren Kant-Forschung auch ein gegenläufiger Trend zu beobachten. So finden sich vermehrt Stimmen, denen zufolge Kants Verhältnis zum Rationalismus deutlich komplexer ist, als das Standardnarrativ nahelegt. Außerdem wird häufig darauf hingewiesen, dass der Übergang von der vorkritischen zur kritischen Periode Kants keineswegs einem in allen Hinsichten völlig klarem Bruch gleichkommt (siehe z. B. Jauernig 2008, 2019 und Watkins 2005).
Tatsächlich lässt sich das Standardnarrativ meiner Auffassung nach zumindest in dieser Form nicht halten. Dafür kann ich in diesem Beitrag natürlich nicht im Detail argumentieren. Stattdessen möchte ich zwei Ansatzpunkte für alternative Lesarten, die sich in der jüngeren Forschung finden, schlaglichtartig herausgreifen. Zuvor möchte ich aber kurz skizzieren, was eigentlich für das Standardnarrativ spricht.
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass sich Kant in der Kritik der reinen Vernunft nicht nur an einer Vielzahl von Stellen kritisch mit der rationalistischen Tradition auseinandersetzt, sondern dass auch das Gesamtprojekt einen Rationalismus-kritischen Impetus hat (nicht zuletzt der Titel des Werkes bringt dies zum Ausdruck). Am deutlichsten wird dies in der Dialektik, in der sich Kant kritisch mit der rationalen Psychologie, der rationalen Kosmologie und der rationalen Theologie auseinandersetzt. Auf keinem dieser Gebiete sind laut Kant synthetische Urteile a priori möglich (was für ihn gleichbedeutend damit ist, dass metaphysische Aussagen nicht möglich sind).
Die wohl ausführlichste, in jedem Fall aber die direkteste, Auseinandersetzung mit der Philosophie von Leibniz innerhalb der Kritik der reinen Vernunft findet sich aber im Anhang zum zweiten Buch der Transzendentalen Analytik, der Amphibolie der Reflexionsbegriffe (und insbesondere in der langen „Anmerkung“ zur Amphibolie der Reflexionsbegriffe). Es ist an dieser Stelle, an der Kant schreibt: „Leibniz intellektuierte die Erscheinungen, so wie Locke die Verstandesbegriffe […] sensifiziert“ (A271/B327). Weder Leibniz noch Locke, so der Vorwurf, erkennen an, dass es „zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis“ (A15/B29) gibt, nämlich Sinnlichkeit und Verstand. Im Amphibolie-Kapitel spielt Locke aber letztlich nur eine untergeordnete Rolle; vor allem Leibniz wird hier zur Zielscheibe der kantischen Kritik. Leibniz’ „Intellektualisierung der Erscheinungen“ führt laut Kant zu einer ganzer Reihe von Folgefehlern, etwa zur Akzeptanz des Prinzips der Identität des Ununterscheidbaren oder der Monadenlehre. Insbesondere macht Kant Leibniz aber den globalen Vorwurf, „ein intellektuelles System der Welt“ (A270/B326) zu errichten und „alle Dinge bloß durch Begriffe mit einander [zu vergleichen]“ (A270/B326). Dies habe auch dazu geführt, dass Leibniz die sinnlichen Anschauungsformen von Raum und Zeit „intellektuierte“ und diese als nichts anderes als verworrene begriffliche Vorstellungen ansah (A275/B331–A276/B332).
Angesichts der detaillierten Leibniz-Kritik, die Kant im Amphibolie-Kapitel ausführt, wirkt das oben skizzierte Standard-Narrativ zweifellos zunächst einmal attraktiv. Aus Kants Sicht begeht Leibniz – und mit ihm der gesamte Leibniz’sche Rationalismus – den sehr großen Fehler, nicht klar zwischen zwei grundverschiedenen Erkenntnisvermögen zu differenzieren, die wir laut Kant haben: Sinnlichkeit und Verstand. Das Unterlassen dieser Unterscheidung führt Leibniz letztlich auch zu der „unkritischen“ Annahme, dass wir eine begriffliche bzw. intellektuelle Erkenntnis von Dingen an sich erlangen können – und nicht bloß von Erscheinungen, wie Kant selbst annimmt.
Aber bedeutet all dies tatsächlich, dass Kant mit seiner kritischen Philosophie das rationalistische Erbe vollständig hinter sich lässt? Oder finden sich auch Gemeinsamkeiten zwischen Kants kritischer Philosophie auf der einen Seite und dem Leibniz’schen Rationalismus auf der andere Seite? Wie zahlreiche neuere Arbeiten aufzeigen, spricht vieles für letzteres. Zunächst einmal ist auffällig, dass die Leibniz-kritischen Töne in der Kritik der reinen Vernunft zwar unübersehbar sind, sich in Kants späteren kritischen Werken so aber nicht wiederholen. Nachdem etwa in der Kritik der praktischen Vernunft Spinoza – nicht mehr Leibniz – im Fokus von Kants kritischer Beschäftigung mit dem Rationalismus steht, geht er 1790 sogar so weit, die Kritik der reinen Vernunft als „die eigentliche Apologie für Leibniz“ (AA 8:250) zu bezeichnen; eine wahrlich überraschende Auskunft.
Nimmt man also die gesamte kritische Periode in den Blick, und nicht nur die Kritik der reinen Vernunft, wird schnell deutlich, dass Kants Verhältnis zum Leibniz’schen Rationalismus komplex ist und nicht ohne weiteres auf eine einfache Formel gebracht werden kann. Neben dieser recht allgemeinen Betrachtung möchte ich aber noch auf zwei weitere Punkte eingehen, auf die in der jüngeren Forschung hingewiesen wurde.
Erstens finden sich zahlreiche Stimmen, die darauf aufmerksam machen, dass sowohl Leibniz’ Verständnis von Sinnlichkeit und Verstand als auch seine Konzeption des Raumes möglicherweise gar nicht so weit von Kants Positionen entfernt sind, wie letzterer im Amphibolie-Kapitel suggeriert. Geht Leibniz tatsächlich davon aus, dass sinnliche Vorstellungen nichts als verworrene begriffliche Vorstellungen sind? ‚Intellektuiert‘ Leibniz wirklich die Anschauungsformen von Raum und Zeit und glaubt er, dass wir Dinge an sich mittels räumlicher Vorstellungen erkennen können? Sowohl in der Leibniz- als auch in der Kant-Forschung hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass Kant hier wohl übers Ziel hinausschießt. Leibniz macht an vielen Stellen deutlich, dass unser Vermögen der sinnlichen Wahrnehmung, das wir mit nicht-menschlichen Tieren teilen, gerade kein begriffliches Vermögen ist (siehe etwa Bender 2013, 2016). Um etwas begrifflich erfassen zu können, bedarf es der Reflexion; dazu sind nicht-menschliche Tiere aber gar nicht in der Lage. Leibniz trennt also recht klar zwischen sinnlicher und begrifflicher Repräsentation und reduziert nicht erstere auf letztere (siehe hierzu etwa Bolton 2021 und Jauernig 2021).
Kants Kritik an Leibniz’ Raum-Konzeption ist schwieriger einzuschätzen. Aber selbst wenn Kants Diagnose, dass Leibniz den Raum ‚intellektuierte‘ – dass er also räumliche Vorstellungen als verworrene begriffliche Vorstellungen versteht – zutrifft, bedeutet dies noch lange nicht, dass wir damit Leibniz zufolge Dinge an sich erkennen, wie Kant unterstellt. Den kantischen Dingen an sich entsprechen bei Leibniz die Monaden (das sieht auch Kant so), Monaden sind aber nicht im Raum (dies sagt Leibniz eindeutig etwa in einem Brief an Des Bosses; G 2.450-451). Wenn wir etwas als im Raum befindlich vorstellen, haben wir es Leibniz zufolge mit einem idealen, also geistabhängigen phänomenalen Bereich zu tun (siehe Jauernig 2008). Leibniz scheint also keineswegs davon auszugehen, dass wir Dinge an sich räumlich repräsentieren. Vielmehr scheint Leibniz’ Raumtheorie überraschend große Ähnlichkeiten mit der Theorie Kants aufzuweisen (siehe Jauernig 2008).
Zweitens ist zu beachten, dass die grundlegenden Unterschiede zwischen dem Leibniz’schen Rationalismus und der kritischen Philosophie Kants hauptsächlich erkenntnis- und kognitionstheoretische Fragen betreffen. Dies sollte aber nicht den Blick dafür verstellen, dass sich das metaphysische Bild Kants nicht unbedingt grundlegend vom Leibniz’schen Bild unterscheidet – darauf hat insbesondere Anja Jauernig in zahlreichen Arbeiten immer wieder hingewiesen (siehe etwa Jauernig 2008, 2019, 2021). Sowohl Leibniz als auch Kant gehen von einer Level-Ontologie aus, mit mindestens zwei Ebenen: Auf der ersten, grundlegenden Ebene sind (bei Kant) die Dinge an sich bzw. (bei Leibniz) die Monaden angesiedelt, auf der zweiten Ebene (bei Kant) die Erscheinungen bzw. (bei Leibniz) die Phänomene. Während die erste Ebene geistunabhängig ist, ist die zweite Ebene geistabhängig (für diesen Vorschlag, siehe Jauernig 2008, 2021). Und damit enden die Gemeinsamkeiten keineswegs. Sowohl Leibniz als auch Kant gehen nämlich außerdem davon aus, dass empirische Objekte bzw. physikalische Körper der zweiten Ebene zuzuordnen sind, dass die empirische Welt also in irgendeinem Sinne ideal ist. Außerdem gehen beide Philosophen davon aus, dass ein asymmetrisches Abhängigkeitsverhältnis zwischen den beiden Ebenen besteht und dass die Freiheit im noumenalen Bereich der Dinge an sich angesiedelt ist.
Natürlich unterscheiden sich Kants metaphysische Vorstellungen auch in vielen Hinsichten ganz erheblich von den Annahmen des Leibniz’schen Rationalismus. So sind z. B. die Entitäten auf der zweiten Ebene für Kant in einem anderen Sinne ideal als für Leibniz. Außerdem hat Kant ein völlig anderes Freiheitsverständnis als (fast) die gesamte rationalistische Tradition: Während der kritische Kant ein libertäres Verständnis menschlicher Freiheit hat, lehnen RationalistInnen eine solche Konzeption praktisch durchgehend ab (siehe Bender 2024). Diese Unterschiede sollten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kants Metaphysik der rationalistischen Metaphysik in vielen Hinsichten ähnelt, worüber auch die klare Abgrenzung gegenüber dem Leibniz’schen Rationalismus, die Kant in erkenntnis- und kognitionstheoretischen Fragen zweifellos vornimmt, nicht hinwegtäuschen sollte.
Sebastian Bender ist Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie an der Georg-August-Universität Göttingen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Philosophie der Neuzeit (17. und 18. Jahrhundert), insbesondere Metaphysik, Erkenntnistheorie, Philosophie des Geistes und politische Philosophie der Neuzeit.
Literatur
Bender, Sebastian (2024). „Kant on Abilities, Human Freedom, and Complete Determination.“ In: Powers and Abilities in Early Modern Philosophy. Hrsg von S. Bender & D. Perler. New York: Routledge, 343–363.
Bender, Sebastian (2016). „Reflection and Rationality in Leibniz.“ In: Subjectivity, Selfhood and Agency in the Arabic and Latin Traditions. Hrsg. von J. Kaukua & T. Ekenberg. Dordrecht: Springer, 263–275.
Bender, Sebastian (2013). „Von Menschen und Tieren—Leibniz über Apperzeption, Reflexion und conscientia.“ Zeitschrift für Philosophische Forschung 67.2: 214–241.
Bolton, Martha (2021). „Kant’s Amphiboly as Critique of Leibniz.“ Leibniz and Kant. Hrsg. von B. Look, New York: Oxford University Press, 211–232.
Jauernig, Anja (2021). The World According to Kant — Appearances and Things in Themselves in Critical Idealism. Oxford & New York: Oxford University Press.
Jauernig, Anja (2019). „Finite minds and their representations in Leibniz and Kant.“ In: Internationales Jahrbuch des Deutschen Idealismus. Hrsg. von S. Sedgwick and D. Emundts, 47–80.
Jauernig, Anja (2008). „Kant’s Critique of the Leibnizian Philosophy: Contra the Leibnizians, but Pro Leibniz.“ In: Kant and the Early Moderns. Hrsg. von D. Garber & B. Longueness. Princeton: Princeton University Press, 41–63.
Watkins, Eric (2005). Kant and the Metaphysics of Causality. Cambridge: Cambridge University Press.