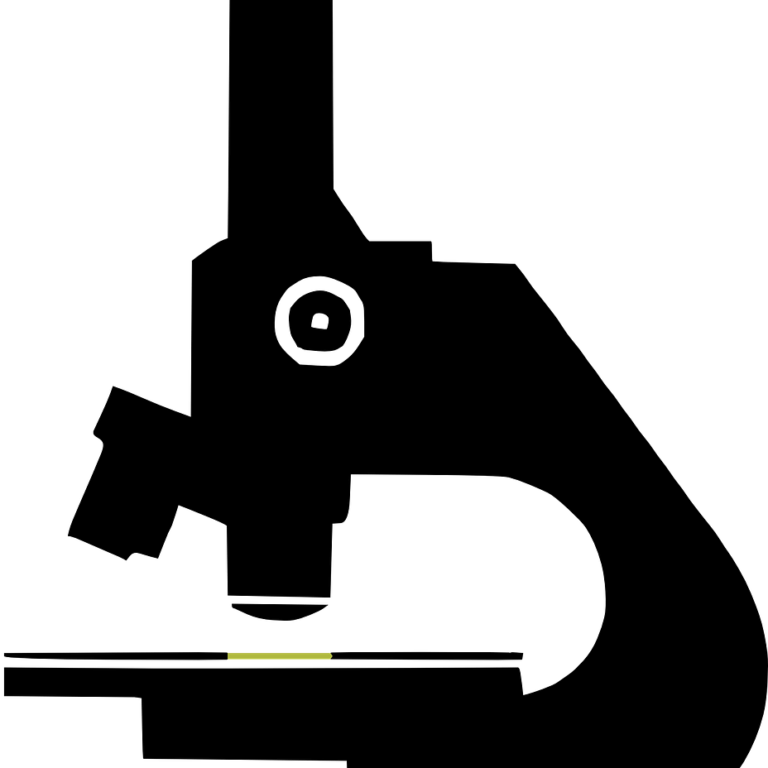Zu den Erfolgsbedingungen von Rechtfertigungen
Podcast: Play in new window | Download
Von Luise Müller (Dresden)
Dieser Blogbeitrag kann auch als Podcast gehört und heruntergeladen werden
Im Zuge der immer stärker werdenden Erwartung, Drittmittelprojekte einzuwerben, werden nun auch die Philosoph:innen bei den entsprechenden Forschungsanträgen mit einer Frage konfrontiert, die bislang in der praktischen Philosophie wenig reflektiert wurde: nämlich die nach den Forschungsmethoden. Dass diese Frage nun häufiger aufritt, mag sicher an der kontingenten Praxis liegen, zunehmend Forschungsförderungsformate aus den Naturwissenschaften auch in den Geisteswissenschaften einzusetzen. Nichtsdestotrotz können wir das als Anlass nehmen, zu reflektieren, was wir methodisch eigentlich machen, wenn wir praktische Philosophie betreiben.
Bei ‚Methoden‘ denken empirische Natur- und Sozialwissenschaftler:innen an Dinge wie Experimente, Statistik und teilnehmende Beobachtung. Die praktische Philosophie hat aber eben wenig Verwendung für Bayes‘sche Inferenzen oder Fragebögen. „Wir überzeugen durch Argumente und Gründe!“ möchte man in diese Anträge schreiben, wenn nach der wissenschaftlichen Methode gefragt wird. Was prinzipiell auch stimmt – die akademische praktische Philosophie ist eine intersubjektive diskursive Praxis, ihre Währung sind Gründe. Allerdings sollten wir ein wenig genauer beschreiben können, um welche Art von Gründen es uns eigentlich geht.
Ein Modus, in dem diese diskursive Praxis stattfindet, ist die Rechtfertigung: eine Handlung, Praxis, Ideal oder Institution werden gegenüber anderen gerechtfertigt. Natürlich ist Rechtfertigung selbst auch ein Thema der praktischen Philosophie, etwa in der Debatte über öffentliche Rechtfertigung im demokratischen Rechtsstaat. Aber davon will ich hier einmal absehen; in diesem Beitrag soll es um Rechtfertigung als eine mögliche Methode der Praktischen Philosophie gehen.
Also: was macht man eigentlich, wenn man eine Handlung, ein Prinzip, eine Praxis, ein Ideal oder eine Institution rechtfertigt? Anders gefragt: unter welchen Bedingungen ist eine solche Rechtfertigung erfolgreich? Man kann hier zwischen zwei Zielen von Rechtfertigung unterscheiden: erstens könnte das Ziel sein, zu zeigen, dass eine Handlung, Praxis oder Institution schlechthin geboten ist. Dieser Typus von Rechtfertigung zielt auf die Optimalität der gegebenen Handlung, Praxis oder Institution, indem sie zeigt, dass sie ein höheres moralisches Ziel oder Prinzip (unter den gegebenen Umständen) optimal verwirklicht.
Zweitens könnte dagegen auch das Ziel sein, zu zeigen, dass eine Handlung, Praxis oder Institution moralisch zulässig ist. Anstatt auf Optimalität zu zielen, erfordert dieser Typus von Rechtfertigung lediglich, zu zeigen, dass etwas erlaubt ist, also moralisch nicht verboten. Hier geht es nicht darum, dass eine Handlung, Praxis oder Institution das moralisch Beste verwirklicht, sondern, dass es nicht gegen eine wichtige moralische Regel oder ein wichtiges moralisches Prinzip verstößt.
Rechtfertigungen können also an unterschiedliche Erfolgsbedingungen geknüpft werden: sie können entweder darauf abzielen, dass etwas zulässig ist oder darauf, dass etwas geboten ist. A. John Simmons nennt diese beiden Arten der Rechtfertigung Permissibilitätsrechtfertigung und Optimalitätsrechtfertigung[i]
Welche Erfolgsbedingung für eine Rechtfertigung sinnvoll ist, hängt von der Art der Fragestellung ab. Die Frage: Darf man Tiere essen? verlangt nach einer Rechtfertigung, die nach der Zulässigkeit fragt, genau so die Frage: Ist Strafen gerechtfertigt? Die Frage: Was ist gerecht?, oder: Was schulden wir zukünftigen Generationen? hingegen deutet auf eine Rechtfertigung hin, die auf die Gebotenheit abzielt.
Wenn wir wissen, was die Erfolgsbedingung einer Rechtfertigung ist, dann können wir die verschiedenen Arten von Gründen, die dafür oder dagegen sprechen, besser einordnen. Das führt uns zu einer weiteren Unterscheidung, und zwar der Unterscheidung zwischen komparativen und nicht-komparativen Einwänden. Komparative Einwände zielen darauf ab, dass etwas anderes – also eine andere Handlung, Praxis oder Institution – vorzuziehen ist. Hier könne dann auch nicht-moralische Gründe ins Spiel kommen, beispielsweise solche der Effizienz. Diese Art von Einwand scheint besonders relevant, wenn es um Optimalitätsrechtfertigungen geht: die optimalen Gerechtigkeitsprinzipien sind vielleicht nicht nur fairer als andere Alternativen, sondern auch gesellschaftlich leichter durchzusetzen. Die optimale wirtschaftliche Institution verteilt bestimmte Güter vielleicht nicht nur moralisch optimal, sondern auch effizienter als die Alternativen.
Nicht-komparative Einwände zielen darauf ab, zu zeigen, dass die vorgebrachte Rechtfertigung moralisch falsch ist. Diese Art von Einwänden bezieht sich typischerweise auf Permissibilitätsrechtfertigungen: wenn zum Beispiel gefragt wird, ob Strafen gerechtfertigt ist, dann beziehen sich Einwände meist darauf, dass Strafen als Praxis auf unzulässige Weise in moralisch erhebliche Interessen eingreift. Das gilt ganz ähnlich für die Frage danach, ob man Tiere essen darf: Der Haupteinwand gegen die Praxis des Tier-Essens ist, dass sie wichtige Interessen von Tieren verletzt, nämlich das Interesse, nicht getötet oder gequält zu werden.
Beide Rechtfertigungstypen können übrigens in Verbindung auftreten. Vor allem scheinen Optimalitätsrechtfertigungen in den allermeisten Fällen schon Zulässigkeit vorauszusetzen, denn wenn etwas ein höheres moralisches Ziel oder Prinzip optimal verwirklicht, dann muss es sowieso moralisch erlaubt sein. Andersherum impliziert Permissibilität nicht notwendigerweise Optimalität: dass eine Handlung, Praxis oder Institution moralisch erlaubt ist, zeigt noch lange nicht, dass sie auch optimal ist. Vor allem bei Rechtfertigungen von Handlungen, Praktiken oder Institutionen, bei denen notwendiges empirisches Wissen fehlt oder nur dürftig vorhanden ist, können wir oft lediglich auf Permissibilität hoffen.
Auch etwas komplexere Rechtfertigungen werden oft sowohl Elemente von Optimalität als auch Elemente von Permissibilität beinhalten: eine Studie über humanitäre Interventionen wird zunächst zeigen müssen, dass Menschenrechtsschutz geboten ist (Optimalität) und dann fragen müssen, ob humanitäre Interventionen ein zulässiges Mittel sind, Menschenrechte zu schützen (Permissibilität). Dabei wird sie komparative und nicht-komparative Einwände diskutieren müssen, zum Beispiel dass humanitäre Interventionen moralisch falsch sind weil sie immer Übel verursachen (nicht-komparativer Einwand), oder dass humanitäre Interventionen ein vergleichsweise ineffizientes Mittel sind, Menschenrechte zu schützen, weil sie immer Zerstörung und Konflikte im intervenierten Staat mit sich bringen – und dass andere Mittel des Menschenrechtsschutzes (z.B. Asyl) adäquater sind (komparativer Einwand).
Trotz der praktischen Verflechtung dieser verschiedenen Rechtfertigungs- und Einwandtypen ist es hilfreich, diese Elemente zunächst analytisch auseinanderzuhalten, um sie dann später wieder aufeinander zu beziehen. Und vielleicht sind die hier gemachten Unterscheidungen tatsächlich auch auf ganz pragmatische Weise erhellend, wenn wir mal wieder vor einem Antrag sitzen und uns den Kopf darüber zerbrechen, was wir in die Rubrik „Forschungsmethoden“ schreiben wollen.
Luise Müller ist Postdoc an der Professur für Rechts- und Verfassungstheorie mit interdisziplinären Bezügen an der TU Dresden.
[i] A. John Simmons (1994): Original-Acquistion Justifications of Private Property, in: Social Philosophy & Policy, Vol. 11, No. 2, 63-84.