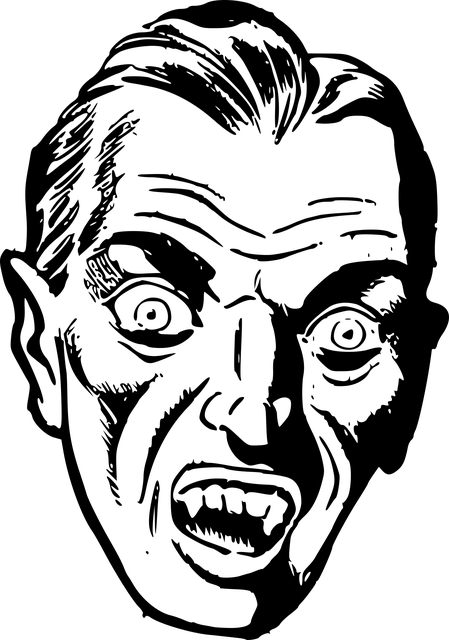Die Philosophie von Severance
Von Rebecca Bachmann (Kassel)
„Who are you“ – das ist nicht nur eine Grundsatzfrage der Philosophie, sondern auch der erste Satz der 2022 erschienenen Serie Severance. Die Serie gleicht in ihrer Prämisse einem philosophischen Gedankenexperiment: Stell dir vor, es gibt einen Chip, der es dir ermöglicht, dein Selbst in zwei Teile zu spalten: Ein privates und ein Jobselbst. Ihr teilt euch zwar einen Körper, dein Jobselbst ist aber nur für die Arbeit zuständig, dein privates Selbst für den Rest, beide wissen nichts vom Alltag des anderen – die perfekte Work-Life-Balance!
Bereits die Prämisse von der Spaltung in Selbste wirft die Frage nach der Identität einer Person auf und versetzt die Serie in die Nähe der philosophischen Debatte um personale Identität. In dieser Debatte geht es vor allem um die Frage nach diachroner Identität – die Identität einer Person über die Zeit hinweg: Was macht mich als 30jährige Doktorandin zur gleichen Person, die ich als Studentin oder als Schülerin war?
Traditionell werden diese Fragen in Form von teils absurd wirkenden Gedankenexperimenten verhandelt. Es werden Situationen erschaffen, in denen als relevant erachtete Faktoren von Identität isoliert werden – in der Regel wird der Körper gegen psychologische Eigenschaften ausgespielt. So bittet Shoemaker darum, uns vorzustellen, dass zwei Personen am Gehirn operiert werden: Brown und Robinson. Aufgrund eines Fehlers wird jedoch das Gehirn von Brown in den Schädel von Robinson zurückgelegt und andersherum. Während die eine Person stirbt, überlebt der Körper von Robinson mit dem Gehirn von Brown. Die überlebende Person erinnert sich an Browns Vergangenheit, erkennt seine Familie, aber nicht sich selbst im Spiegel. Wer ist nun diese überlebende Person: Brown oder Robinson?[1]
Viele teilen bei Szenarien wie diesen die gleiche Intuition: Die Person, die überlebt, ist Brown. Daraus wird abgeleitet, dass nicht der Körper der Marker von personaler Identität ist, sondern die psychologische Kontinuität, dabei vor allem die Erinnerungen.
Andere Philosoph*innen widersprechen: Ihrer These nach bleibt der Körper der Marker von Identität. Auch hierfür werden Gedankenexperimente angeführt: So bittet Thomson, sich vorzustellen, man würde LSD nehmen und daraufhin denken, man wäre Queen Victoria mit all ihren Erinnerungen. Denken wir wirklich, so Thomson, dass diese Person Queen Victoria sei – auferstanden von den Toten?[2] Lautet die Intuition hier „nein“, dann können Erinnerungen nicht der Marker sein, sondern wiederum der Körper.
Damit befinden wir uns in einer Patt-Situation. Einige Philosoph*innen führen das auf die inflationäre Nutzung von wirklichkeitsfernen Gedankenexperimenten zurück.[3] Wenn Lesende mit Szenarien von ungewolltem Gehirntausch und erinnerungsverändernden Drogen konfrontiert werden, so wissen sie oft nicht, wie sie darauf reagieren sollen, denn diese Szenarien sind zu sehr von der Lebenswirklichkeit entfernt als dass sie verlässliche Intuitionen generieren können. Zusätzlich kann kritisiert werden, dass diese Szenarien zu wenig Details über den Kontext bereitstellen, was eine adäquate Beurteilung erschwert. Genau an diesem letzten Punkt eröffnet sich das Potential einer Serie, die über neun Folgen eine elaborierte und filmisch inszenierte Narration entwirft und dadurch die Möglichkeit eröffnet, klarere Intuitionen zu generieren.
Wie am Anfang des Artikels erwähnt, gleicht die Prämisse der Serie einem Gedankenexperiment. Hier sollte akkurater davon gesprochen werden, dass sie dem Szenario eines Gedankenexperiments gleicht. Denn nach Bertram bestehen Gedankenexperimente zumeist aus drei Bestandteilen: (philosophische) Fragestellung, prägnant entfaltetes Szenario und Auswertung des Szenarios mit Bearbeitung der Frage.[4] Dieser Definition nach scheint eine Serie kein Gedankenexperiment zu sein. Meine These wäre aber: Sie kann zu einem gemacht werden.
Zunächst soll mehr zum Szenario gesagt werden: Die Serie präsentiert uns eine Abteilung der Firma Lumon, bei der unklar bleibt, in welchem Sektor diese operiert. Da die Abteilung eine bestimmte Sicherheitsstufe hat, haben sich alle Arbeitenden der Prozedur Severance unterzogen, bei der die Erinnerungen so getrennt werden, dass das in der Abteilung arbeitende Jobselbst keinerlei Erinnerung an das private Selbst hat und umgekehrt keine Gefahr besteht, dass die Arbeitenden in ihrem privaten Leben über ihre Arbeit sprechen. Sprachlich wird hier „Innie“ von „Outie“ unterschieden, ersteres ist dabei das Jobselbst, letzteres das private.
Die erste Folge startet mit der Initiation des neu entstanden Innies Helly. Man sieht sie in einem Konferenzraum erwachen, woraufhin ihr fünf Fragen gestellt werden:
1) Wer bist du? Als Antwort reicht der Vorname.
2) In welchem Bundesstaat bist du geboren?
3) Kannst du einen beliebigen Bundesstaat nennen?
4) Wie lautet Mr. Eagans Lieblingsfrühstück?
5) Welche Augenfarbe hat deine Mutter?
Helly kann nur die dritte Frage beantworten, was ihr einen perfekten Score verschafft. Die Tatsache, dass sie keine der anderen Fragen beantworten kann, zeigt ihren Vorgesetzten, dass die Prozedur erfolgreich war. Als Innie hat sie zwar Weltwissen über die Staaten der USA, kennt aber weder ihren Vornamen noch ihre eigene Biografie – kurz: Sie hat keinerlei autobiografische Erinnerungen.
Über die erste Staffel hinweg sehen die Zuschauenden, was Innie und Outie unterscheidet. So wird Mark, der direkte Vorgesetzte von Helly, sowohl als Innie als auch als Outie gezeigt. Man bekommt mit, dass Mark vor zwei Jahren seine Frau verloren und sich daraufhin entschlossen hat, sich der Prozedur zu unterziehen – mit dem Hintergedanken, zumindest acht Stunden am Tag nicht an sie denken zu müssen. Diese Diskrepanz im Gefühlszustand bekommt man bereits in der Mimik und Gestik mit. Outie-Mark ist offensichtlich vom Tod seiner Frau gezeichnet, sein Auftreten ist von Traurigkeit geprägt, seine Schultern und Mundwinkel hängen herunter, er hat offenkundig ein Alkoholproblem und auf dem Parkplatz vor der Firma weint er. Sobald er in den Fahrstuhl steigt und bei seiner Abteilung ankommt, merken die Zuschauenden sofort, wann der Innie aktiviert wird: Er entspannt sich sichtlich, Schultern und Mundwinkel lösen sich. Sein Auftreten ist aufrecht, er lächelt sogar.
Innie und Outie teilen sich den Körper, haben aber keine gemeinsamen autobiografischen oder anekdotischen Erinnerungen. Mark trifft als Innie mehrere Personen, die sein Outie bereits kennt, erkennt diese jedoch nicht. Sein Outie hat keinerlei Wissen über die Tätigkeiten seines Innies, über seine Kolleg*innen oder über die simple Frage, ob er dort zufrieden ist.
Ein philosophisch anregendes Szenario wäre damit vorhanden, es ließe sich sogar – wie oben versucht – im prägnant-kurzen Stil eines Gedankenexperiments formulieren. Nun handelt es sich natürlich um eine Serie, kein Gedankenexperiment eingebettet in einer wissenschaftlichen Argumentation. Es gibt weder eine explizite Frage, die über der Narration schwebt, noch eine Auswertung, die am Ende präsentiert wird.
Aber nichtsdestotrotz werden in der Serie mindestens implizit, teilweise sogar explizit Fragen von den Charakteren hinsichtlich ihrer Identität gestellt. So wird Outie-Mark nach seinem „anderen“ Selbst gefragt, wird damit aufgefordert, sich zur Frage zu positionieren, ob es sich bei beiden Selbsten um die gleiche Person handelt. Kennt man sich nun mit der Debatte um personale Identität aus, so lässt sich von diesem Gespräch direkt die Frage nach dem Marker von Identität ableiten.[5]
Eine Auswertung dieser Frage gibt die Serie nicht explizit, sie obliegt zum einen den Zuschauenden, zum anderen den Figuren, die auf ihren Identitätsstatus reagieren. Während Mark auf die Frage antwortet „There is no other one […] it’s me!“ (Ep.1), spürt Helly eine klare Trennung ihrer Selbste, was sicherlich damit zusammenhängt, dass sie konträre Intentionen verfolgen. Innie-Helly fühlt sich in ihrem Job gefangen und will auf der Stelle kündigen, was sie ihrem Outie wiederholt mitteilt. Diese lässt sie jedoch nicht kündigen und reagiert stattdessen mit einer Videobotschaft: „Helly, I watched your video asking that I resign. […] I understand that you’re unhappy with the life that you’re given. [..] I am a person. You are not. I make the decisions. You do not.” (Ep.4) Beide gehen also von einem getrennten Selbst aus, Outie-Helly gewährt ihrem Innie nicht einmal den Personenstatus. Beide trennen folglich nicht nur Erinnerungen, sondern auch Intentionen und – wie es scheint – Charakterzüge.
Letztlich bleibt es den Zuschauenden überlassen, welche Haltung sie in Bezug auf den Identitätsstatus der Figuren einnehmen. Das ist aber auch bei Gedankenexperimenten so. In der Regel wird das Szenario dort zwar von Philosoph*innen ausgewertet, die Lesenden können aber zu ganz anderen Schlüssen kommen – trotz der vorgegebenen Interpretation im Text.
Meiner Lesart nach nimmt auch die Serie eine bestimmte Interpretationsrichtung ein: Der größte Unterschied zwischen Innie und Outie, der uns präsentiert wird, scheint die komplett getrennte Lebenswirklichkeit zu sein. Konsistent damit legt uns die Serie einen narrativen Ansatz personaler Identität nahe. Marker von Identität wäre damit das Narrativ des eigenen Lebens. Danach spielen die Geschichten, die wir über uns und unser Leben erzählen, unsere Autobiografie, eine relevante Rolle in unserer Identität. Und das nicht nur in Bezug auf die Frage, was uns als Person ausmacht, sondern auch bei unserer Identität über die Zeit hinweg.[6]
Was das Leben der Innies so isoliert erscheinen lässt, ist der Fakt, dass sie keine Geschichte haben, nicht wissen, ob sie Familien haben, ja sich nicht einmal an ihren Vornamen erinnern. Passend dazu sagt Innie-Irving, ein Kollege von Mark und Helly: „It is an unnatural state for a person to have no history. History makes us someone. Gives us a context. A shape.” (Ep.3).
In einer Szene spielen alle Kolleg*innen ein Kennenlernspiel. Es wird ein Ball hin und her gerollt, wer den Ball hat, nennt einen Fakt über sich. Während Irving erzählt, dass er alle Prinzipien der Firma mag, haben Mark und Helly klarerweise Probleme, überhaupt etwas zu sagen – was sollten sie auch erzählen? Das Einzige, das ihnen über ihren Outie gesagt wird, ist der Vorname. Darüber hinaus bekommen sie nur in sogenannten Wellness-Sitzungen, die gestressten Innies helfen sollen, sich zu entspannen, Informationen über ihren Outie. Diese Fakten sind jedoch so trivial und zufällig – „Your Outie can set up a tent in under three minutes“ (Ep.8) – dass sie kaum zur Konstituierung einer gemeinsamen Identität beitragen.
Serien sind keine Gedankenexperimente, aber sie können zu solchen gemacht werden. Der Plot von Severance lässt sich in ein prägnant formuliertes Szenario überführen und mit einer philosophisch relevanten Fragestellung einrahmen. Die Serie präsentiert verschiedene Auswertungen in Form von Einstellungen der Figuren zu ihrem Identitätsstatus, überlässt die Auswertung aber schlussendlich ihren Zuschauenden.
Der Vorteil einer Serie gegenüber einem klassischen Gedankenexperiment ist, dass die ausgedehnte Narration und die filmische Visualisierung zur Plausibilität beitragen können. Während Lesende von Gedankenexperimenten einfach akzeptieren müssen, dass Chirurg*innen aus Versehen Gehirne vertauschen, nimmt sich Severance viel Raum, um die Trennung in Selbste darzustellen und die konkreten Auswirkungen aufzuzeigen. Es ist nicht mehr nur eine Person mit Browns Gehirn und Robinsons Körper, die einfach sagt, sie habe die Erinnerungen von Brown und erkennt Robinsons Körper nicht. Es ist Innie-Mark, der sich nicht an die Frau seines Outies erinnert oder Innie-Helly, die gegen Outie-Helly rebelliert.
Rebecca Bachmann ist Doktorandin und Lehrbeauftragte am Institut für Philosophie der Universität
Kassel. Aktuell beschäftigt sie sich in ihrer Doktorarbeit mit dem Diskurs um philosophische
Gedankenexperimente mit besonderem Fokus auf das Geiger-Gedankenexperiment aus der
Abtreibungsdebatte. Sie ist außerdem Co-Host des Wissenschaftspodcasts „Analytischer Kaffeeplausch“.
[1] Vgl. Shoemaker, Sydney: Self-Knowledge and Self-Identity. Ithaca: Cornell University Press 1963. S. 23-24.
[2] Vgl. Thomson, Judith J.: People and their Bodies. In: Contemporary Debates in Metaphysics. Hrsg. von Theodore Sider, John Hawthorne & Dean W. Zimmerman. Malden u.a.: Wiley-Blackwell 2008. S. 163.
[3] Vgl. Weber, Marc Andree: Die Aussagekraft wirklichkeitsferner Gedankenexperimente für Theorien personaler Identität. In: Mensch sein – Fundament, Imperativ oder Floskel? Beiträge zum 10. Internationalen Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie in Innsbruck. Hrsg. von Andreas Oberprantacher & Anne Siegetsleitner. Innsbruck: Innsbruck University Press 2017. S. 493-503.
[4] Vgl. Philosophische Gedankenexperimente. Ein Lese- und Studienbuch. Hrsg. von Georg W. Bertram. Stuttgart: Reclam 2012. S. 17.
[5] Man kann argumentieren, dass es hier eigentlich um synchrone, nicht diachrone Identität geht, also um die Frage, ob zwei Personen zur gleichen Zeit einen Körper bewohnen. Mir erscheint die Serie vor allem in Bezug auf die Frage nach dem Marker von Identität von Bedeutung zu sein – und damit sowohl für synchrone als auch für diachrone Identität.
[6] Vgl. Olson, Eric T. & and Witt, Karsten: Narrative and persistence. In: Canadian Journal of Philosophy 49 (3) 2019. S. 420.