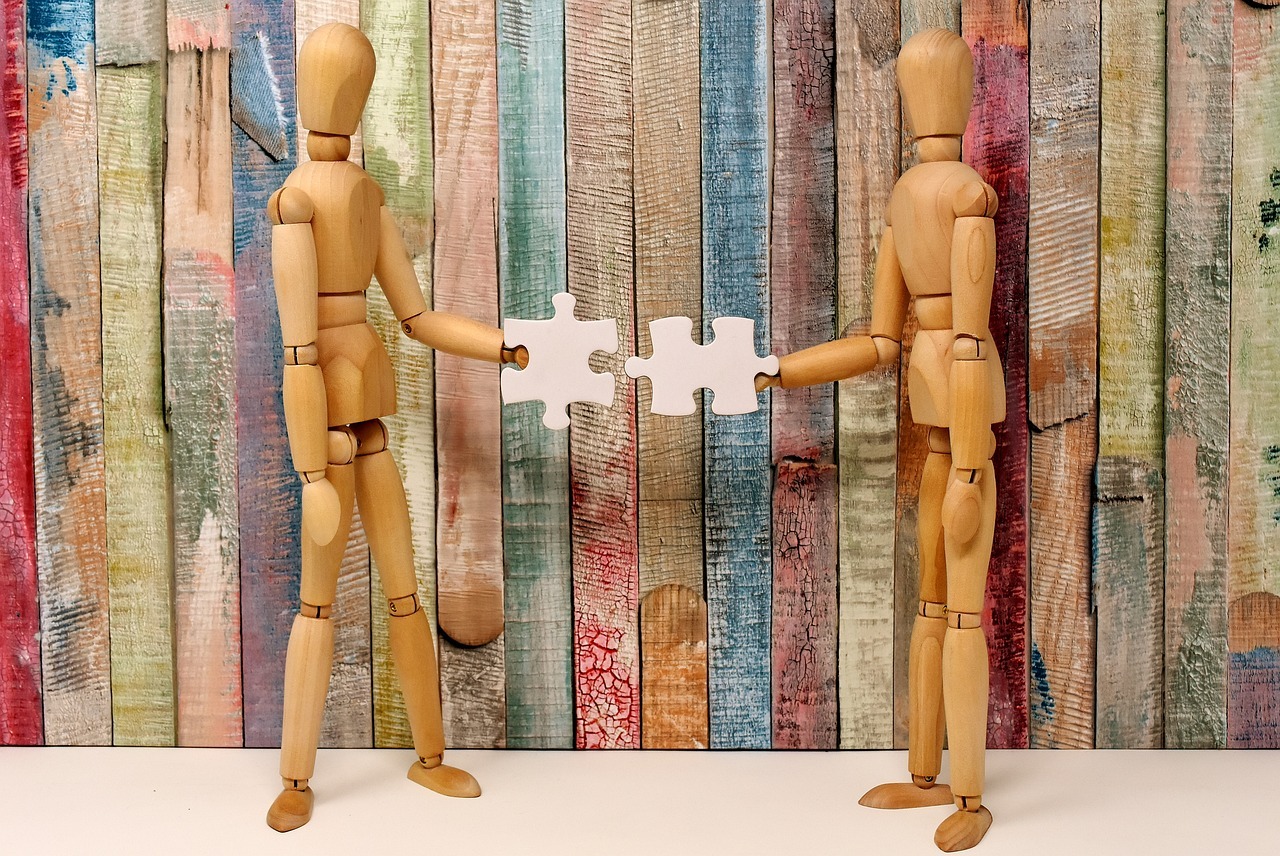
Die Beziehung zwischen Medizinethik und Philosophie: Selbstverständlich oder kompliziert?
Von Anna Hirsch (München) –
Als Philosoph*in an die medizinische Fakultät? „Warum nicht?“ muss heute die Antwort lauten. Philosoph*innen forschen und lehren immer häufiger an Instituten für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (GTE), haben vereinzelt sogar Professuren inne. Dass eine „Parallelwelt“ neben Lehrstühlen der praktischen Philosophie oder angewandten Ethik existiert, in der ebenfalls Bio- und Medizinethik betrieben wird, war mir hingegen während meines kompletten Philosophiestudiums nicht bewusst. Auch Marcel Mertz berichtet in einem Blogbeitrag von seinem ersten Eindruck als Philosoph an einem GTE-Institut. Ihm sei anfangs nicht klar gewesen, ob „das überhaupt Ethik [sei], was hier betrieben wird.“
Im Editorial der Zeitschrift Ethik in der Medizin warf Thomas Schramme (2016) die Frage auf, welche Rolle die Philosophie in der Medizinethik habe. Mit dem Aufkommen neuer medizinischer Technologien im 20. Jh. sei die Hoffnung einhergegangen, die Philosophie könne sich aus ihrer metaphysischen Enge befreien und durch ein neues, reales Betätigungsfeld einen Beitrag zu gesellschaftlichen Debatten leisten. Doch diese Hoffnung sei nicht erfüllt worden. Statt klare Handlungsempfehlungen auszusprechen, verliere sich die Philosophie in Randdebatten und kleinteiligen Unterscheidungen.
Natürlich endet Schramme, selbst Philosoph, mit versöhnlichen Worten: Durch ihre begriffliche Genauigkeit, ihre methodologische Sensibilität und ihren Tiefgang leiste die Philosophie einen wichtigen Beitrag zur Medizinethik. Konfrontiert mit Schrammes Editorial, aber auch mit meinen eigenen Erfahrungen, stelle auch ich mir immer wieder die Frage, was meine Rolle als Philosophin in der Medizinethik ist, sein kann oder sein sollte. In diesem Blogbeitrag möchte ich daher folgende Fragen aufwerfen:
1) Was war die bisherige Rolle der Philosophie in der Medizinethik?
2) Welche Rolle kann die Philosophie in der Medizinethik übernehmen?
3) Mit welchen Grenzen und Herausforderungen sind Philosophinnen in der Medizinethik konfrontiert?
Keinesfalls möchte ich mir anmaßen, endgültige oder vollständige Antworten auf diese Fragen zu geben, jedoch hoffe ich, dazu anzuregen, über sie zu reflektieren und diskutieren.
1) Was war die bisherige Rolle der Philosophie in der Medizinethik?
Mit Blick auf die erste Frage könnte man einwenden, dass sie sich auf diese Weise nicht stellen lässt. So wird die Medizinethik von manchen als Teil der Philosophie, als eine Art angewandte Moralphilosophie, verstanden (Murray 1987; Baker/McCullough 2007).
Zweifellos hat die Philosophie wesentlich zur Etablierung der Medizinethik als einem eigenständigen Fach beigetragen. Jedoch würde es den anderen Disziplinen, die ebenfalls mitgewirkt haben und es nach wie vor tun (u.a. Medizin, Geschichte, Theologie), nicht gerecht werden, bezeichnete man die Medizinethik als einen Teilbereich der Philosophie. Die Beziehung zwischen Philosophie und Medizinethik ist komplizierter. Es würde den Rahmen des Beitrags sprengen, die Geschichte dieser Beziehung nachzuzeichnen. Ihre Quintessenz wird anhand einzelner Entwicklungen, die insbesondere im 20. Jh. stattgefunden haben, deutlich: Zum einen schuf die Philosophie wichtige konzeptionell-begriffliche Grundlagen für medizinethische Debatten, zum anderen prägte sie Handlungsnormen und ethische Prinzipien in der Medizin(ethik). Erstgenannte Rolle ist vor allem der „Philosophie der Medizin“ zuzuschreiben, die strenggenommen nicht als Teilbereich der Medizinethik gilt.
Die Philosophie der Medizin beschäftigt sich mit konzeptionellen, axiologischen, begrifflichen, metaphysischen und methodologischen Aspekten der Medizin (Schramme 2017), etwa mit der Natur zentraler Begriffe, allen voran mit „Krankheit“ und „Gesundheit“. Fraglos ist die Klärung zentraler Begriffe auch für normativ-medizinethische Debatten relevant. Um etwa verstehen zu können, was das medizinethische Prinzip des Wohltuns fordert, muss hinreichend klar sein, was mit Wohlergehen gemeint ist.
Auch wenn sich die Philosophie der Medizin und die Medizinethik hinsichtlich ihrer Themenauswahl überschneiden, liegt der Medizinethik gewöhnlich ein anderes Erkenntnisinteresse zugrunde: Ihr Hauptanliegen besteht nicht im Beitrag zum theoretischen Fortgang medizinethischer Debatten, sondern zur Verbesserung medizinischer Handlungspraxis (Salloch et al. 2016). Das hängt auch mit Wurzeln der Medizinethik in der ärztlichen Ethik (i.S. einer Professionsethik der Ärzteschaft) zusammen (Rhodes 2020). Im Fokus medizinethischer Debatten stehen meistens normative Fragestellungen, mit denen Akteur*innen in der Medizin konfrontiert sind. Auch an diesen Debatten beteiligten sich von Anfang an Philosoph*innen. Einige von ihnen sahen ihre Rolle vor allem darin, philosophische Theorien für den Umgang mit medizinethischen Problemstellungen fruchtbar zu machen.
Für die meisten großen Moraltheorien (Kantianismus, Utilitarismus etc.) konnte jedoch gezeigt werden, dass sie nicht ohne Weiteres auf ethische Fragen in der medizinischen Praxis angewandt werden und zu Lösungen beitragen können (Flynn 2022). Die größte Herausforderung bestand darin, einen normativen Rahmen für die Medizinethik zu schaffen, auf den sich alle einigen können, der der Vielfalt ethischer Problemstellungen in der Medizin gerecht wird und möglichst allgemein verständlich ist. Auch philosophisch ausgebildete Bio- und Medizinethiker*innen haben sich dieser Herausforderung angenommen. Manche von ihnen prägen den medizinethischen Diskurs bis heute, allen voran Tom L. Beauchamp und James F. Childress, aber auch Bernard Gert und Dan W. Brock. Von Anfang an beschränkte sich ihre Beteiligung am medizinethischen Diskurs nicht auf den akademischen Bereich, beispielsweise wirkte Beauchamp an der Erarbeitung des Belmont Report (1979) mit.
2) Welche Rolle kann die Philosophie in der Medizinethik übernehmen?
Auch wenn in der Medizinethik heute interdisziplinär zusammengearbeitet wird und die Philosophie nach wie vor an medizinethischen Debatten beteiligt ist, kritisieren manche Autorinnen den Mangel an „guter Philosophie“ in der Medizinethik (Savulescu 2015; Cholbi 2023). Julian Savulescu zufolge führt der Trend, bio- und medizinethische Diskussionen immer breiter und auch unter Beteiligung von Personen zu führen, die weder eine philosophische noch ethische Ausbildung genossen haben, zu einer falschen oder missverständlichen Verwendung zentraler Begriffe in Bio- und Medizinethik. Ihm zufolge können hieraus ethisch schlecht begründete Entscheidungen resultieren.
Auch wenn Savulescus Einschätzung provokant erscheinen mag, enthält sie einen wahren Kern. Durch neue bio- und medizinethische Themenfelder, etwa KI und Medizin, und die stärkere Verankerung der Medizinethik in der Ausbildung der Gesundheitsberufe, beteiligen sich mehr Menschen an bio- und medizinethischen Debatten. Sofern das zu ethisch gut begründetem Handeln in der Medizin führt, ist dies jedoch ein zu befürwortender Trend. Zugleich spricht diese Entwicklung dafür, dass sich die Philosophie ihrer Rolle (und möglicherweise auch Verantwortung) in der Medizinethik noch bewusster werden muss. Wo kann sie einen genuinen Beitrag leisten und dadurch vielleicht verhindern, dass es zu einer ungenauen oder missverständlichen Verwendung zentraler Begriffe kommt?
Betrachtet man ethische Probleme und Herausforderungen, die sich in der medizinischen Praxis stellen, etwa Fragen nach dem moralisch angemessenen Handeln in der Medizin, so zeigt sich, dass sich hinter einigen von ihnen tieferliegende philosophische Fragestellungen verbergen. Sie können begrifflich-konzeptioneller Art sein, also nach dem angemessenen Verständnis zentraler Begriffe fragen und damit den Bereich der Philosophie der Medizin berühren. Beispielsweise könnte eine Gesundheitsfachperson mit der Frage konfrontiert sein, wie sie ihren Wohltunspflichten gegenüber einer Patient*in auch dann nachkommen kann, wenn diese sämtliche Maßnahmen, die aus medizinisch-professioneller Sicht ihrem Wohlergehen zuträglich sind, ablehnt. Was heißt es, das Wohlergehen von Patient*innen zu fördern? Und wie ist die medizinische Sicht auf Wohlergehen gegenüber der subjektiven Sicht der Patient*in zu gewichten – insbesondere, wenn Zweifeln an der Autonomie der Patientin bestehen? Häufig bleibt es nicht bei der ethischen Fragestellung, die sich unmittelbar in der Praxis stellt. Philosophisch ausgebildete Medizinethiker*innen bringen Kompetenzen mit, die es ihnen ermöglichen, zur Beantwortung dieser tieferliegenden Fragen beizutragen. Dadurch können sie indirekt auch einen Beitrag zur Lösung ethisch-praktischer Fragestellungen leisten.
Anhand einer Auswahl philosophischer Beiträge in der Medizinethik habe ich analysiert, auf welche Kompetenzen Philosoph*innen in der Bearbeitung medizinethischer Probleme und Herausforderungen zurückgreifen (Hirsch 2024): Sie…
- identifizieren philosophisch-konzeptionelle und damit verbundene lebenspraktische Probleme,
- stellen mit dem ethischen Problem verbundene Begriffe und Theorien infrage,
- machen weiterführende, anspruchsvollere Ideen und Konzeptionen für praktische Herausforderungen anwendbar,
- problematisieren eigene oder fremde Theorien/Konzepte und entwickeln diese mit Blick auf die Problemstellung weiter,
- identifizieren konzeptionelle Lücken und schließen sie,
- konstruieren/nutzen und diskutieren (hypothetische/reale) Fallbeispiele, um Intuitionen oder die Plausibilität theoretischer Überlegungen zu testen,
- entwickeln begründete Lösungen, teils auch konkreter praktischer Art.
Mithilfe dieser Kompetenzen gelingt es den Autor*innen (Mackenzie 2008; Specker Sullivan und Niker 2018; Sjöstrand et al. 2013), einen wertvollen Beitrag zur medizinethischen Debatte um Patient*innenautonomie zu leisten. Beispielsweise spezifizieren sie, was es heißt, die Autonomie von Patient*innen zu respektieren, die zwar vordergründig autonom zu sein scheinen, jedoch in ihrer Autonomie durch unterdrückerische Normen und Beziehungen eingeschränkt sind. Dabei bleiben sie nicht bei begrifflich-konzeptionellen Klärungen stehen, sondern bieten auch praktische Umsetzungsvorschläge. Hieraus lassen sich wichtige Erkenntnisse für die Gestaltung der Ärzt*innen-Patient*innen-Interaktion ziehen. Auch in der klinischen Ethik oder der Medizinethik-Lehre kann das Potential der Philosophie (begrifflich-konzeptionelle Genauigkeit, Aufdecken konzeptioneller Lücken, Methoden- und Theorie-Wissen, u.a.) noch weiter ausgeschöpft werden. Das genauer auszuarbeiten, würde jedoch einen separaten Blogbeitrag erforderlich machen.
3) Mit welchen Grenzen und Herausforderungen sind Philosoph*innen in der Medizinethik konfrontiert?
Eine der größten Herausforderungen ist die Translation (Barøe 2014): Wie kann es gelingen, dass die Erkenntnisse medizinethischer Forschung in der medizinischen Praxis tatsächlich Niederschlag finden?
Dieser Frage nachzugehen, ist nicht nur Aufgabe von philosophisch ausgebildeten Medizinethiker*innen, sondern aller Akteur*innen, die sich an medizinethischen Debatten beteiligen und den Anspruch erheben, mit ihrer Forschung zur Lösung praktisch-ethischer Probleme in der Medizin beizutragen. Vielleicht erscheint es so, als müsse die Philosophie einen ‚Extraschritt‘ gehen, weil sie mit Begriffen und Theorien operiert, die teils schwer verständlich und abstrakt anmuten. Das ist jedoch kein Hindernis, wie einige Philosoph*innen beweisen, die ihre medizinethischen Forschungsergebnisse zugänglich und praxisnah ausgearbeitet haben (u.a. David Archard, Laurence B. McCullough, Rosamond Rhodes). Doch selbst wenn sich Philosoph*innen um Praxisnähe bemühen, sind ihnen in einigen Bereichen der Medizinethik Grenzen gesetzt. So erfordert die Beschäftigung mit medizinethischen Problemen häufig die Erfahrung und das Fachwissen medizinischer Forscher*innen und Praktiker*innen.
Eng damit verbunden ist eine weitere Grenze, die alle Medizinethiker*innen betrifft, die nicht gleichzeitig in der Gesundheitsversorgung oder Forschung tätig sind: Nicht sie selbst setzen die aus ihrer Forschung resultierenden Handlungsnormen um, sondern andere müssen es tun. Sie können nur indirekt dazu beitragen, indem sie sich etwa in der klinischen Ethik oder der Medizinethik-Lehre engagieren.
Nach zwei Jahren an einem GTE-Institut würde ich nicht mehr von einer „Parallelwelt“ sprechen, in der neben Lehrstühlen der praktischen Philosophie oder angewandten Ethik Medizinethik betrieben wird. Mir scheint es vielmehr, dass beide gemeinsam zum Fortgang der Medizinethik beitragen und vielleicht auch noch stärker zusammenarbeiten könnten. Interdisziplinarität liegt in der Natur bio- und medizinethischer Themen und Fragestellungen, auch wenn es dabei immer wieder Hürden zu überwinden gilt. Jedoch lohnt es sich, Anstrengungen zu ihrer Überwindung zu unternehmen, wenn hieraus am Ende ‚gute‘ Medizinethik resultiert, die begrifflich-konzeptionellen Ansprüchen gerecht wird und zu ethisch gut begründeten Entscheidungen und Handlungen in der Medizin beiträgt.
Anna Hirsch, Dr. phil., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der LMU München und klinische Ethikberaterin. In ihrer aktuellen Forschung und Lehre befasst sie sich mit ethischen Fragen der Patient*innenversorgung und pädiatrischer Ethik. Ihr Interesse für Medizinethik verfolgt sie seit ihrem Bachelorstudium in Philosophie und Geschichte an der Universität Augsburg. Diesem Interesse ging sie auch während ihres Masterstudiums in Philosophie an der Universität Bonn und ihrer Tätigkeit am Institut für Wissenschaft und Ethik weiter nach sowie in ihrer Dissertation zum Konflikt zwischen Autonomie und Wohlergehen in der Patient*innenversorgung, die sie im Rahmen des Münchner Kollegs für Ethik in der Praxis am Zentrum für Ethik und Philosophie in der Praxis (LMU München) verfasste.
Literatur
Baker, R., McCullough, L. B. (2007). Medical ethics’ appropriation of moral philosophy: The case of the sympathetic and the unsympathetic physician. Kennedy Institute of Ethics Journal, 17(1), 3–22.
Bærøe, K. (2014). Translational ethics: An analytical framework of translational movements between theory and practice and a sketch of a comprehensive approach. BMC Medical Ethics, 15(71).
Cholbi, M. (2023). Kamm, Almost Over: Aging, Dying, Death. Criminal Law and Philosophy, 17(1), 223–228.
Flynn, J. 2022. Theory and Bioethics. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2022 Edi-tion), hg. v. E. N. Zalta und U. Nodelman. Online unter: https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/theory-bioethics/ [Zugegriffen: 18.08.2024].
Hirsch, A. (2024). Philosophisch-konzeptionelle Kompetenzen und ihr Beitrag zur Medizinethik. In Ethical Competencies in Medicine. German and Global Perspectives. Yearbook Ethics in Clinics, vol. 17, hg. v. Andreas Frewer. Würzburg: Königshausen & Neumann, 159–176.
Mackenzie, C. (2008). Relational autonomy, normative authority and perfectionism. Journal of Social Philosophy, 39(4), 512–533.
Murray, T. H. (1987). Medical ethics, moral philosophy and moral tradition. Social Science & Medicine, 25(6), 637–644.
Rhodes, R. (2020). The trusted doctor: Medical ethics and professionalism. New York: Oxford University Press.
Savulescu, J. (2015). Bioethics: why philosophy is essential for progress. Journal of Medical Ethics, 41(1), 28–33.
Salloch, S., Ritter, P., Wäscher, S., Vollmann, J., Schildmann, J. (2016). Was ist ein ethisches Problem und wie finde ich es? Theoretische, methodologische und forschungspraktische Fragen der Identifikation ethischer Probleme am Beispiel einer empirisch-ethischen Interventionsstudie. Ethik in der Medizin, 28(1), 267–281.
Schramme, T. (2016). Philosophie und Medizinethik. Ethik in der Medizin, 28 (4), 263–266.
Schramme, T. (2017). Philosophy of medicine and bioethics. In Handbook of the Philosophy of Medicine, hg. v. T. Schramme und S. Edwards. Dordrecht: Springer, 3–15.
Sjöstrand, M., Eriksson, S., Juth, N., Helgesson, G. (2013): Paternalism in the name of autonomy. The Journal of Medicine & Philosophy, 38(6), 710–724.
Specker Sullivan, L., Niker, F. (2018). Relational autonomy, paternalism, and maternalism. Ethical Theory and Moral Practice, 21(3), 649–667.
Veatch, R. M. (2006). How philosophy of medicine has changed medical ethics. The Journal of Medicine and Philosophy, 31(6), 585–600.




