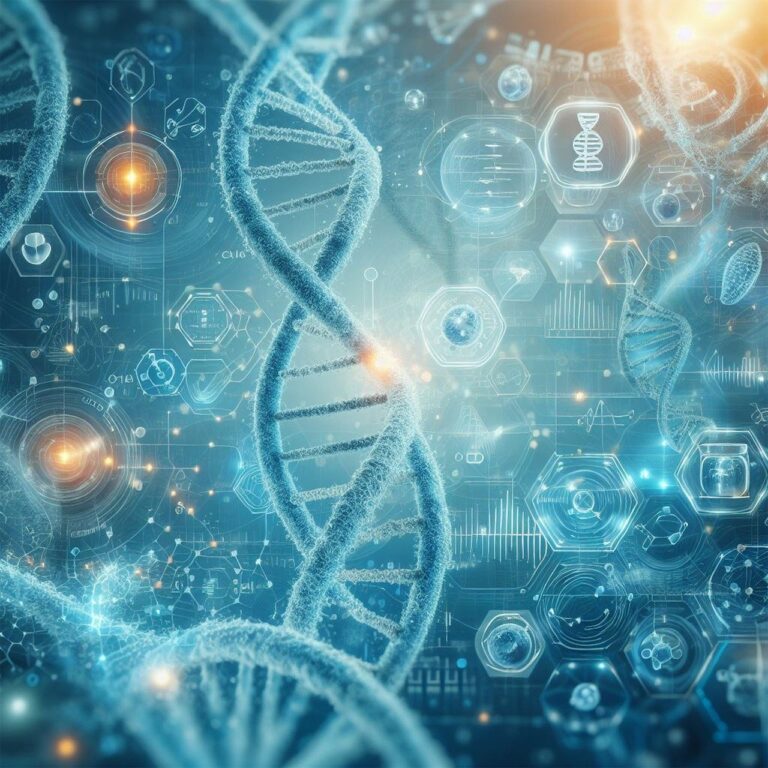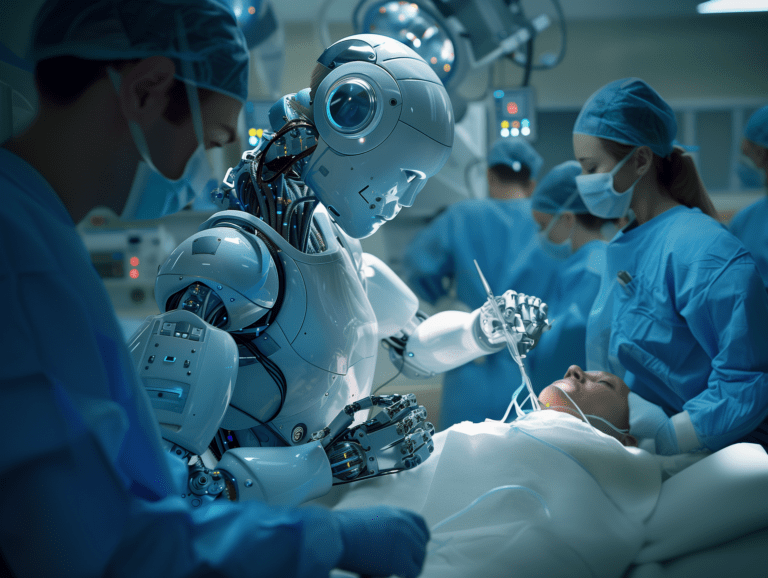Ageismus im Gesundheitswesen: Autonomie und soziale Gerechtigkeit im höheren Alter neu denken
Von Elisabeth Langmann (Augsburg) –
Alter ist eine zentrale Eigenschaft, die im Kontakt mit Menschen auffällt und oft aufgrund äußerer Merkmale oder Handlungen eingeschätzt wird. Diese Einschätzung basiert auf vielen Faktoren und wird häufig in Form einer groben Alterskategorie wie „hochaltrig“ zusammengefasst. Daraus entstehen altersbezogene Bilder und Vorstellungen, die von individuellen und gesellschaftlichen Einstellungen geprägt sind. Solche Kategorisierungen können sowohl zur Sensibilisierung im Umgang mit älteren Menschen als auch zu Vorurteilen und Diskriminierung führen. Denn wie über Alter, Altern und ältere Menschen gedacht und diskutiert wird, ist vielfältig, komplex und zugleich allgegenwärtig.
Ageismus – Ein strukturelles Problem
Ageismus – wie wir denken, fühlen und handeln gegenüber Altern, älteren Personen und dem höheren Alter – ist Ausdruck tief verankerter Marginalisierungsdynamiken, die in gesellschaftliche Normen und institutionelle Strukturen eingebettet sind. Diese Dynamiken formen eine der weit verbreitetsten Formen sozialer Ungleichheit und sind eng mit ableistischen Vorstellungen verbunden – also mit der Abwertung von Personen, deren Körper und Fähigkeiten nicht den gesellschaftlichen Normen von Jugendlichkeit, Gesundheit und Produktivität entsprechen. Vorstellungen, die das höhere Alter auf Defizite reduzieren, fördern ein Bild des Alterns als Phase des Verlustes, der Schwäche und der Abhängigkeit. Während Jugendlichkeit als Norm idealisiert wird, wird damit Altern sowie das höhere Alter als „das Andere“ positioniert und mit Vulnerabilität, Unselbstständigkeit und Hilfsbedürftigkeit in Verbindung gebracht [1]. Diese dichotome Vorstellung ist kein Zufall. Sie ist Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse, die bestimmte Lebensphasen und Zustände abwerten.
Altersbilder sind tief in kulturellen Narrativen und institutionellen Praktiken verankert, insbesondere im Bereich der Gesundheitsversorgung. Ageismus beeinflusst dabei die Qualität der Gesundheitsversorgung auf vielfältige Weise: Er verschärft situative Vulnerabilitäten und schafft Barrieren für eine bedürfnisorientierte Versorgung. Ein weitverbreitetes Stereotyp ist, Altsein mit Kranksein gleichzusetzen, wodurch gesundheitliche Probleme älterer Menschen als „normal“ relativiert und damit weniger ernstgenommen werden. Zudem werden ältere Personen seltener in klinische Studien einbezogen, was den Zugang zu evidenzbasierter Versorgung und relevanten Therapien einschränkt. Weitverbreitet ist auch die Annahme, dass ältere Patient:innen auf verschiedene Weise weniger kompetent seien, was zu einer herabgesetzten Berücksichtigung ihrer Meinung und Entscheidungsfähigkeit beiträgt. Im therapeutischen Bereich zeigt sich, dass ältere Patient:innen bestimmte Behandlungen, wie Chemotherapien, seltener erhalten [2]. Diese unterschiedlichen Dynamiken erhöhen das Risiko, dass ältere Menschen aufgrund ihres Alters ihre Erwartungen an die Gesundheitsversorgung herabsetzen und dadurch weniger Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen oder dass die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen für sie eine größere Überwindung darstellt. Zugleich beeinflussen diese weitreichenden Auswirkungen von Ageismus die Handlungsräume und -möglichkeiten älterer Menschen und wirken sich somit auf deren Autonomie aus. In einem Umfeld, das ältere Menschen als passiv und abhängig betrachtet, werden sie oft nicht als selbstbestimmte Akteur:innen anerkannt. Diese strukturellen Vorannahmen schränken nicht nur ihre Handlungsräume ein, sondern delegitimieren auch ihre Entscheidungen in Bezug auf ihre eigene Gesundheit und ihr Leben, die oft als weniger glaubwürdig oder rational angesehen werden [3]. Dies führt dazu, dass Stimmen älterer Personen in Entscheidungsprozessen weniger Gewicht haben und ihre Perspektiven als weniger relevant angesehen werden.
Autonomie im Alter: Zwischen Selbstbestimmung und Ageismus
Eine bedeutsame Frage im Zusammenhang mit Ageismus ist, wie sich diese marginalisierenden Dynamiken auf den Respekt der Autonomie sowie die Selbstbestimmung und Handlungsräume sowie Handlungsmöglichkeiten auswirken. Im Gesundheitswesen wird Autonomie häufig als individuelle Entscheidungsfreiheit verstanden – als die Fähigkeit, eigenständig und rational über die eigene Versorgung zu bestimmen. Doch diese Sichtweise greift insbesondere dann zu kurz, wenn erkannt wird, dass autonome Entscheidungen stets in einem sozialen und institutionellen Kontext getroffen werden und damit relational sind. Um dies vertieft zu beleuchten, bietet die Perspektive der relationalen Autonomie wertvolle Einsichten, indem deutlich wird, dass Entscheidungen nicht isoliert vom sozialen Umfeld getroffen werden können. Durch eine solche Perspektive wird somit anerkannt, dass die Entscheidungsfreiheit älterer Menschen untrennbar mit ihren sozialen Beziehungen und institutionellen Rahmenbedingungen verwoben ist.
Im höheren Alter wird die Möglichkeit zur Selbstbestimmung durch verschiedene Abhängigkeiten speziell beeinflusst – sei es durch medizinische Versorgung, familiäre Unterstützung oder institutionelle Praktiken. Zudem tragen Vorurteile und Stereotype dazu bei, dass das Maß an zugestandener Selbstbestimmung eingeschränkt wird. Doch diese Abhängigkeiten bedeuten nicht, dass ältere Menschen grundsätzlich weniger fähig sind, über ihr Leben zu bestimmen. Vielmehr zeigt sich, dass Ageismus entscheidend dazu beiträgt, ihre Handlungsspielräume einzuengen. Beispielsweise wird die Zuschreibung älterer Menschen als besonders vulnerabel als Begründung herangezogen, Entscheidungen in Vertretung für ältere Personen zu treffen. Dies hat zur Folge, dass die Möglichkeit zur Selbstbestimmung systematisch untergraben wird – oft unter dem Vorwand der Schutzbedürftigkeit.
Die Sichtweise, die Vulnerabilität als eine unvermeidliche Eigenschaft des Alterns betrachtet, verstärkt jedoch das defizitorientierte Bild des höheren Alters. Dabei ist Vulnerabilität keineswegs eine Eigenschaft des höheren Alters, sondern häufig das Ergebnis sozialer und institutioneller Bedingungen. Altersfeindliche Strukturen verstärken diese Verletzlichkeit, indem sie ältere Menschen aus Entscheidungsprozessen ausschließen oder ihre Stimmen als weniger glaubwürdig bewerten. Entscheidungen werden oft ohne Berücksichtigung der individuellen Wünsche und Vorstellungen der betroffenen Personen getroffen, da ihnen die Fähigkeit zu selbstbestimmten und informierten Entscheidungen abgesprochen wird. Dies zeigt sich nicht nur in der Art und Weise, wie mit älteren Personen kommuniziert wird, sondern auch darin, dass sie seltener vollständige Informationen über Behandlungsoptionen erhalten. Diese Problematik betrifft sowohl Entscheidungsmomente als auch die tatsächlichen Möglichkeiten, die älteren Menschen zur Verfügung stehen. In Hinblick auf die soziale Verteilung von Chancen wird deutlich, dass Autonomie ohne substanzielle Verwirklichungschancen – also ohne die tatsächliche Möglichkeit, eine Entscheidung umzusetzen – zu einem leeren Begriff wird.
Fazit
Ageismus und die damit einhergehenden eingeschränkten Handlungsspielräume, die viele ältere Menschen im Gesundheitswesen erleben, sind Herausforderungen, denen wir nur gemeinsam als Gesellschaft begegnen können. Die Überwindung von Ageismus im Gesundheitswesen erfordert mehr als das individuelle Erkennen von Vorurteilen und Stereotypen. Es geht darum, die tief verwurzelten Strukturen und Machtverhältnisse zu verändern, die ältere Menschen systematisch benachteiligen. Eine gerechte Gesundheitsversorgung für ältere Menschen muss auf sozialer Gerechtigkeit, Empowerment und Teilhabe basieren. Nur so können wir sicherstellen, dass Menschen auch im höheren Alter als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft anerkannt und behandelt werden.
Anstatt das höhere Alter als Phase des Verlustes und der Abhängigkeit zu verstehen, sollten wir Bedingungen schaffen, die jedem Menschen – unabhängig vom Alter – Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen. Dafür braucht es nicht nur neue institutionelle Rahmenbedingungen, sondern auch ein Umdenken in unseren alltäglichen Haltungen und Handlungen. So kann eine Gesellschaft entstehen, in der das höhere Alter als eine Lebensphase mit eigenen Potenzialen und Rechten anerkannt wird und in der jede:r von uns als gleichwertiger Mensch behandelt wird.
Hierzu zählt auch Altern in dessen Vielfalt zu würdigen und gutes Altern nicht primär an Gesundheit zu knüpfen, sondern an die Möglichkeit, nach den eigenen Vorstellungen in unterstützenden sozialen und institutionellen Rahmenbedingungen zu altern. Eine solche Perspektivverschiebung bereichert das Bild des Alterns, fördert das gegenseitige Verständnis zwischen den Generationen und hilft, eine Gesellschaft zu schaffen, die Menschen aller Altersstufen wertschätzt. Die Überwindung von Ageismus wäre somit nicht nur ein Gewinn für ältere Menschen, sondern für uns alle.
Dr. phil. Elisabeth Langmann ist Medizinethikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Augsburg. Sie verfügt über einen interdisziplinären Hintergrund in Pflegewissenschaft, Angewandter Ethik und Pädagogik. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf feministischer Bioethik, sozialer Gerechtigkeit und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Dieser Beitrag basiert auf ihrer Dissertation „Ageismus im Gesundheitswesen: Eine Analyse aus Perspektive feministischer Medizinethik“, die sie 2024 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg abschloss und im transcript Verlag erschienen ist.
Literatur
2. Chang E-S, Kannoth S, Levy S, Wang S-Y, Lee JE, Levy BR. Global reach of ageism on older persons’ health: A systematic review. PLoS One. 2020;15:e0220857. doi:10.1371/journal.pone.0220857.