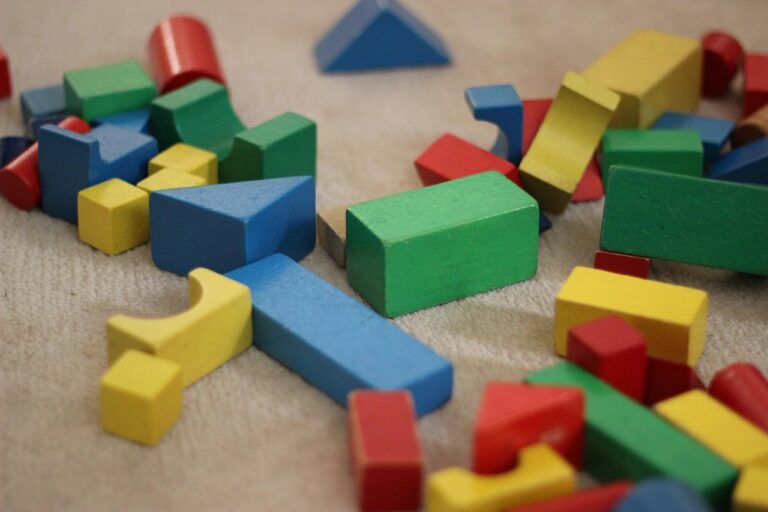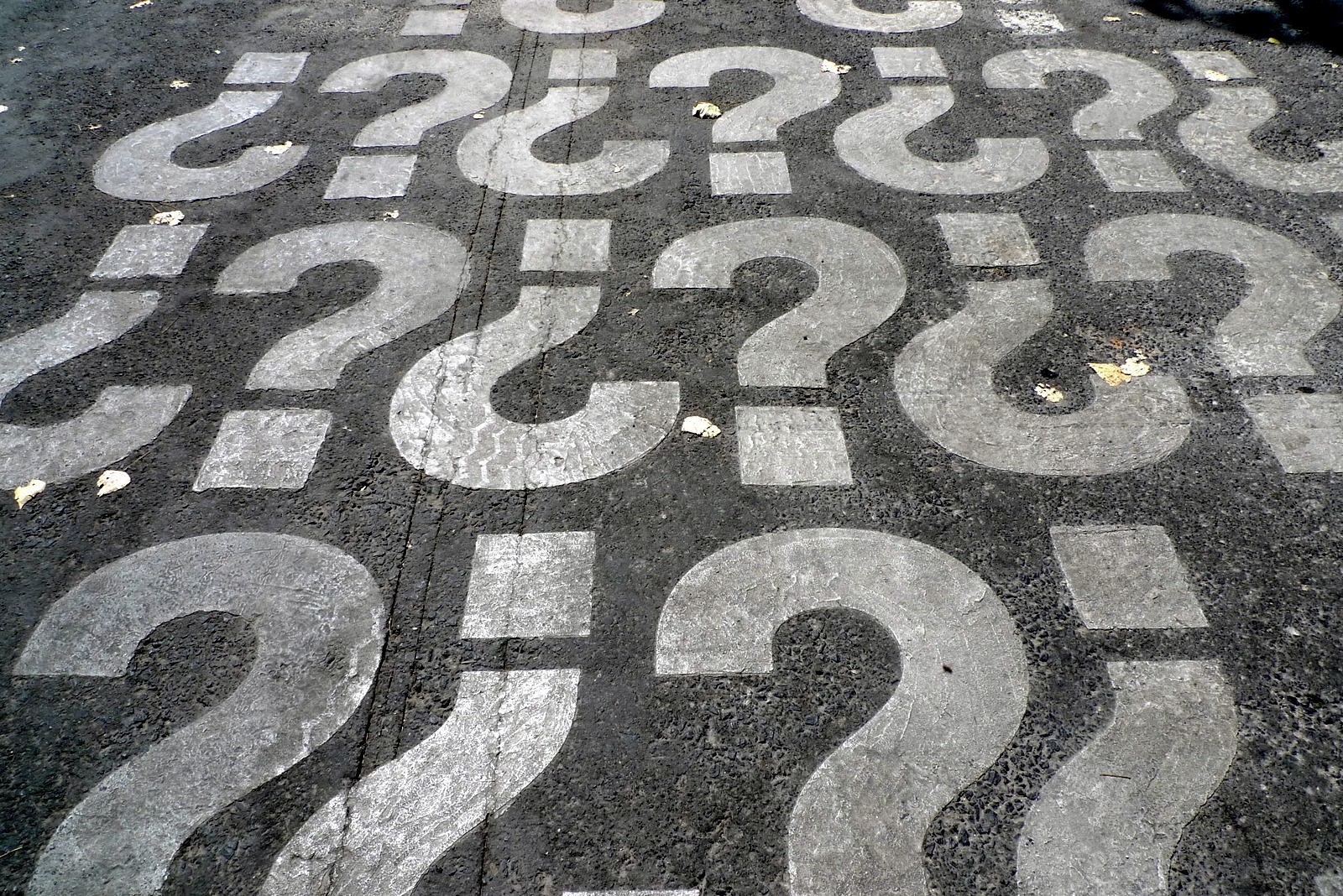
Eine Ausgabe, viele Fragezeichen – Ein kritischer Blick auf die Ausgabe 1/2025 der Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik (ZDPE)
Von Sophia Hohmann (Bielefeld), Daniel Lucas (Zürich) & Alex Miller-Noe (Köln)
In der Ausgabe 1/25 der ZDPE fragen die Herausgeber, Frank Brosow und Markus Tiedemann, in ihrer Einleitung, wie man Social Justice richtig kritisieren kann. Sie zeigen dabei vor allem, wie es nicht geht. Denn einzelne Beiträge setzen sich weder argumentativ (sprich: philosophisch) mit dem jeweiligen Thema auseinander noch entsprechen sie Publikationsstandards der akademischen Philosophie(didaktik).
Vier Verfahrensweisen erscheinen uns auffällig: Erstens werden vage und teilweise diskriminierende Begriffe verwendet. Zweitens neigen die Autor*innen zu Fehlschlüssen. Drittens wird die eigene Position als wissenschaftlich-universell deklariert, andere Positionen dagegen als unwissenschaftlich und subjektiv. Viertens werden Narrative der Angst geschürt. Diese Verfahrensweisen überschneiden sich meist. Eine eindeutige Zuordnung der im Folgenden diskutierten Beispiele ist daher nicht möglich. Diese Verfahrensweisen sind nicht nur der ZDPE unwürdig, sondern vor allem der philosophischen Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen. Die erkennbare politische Tendenz, der Hang zur moralischen Panik (Daub, 2022), ist alles andere als unbedenklich, denn sie lässt sich innerhalb eines regressiven und revisionistischen politischen Programms verorten.
Dass die ZDPE eine große Zielgruppe sowohl in der schulischen als auch der hochschulischen philosophischen Bildung adressiert, unterstreicht die Brisanz. Deshalb beschäftigen wir uns in diesem Beitrag mit ausgewählten Beiträgen der Ausgabe.
Vage und diskriminierende Begriffe
Die präzise Verwendung und Bestimmung von Begriffen ist ein Kernanliegen der Philosophie. Vage Begriffe sind solche, bei denen sowohl die Intension als auch die Extension so uneindeutig sind, dass nicht deutlich wird, wer oder was damit gemeint ist. In einer pauschalen und stereotypen Weise nutzen Tiedemann und Brosow in der Einleitung den Begriff der Social-Justice-Bewegung. Die Social-Justice-Bewegung konzipieren sie als „Theoriefamilie” (S. 10), als „Kreis” (ebd., S. 4). Damit könnte irgendetwas zwischen wenigen und allen Vertreter*innen der Critical Theories gemeint sein – oder schlicht „popularisierte Social-Justice-Theorien” (ebd., S. 7). Unklar bleibt, worin sich diese Theorien, die „Begriffe, Prämissen, Argumente und Methoden” (ebd., S. 3) teilen, unterscheiden und wo genau Überschneidungen bestehen sollen.
Ähnlich ist es im Beitrag von Inken Prohl, in dem ebenso die Komplexität und Vielfalt sozialer Bewegungen, die sich für soziale Gerechtigkeit engagieren, negiert wird. Stattdessen wird von „der Social-Justice-Bewegung” geschrieben (vgl. z. B. S. 37 & 39). Die Social-Justice-Bewegung wird im weiteren Verlauf gleichgesetzt mit der Critical Race Theory (vgl. ebd., S. 38). Hier bleibt Prohl dem Muster also treu: Eine Entität wird als Projektionsfläche für allerlei Behauptungen herangezogen, ohne dass bestimmt wird, was genau damit gemeint ist. Das macht die Auseinandersetzung mit der von Prohl formulierten Kritik kaum möglich.
Esther Brockwyt konzipiert in ihrem Beitrag „Wokeness” als „Ideologie”, unterstellt einen „religiös-missionarischen Charakter” und behauptet „Glaubenssätze” wie den, dass „der Mensch unendlich formbar und durch angemessene Sozialisierung in seinem Erleben und Verhalten in diesem Sinne modellierbar” (S. 49) sei. Keiner dieser Begriffe wird definiert oder erläutert. Belege, warum die Zuschreibungen plausibel sein sollten, fehlen vollständig.
In Marie-Luise Vollbrechts Beitrag werden zum einen sexuelle Präferenz und sexuelle Identität verwischt (vgl. z. B. S. 28). Zum anderen werden Transsexualität und Intersexualität, Transsexualität sowie Transvestie und Geschlecht, Sex und Gender abweichend von der zeitgemäßen öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion verwendet – dies zieht sich durch den gesamten Text. Die Verwendungsweise von Geschlecht und Gender ist unklar. Die Rede von biologischem Geschlecht lehnt Vollbrecht ab (S. 27), womit im Deutschen die Begriffsgrenzen vollständig verschwimmen.
Frank Brosow schränkt seine Kritik am Anti-Rassismus zwar dahingehend ein, dass es ihm nur um die dritte Welle des Anti-Rassismus in ihrer starken Lesart ginge (vgl. S. 74). Diese Einschränkung geht jedoch im Artikel unter – so auch im Titel des Beitrags, der nur Antirassismus benennt. Dass diese dritte Welle vor allem im US-amerikanischen Raum zu verorten ist, wird hingegen verschwiegen.
In den Texten werden auch diskriminierende Begriffe verwendet. So nutzt Prohl den Begriff „Transgenderismus” (vgl. z. B. S. 36), der Transidentitäten als Ideologie abtut. Transidentitäten sind ein zentraler Bestandteil des Selbstverständnisses von Personen – so wie z. B. Klasse und Geschlecht – und keine ideologischen Irrungen.
Fehlschlüsse und Non Sequiturs
Die Verwendung vager Begriffe ist eng mit Fehlschlüssen und Non Sequiturs verbunden, was uns zur zweiten Verfahrensweise bringt. In den Beiträgen werden kaum Argumente vorgebracht, was für philosophische Texte, die man in einer philosophiedidaktischen Fachzeitschrift erwarten dürfte, verblüffend ist. Stattdessen werden Aussagen aneinandergereiht, woraus die Autor*innen allerlei schlussfolgern.
Brosows und Tiedemanns vage Begrifflichkeit der Social-Justice-Bewegung hängt eng mit einem Strohmannargument zusammen. Sie meinen, den Fehlschluss vermeiden zu können, indem sie den Pappkameraden namens Philosophie/Wissenschaft-gefährdende-Social-Justice-Bewegung mit einer Liste von „Grundüberzeugungen der Social-Justice-Bewegung” flankieren (S. 12). Der logische Fehlschluss besteht darin, sich nicht auf tatsächliche, ausgewiesene Positionen zu beziehen, sondern die eigene Interpretation, dass die (!) Social-Justice-Bewegung auf jenen problematischen Grundüberzeugungen fuße, die im PDF hinter dem QR-Code aufgeführt werden, anzugreifen. Es wird vermeintlich den Leser*innen überlassen, sich einen Pappkameraden so zusammenzustellen, wie es ihnen beliebt. Die Liste der sog. Grundüberzeugungen ist eine oberflächliche und pauschalisierende Zusammenstellung von Irrtümern (z. B. Aktivismus statt Bildung; emotionales Schlussfolgern) über Menschen in der Akademie (oder auch außerhalb, das bleibt unklar), die sich mit Themen der Sozialen Gerechtigkeit beschäftigen. Eine Beschränkung auf eine problematische These oder Theorie wäre sinnvoller für den Diskurs gewesen, hätte aber keinen Platz für breitbeinige Pars-pro-Toto-Thesen gesamtgesellschaftlicher Tragweite gelassen.
Bei Bockwyt ist unklar, was aus ihren Zuschreibungen folgen soll. Selbst wenn „Wokeness“ mit einem religiös-missionarischen Eifer (S. 49) verfolgt würde, wäre das Konzept nicht notwendig verfehlt. In ähnlicher Weise zeigen sich Probleme bei Vollbrecht. Vor dem Hintergrund der Verwebung von rudimentärer Bewegungs- und Medizingeschichte werden Schlüsse gezogen, die nicht folgen – etwa, wenn diagnostische Grundlagen und politische Debatten vermengt werden (vgl. S. 30). Insbesondere mangelt es an einer Darstellung, wie die beiden Geschichtserzählungen überhaupt zusammenhängen.
Brosow wiederum bezieht sich auf eine bekannte US-amerikanische Antifeministin, die feministische Studien zur Häufigkeit von Vergewaltigungen u. a. als zu opferzentriert kritisiert (vgl. S. 79). Darauf aufbauend kritisiert Brosow verschiedene wissenschaftliche Zugänge zu strukturellem Rassismus (vgl. ebd.). Diese Analogie zu ziehen, ist für sich genommen ein Fehlschluss, was Brosow im weiteren Verlauf daraus folgert, ebenso.
Universalisierung der eigenen Position
Viele der Beiträge universalisieren die eigene Position, während sie andere Positionen u. a. als lediglich subjektiv abwerten. Am deutlichsten zeigt sich das wohl bei Vollbrecht, wenn sie behauptet, ihre Position sei eine „auf Grundlage einer nicht weltanschaulich vorgeprägten Begriffsverwendung […] naturwissenschaftlich belegbare Wahrheit”. Positionen, die vielfältige Genderidentitäten ernst nehmen, bezögen sich allein auf das „subjektive Empfinden” (S. 31) von Personen. Die eigene Position derart zu überschätzen, ist ein Problem. Dies abseits der zeitgenössischen Forschungsdiskussion zu tun, ist eine Anmaßung.
Die Universalisierung der eigenen Position ist eng verknüpft mit der vermeintlichen Wissenschaftlichkeit der Beiträge. Der Universalismus der Wissenschaft wird von den Autor*innen vermutlich mit weltanschaulicher Neutralität gleichgesetzt. Damit werden wesentliche wissenschaftsphilosophische Positionen ausgeblendet. Auf den ersten Blick erscheinen die Beiträge wissenschaftlich, sie arbeiten allerdings mit teils unwissenschaftlichen Quellen. Zugleich werden Diskussionen verwissenschaftlicht, ohne dass sie primär ein wissenschaftliches Anliegen haben oder sich ausschließlich darauf reduzieren ließen. Besonders auffällig ist das in der Einleitung, in der Brosow und Tiedemann für die Beschreibung der drei Hauptsäulen der Social-Justice-Bewegung zunächst auf eine kanadische Internetseite ohne Impressum verweisen. Auf dieser Seite werden unausgewogene anti-woke Positionen verschiedener Akteur*innen zusammengetragen. Mit der Quelle für die zweite Säule der Bewegung ist es nicht viel besser. Hier wird Lindsays und Pluckroses populärwissenschaftlicher Beitrag genutzt, der, wie Jens Balzer (2022) feststellt, „an Schlampigkeit und aktivistischem Furor” scheitert.
Auch Prohl bezieht sich auf vermeintlich zentrale Theoreme der Social-Justice-Bewegung, für die vielfach keine oder sehr allgemeine Quellen benannt werden. Während für die eigene Disziplin (Religionswissenschaft) eine Heuristik herangezogen wird, genügt für die Social-Justice-Bewegung ein Holzschnitt (vgl. S. 37). Ohnehin werden die angeblich unwissenschaftlichen und nicht-empirischen Bezugspunkte der Social-Justice-Bewegung ständig moniert (vgl. z. B. ebd.). Dass es für Prohls Thesen an empirischer Evidenz fehlt und dass es nicht-empirische Wissenschaften gibt, ist kein Thema. Einem ähnlichen Muster folgt Brosows Unterrichtsentwurf: Vermeintlich ganz dem Universalismus verpflichtet, will Brosow einen Unterrichtsentwurf zur Kritik am Antirassismus vorlegen, der nicht indoktriniert (vgl. S. 73). Denn Brosow vermutet in der Schulpraxis einen „regelrechten Bekehrungseifer“ (ebd., S. 83). Dass BIPoC tatsächlich von Ungerechtigkeiten betroffen sind, müssten „tadellose“ Studien mit „sauberer“ Methodik nachweisen, denn: „Nur Ergebnisse zu zitieren, die ,belegen‘, was die Theorie schon vor der Studie wusste, ist ein klarer Fall von confirmation bias“ (ebd., S. 79). Hier könnte man Brosow zugutehalten, dass er die hinter seinem Beitrag liegende Strategie gleich mitliefert. Doch leider versäumt er es, den eigenen confirmation bias zu adressieren.
Ängste und vermeintliche Ausschlüsse
Einige der von uns besprochenen Beiträge bemühen angstschürende Narrative, um die eigenen Ausführungen zu unterfüttern. So stimmt Prohl die Leser*innen direkt zu Beginn ihres Beitrags auf vermeintliche Konsequenzen der Social-Justice-Bewegung ein, die die Meinungsfreiheit gefährden, zu Mobbing führen und in „Cancelling“ aufgehen würden (vgl. S. 36-37).
Auch Brosow beginnt mit einer Beschreibung von Ängsten, nämlich denen von nicht von Rassismus betroffenen Personen und Institutionen vor Rassismusvorwürfen (vgl. S. 73). Belege dafür, ob es diese Ängste tatsächlich gibt und ob sie berechtigt sind, werden nicht angebracht. Viel relevanter ist, was Brosow nicht schreibt: Dass Rassismus eine Diskriminierung ist, die für Rassifizierte weitreichende Folgen hat. Brosow geht allerdings nur von denjenigen aus, die potenziell mit dem Vorwurf, rassistisch zu sein, konfrontiert sein könnten. Tatsächliche Rassismuserfahrungen werden mit sich „unsafe“ fühlen verhöhnt – und safe spaces gleich mit (vgl. S. 75).
Lediglich ein Problem der Qualitätssicherung?
Wie gezeigt, weisen die Beiträge schwerwiegende methodische Mängel auf. Es ist daher nicht nachvollziehbar, wie sie in der ZDPE erscheinen konnten. Zumindest nicht, wenn es sich um begutachtete Beiträge zur Philosophiedidaktik handeln soll. Gemäß Angaben auf der Website der ZDPE, durchlaufen allerdings alle eingereichten Beiträge ein nicht näher beschriebenes „Gutachterverfahren“. Versteht man die Beiträge hingegen als politische Beiträge, wird die dahinterliegende Strategie deutlich: Einige der Autor*innen sind Mitglieder des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Andere sind vor allem als Anti-Woke- bzw. Anti-Trans-Aktivist*innen bekannt. Wir haben daher gute Gründe anzunehmen, dass sich eine Fachzeitschrift hier für die politische Propaganda bestimmter Akteur*innen instrumentalisieren lässt und ihnen darüber hinaus den Weg in die Schulbildung ermöglicht. Die Herausgeber*innen, weiteren Organe der ZDPE und der Verlag müssen sich fragen, wie das passieren konnte, wie sie darauf reagieren wollen und wie sie solcherlei Einflussnahme in Zukunft verhindern wollen.
Sophia Hohmann hat u. a. Philosophie studiert, arbeitet in der Hochschulverwaltung und engagiert sich wissenschaftspolitisch.
Daniel Lucas doktoriert an der ETH Zürich und hat sich bereits in der Vergangenheit mit rechten Netzwerken in der Wissenschaft befasst.
Alex Miller-Noe ist Philosophie- und Französischlehrer und hat nach seinem Referendariat an der Universität zu Köln promoviert.
Literatur
Balzer, Jens (2022): Eine Polemik mit Schaum vor dem Mund. https://www.deutschlandfunkkultur.de/pluckrose-lindsay-zynische-theorien-100.html
Daub, Adrian (2022): Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Berlin: Suhrkamp.
ZDPE 1/2025 Social Justice, Frank Brosow und Markus Tiedemann (Hrsg.). Bamberg: C.C.Buchner.
- Bockwyt, Esther: Wokeness und psychische Gesundheit. Eine psychologische Deutung, 49-53.
- Brosow, Frank: Das Böse ist immer und überall. Ist der Antirassismus ein Neorassismus?, 73-85.
- Brosow, Frank und Markus Tiedemann: Wie ist Kritik an Social Justice möglich?, 3-12.
- Prohl, Inken: Altruistischer Fundamentalismus. Die Social-Justice-Bewegung als religionsanaloge Formation, 36-48.
- Vollbrecht, Marie-Luise: Die Transformation des Geschlechts. Geschichte des Transaktivismus, 22-35.