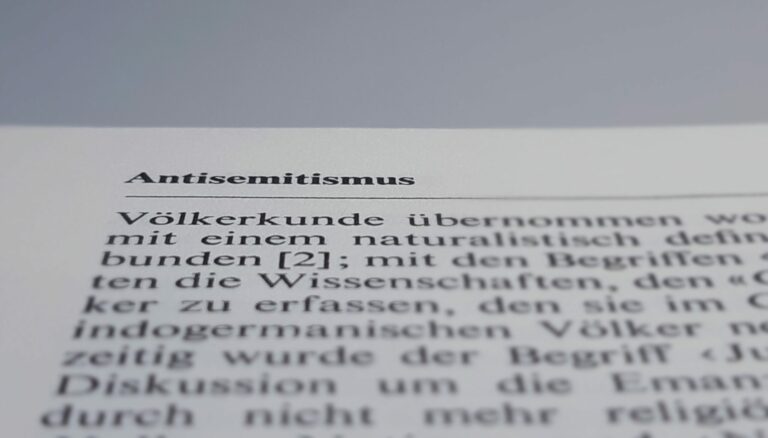Eine Frage der Berührung
Podcast: Play in new window | Download
Barbara Schellhammer (München)
Dieser Blogbeitrag basiert auf einem Aufsatz, der in einem Schwerpunkt zur COVID-19 Pandemie in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift für Praktische Philosophie (ZfPP) erschienen ist. Der Aufsatz kann auf der Website der ZfPP kostenlos heruntergeladen werden.
Dieser Blogbeitrag kann auch als Podcast gehört und heruntergeladen werden:
Gerade in Ausnahmesituationen rücken Menschen zusammen – eigentlich. Das ist in Zeiten des Coronavirus anders, denn hier gilt das Gebot des „social Distancing“. Wir sind, wie dies Angela Merkel, mit Verweis auf eine „scheinbar paradoxe Sache“, ausdrückte, aufgefordert, Solidarität zu zeigen, indem wir Abstand halten. Weniger ambivalent und scheinbar glasklar klingt die Sache beim österreichischen Kanzler Sebastian Kurz: „Jeder soziale Kontakt ist einer zu viel“. Wie bei vielen, die hinsichtlich der Bedrohung durch das Virus vor allem biopolitisch argumentieren, zeigt sich auch hier eine schwerwiegende Missachtung unserer (Zwischen-)Leiblichkeit. Nicht selten hört man dann noch beschwichtigend, beim „social Distancing“ handle es sich ja eigentlich „nur“ um ein „physical Distancing“. Es ist sicher auch richtig, dass wir die Bedeutung von uns nahestehenden Menschen, die uns sonst kaum in den Sinn kommen, besonders deutlich spüren, wenn wir ihnen nicht mehr begegnen dürfen. Einige sprechen hier von einer „Dialektik der Distanz“ oder von einer „neuen Nähe“, die sich gerade aus der Distanz ergebe.
Auf der Spur des Unbehagens
Auch wenn ich alle Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung mittrage, beschleicht mich doch ein Unbehagen angesichts dieser Rhetorik – ein Unbehagen, das mich seit Anbeginn der Krise begleitet, dem ich auch philosophisch Bedeutung beimesse und dementsprechend weiter nachgehen möchte. Der Weg meiner Wahl führt mich über konkrete Alltagserfahrungen, um zu fragen, auf welche Art und Weise sich dieses Unbehagen zeigt. Es liegt auf der Hand, dass sich dabei die Phänomenologie als methodischer Zugang anbietet, um der noch stummen Erfahrung Ausdruck zu verleihen. Da es beim „social Distancing“ vor allem um die körperliche Distanzierung geht, die, so meine These, unsere Leiblichkeit als einen ganz zentralen Aspekt unseres menschlichen In-der-Welt-seins einfach vom Tisch wischt, bietet sich vor allem ein leibphänomenologischer Zugang an.
Dieser ist gerade dann besonders ertragreich, wenn wir über unsere Erfahrungen ins Gespräch kommen. Denn es geht der Phänomenologie nicht darum, fertige Tatsachen festzustellen, sondern um einen Prozess, in dem sich uns etwas durch die Auseinandersetzung mit unserem Erleben zeigt, in dem etwas von der Bedeutung und dem Sinn einer Erfahrung in Worte gefasst und besprochen werden kann. Auch deshalb ist es sinnvoll, facettenartig Alltagsbeobachtungen herauszugreifen, um diesen leibphänomenologisch nachzuspüren, denn hier finden wir trotz unterschiedlicher Bedingungen und Lebensumstände weltweit Anknüpfungspunkte, weil die Pandemie uns alle als leib-körperliche Wesen trifft und wir merken, dass wir nicht bloß körperlich Distanz halten müssen, sondern die leibliche Nähe brauchen. Ich greife einen Erfahrungskontext heraus, in dem sich derzeit viele Menschen wiederfinden: das Home-Office. Dabei ist klar, dass die Bedeutung einer Berührung in anderen Situationen, wie etwa bei einem schweren Krankheitsverlauf oder gar beim Sterben, noch viel deutlicher hervortritt. Ebenso wissen wir, dass die Einsamkeit, insbesondere unter älteren Menschen, nicht erst seit Corona ein großes soziales und auch gesundheitliches Problem ist. Mir scheint jedoch, dass sich vielleicht gerade in Momenten, wo wir nicht damit rechnen, eine Erkenntnis herausschält, die sehr grundlegend für uns sein kann.
„Halbierte Leiblichkeit“
Reinhold Esterbauer (2020) beschreibt seine Erfahrungen im Home-Office treffend mit der Empfindung einer „halbierten Leiblichkeit“ und fragt sich, was eigentlich in Videokonferenzen fehle, denn man könne die anderen ja hören und sehen, aufeinander reagieren und gemeinsam Projekte vorantreiben. Was jedoch verloren ginge, sei die sinnliche Ganzheit und Unmittelbarkeit der Begegnung. Der Leib als analoges Medium sozialer Interaktion wird ersetzt durch digitale Medien wie das Smartphone oder den Computer. „Seltsamerweise“, so schreibt Esterbauer, „schafft ein Medium durch seine Vermittlung zugleich zweierlei, nämlich Nähe und Distanz. Auf der einen Seite können zwar räumliche Entfernungen überwunden werden und jemand steht einem am Bildschirm direkt vor Augen, zugleich aber bleibt er oder sie entfernt und hinter einer ‚gläsernen‘ Wand.“ (ebd.) Wenn wir skypen oder zoomen, nimmt immer nur ein Teil von mir Anteil an der Kommunikation. Was hauptsächlich „rüberkommt“, ist der Körper. Der reine Informationsaustausch kann die leibliche Lücke nicht füllen, da helfen auch keine „emoticons“ als digitale Gefühlsausdrücke. Es bleibt ein Vakuum, das seltsamerweise gerade darin besteht, auch einmal nicht produktiv zu sein, sondern mit der Kollegin auf dem Gang „hängen zu bleiben“ und in ein Gespräch verwickelt zu werden.
„Zoom-Fatigue“ als Ergebnis einer leib-körperlichen Dissonanz
Deshalb wohl empfinden viele die virtuelle Arbeitswelt als besonders anstrengend, „zoom-fatique“ macht sich breit. „Our minds are together when our bodies feel we’re not“, erklärt Gianpiero Petriglieri. „That dissonance, which causes people to have conflicting feelings, is exhausting. You cannot relax into the conversation naturally.“ (in: Jiang 2020) Bei aller Entschleunigung durch die Pandemie bleibt eine genuine Resonanzerfahrung auf der Strecke. Unsere Leiber tun sich schwer, auf eine unmittelbare, natürliche Weise mit ihrer Umwelt ins Schwingen zu kommen. Maurice Merleau-Ponty (1986, 295) spricht hier von einer „Paarung der Leiber“ im „Abgestimmtsein ihrer Intentionen“ als „Bezugnahme auf eine einzige sinnliche Welt, an der alle teilhaben können“. Vor dem Computer spürt man dieses Resonanzgeschehen vor allem mit sich selbst. Man spricht zu den vielen Gesichtern auf dem Bildschirm und bleibt doch allein in seinem Zimmer. Die Selbstbezüglichkeit steigert sich dabei noch durch die Tatsache, dass man sich beim Zoomen ständig selbst vor Augen hat, was äußerst irritierend sein kann.
Räumliche und Zeitliche Verdichtung
Die verschiedenen Räume, in und zwischen denen wir uns normalerweise bewegen, fallen im Home-Office zusammen, sie verdichten sich auf einen Bezugspunkt in unserer vorwiegend digitalen Existenz. Der Computer wird zum „entry point“ unserer vielen Welten. Deshalb erleben auch nicht alle das Home-Office als entschleunigend. Denn der leibhaftige Gang zu unserem Arbeitsplatz, die Dienstreise und auch die Heimfahrt entfallen, dafür sind wir instantan und permanent „on the go“. Von einer Minute auf die andere müssen wir auf neue Settings und andere Menschen oder Themen umschalten, wenn wir von einem Zoom-Call ins nächste switchen. Das „distant Socializing“ lässt Raum und Zeit schrumpfen – dabei verlieren wir die zentralen Koordinaten unserer Daseinsstruktur bzw. die Räume und Zeiten, die wir brauchen, um uns immer wieder neu verorten und „verzeiten“ zu können. In der virtuellen Arbeitswelt ent-fernen sich unsere jeweiligen Orte, es fehlen die Räume der Bewegung, die ein Ankommen und Einstimmen auf neue Kontexte ermöglichen.
Sicherlich, es gibt auch viele positive Seiten der Arbeit im Home-Office, man kann sehr konzentriert zusammenarbeiten und es ist schön, zumindest digital in Verbindung zu sein, hin und wieder spürt man sogar die „Vibes“ durch den Bildschirm, dennoch scheint mir, dass uns die Ausnahmesituation der Pandemie auf besondere Weise darauf aufmerksam macht, dass wir nicht nur einen Körper haben, sondern auch leibliche Wesen sind. Es bedarf einer besonderen Anstrengung, trotz körperlicher Restriktionen diese leibliche Seite zu leben.
Plädoyer für Körper und Leib
Ich kann die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung virologisch sowie epidemiologisch sehr gut nachvollziehen, was mich jedoch stört, ist der unsensible und reduktionistische Ton, der die Bedeutung einer echten Berührung, gerade in Notsituationen, nicht ausreichend mit bedenkt. Wir sind mehr als Körper, die auf Distanz gehalten werden müssen und die das Menschsein doch besser für eine Weile aussetzen sollten. Ich spüre mich gerade dann am Lebendigsten, wenn zwischenleiblich etwas schwingt, sich mein Leib-Körper selbständig macht und auch nicht mehr naturwissenschaftlich „festgestellt“ werden kann. Vielleicht hilft es, über diese Erfahrungen zu reden – und das gelingt manchmal sogar digital.
Barbara Schellhammer ist Professorin für Intercultural Social Transformation und Leiterin des Zentrums für Globale Fragen (ZGF) der Hochschule für Philosophie München. Sie forscht und lehrt hauptsächlich im Bereich der Kulturphilosophie und der interkulturellen Philosophie.
Literatur
Esterbauer, Reinhold. 2020. „Orpheus im Home-Office. Halbierte Leiblichkeit in Zeiten von COVID-19“. feinschwarz.net. Theologisches Feuilleton, 30.5.2020. https://www.feinschwarz.net/halbierte-leiblichkeit/, 12.1.21.
Jiang, Manyu. 2020. „Video chat is helping us stay employed and connected. But what makes it so tiring – and how can we reduce ‚Zoom fatigue‘?“ BBC, 22.4.2020. https://www.bbc.com/worklife/article/20200421-why-zoom-video-chats-areso-exhausting, 12.1.21.
Merleau-Ponty, Maurice. 1986. Das Sichtbare und das Unsichtbare. München: Wilhelm Fink.