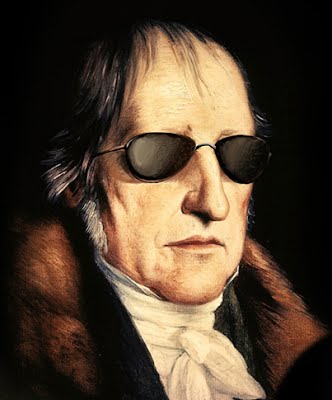
Hegel und die Revolution
Von Emanuel Kapfinger (FU Berlin) –
Am 14. Juli 1789 stürmt das Volk von Paris die Bastille. In den darauffolgenden Wochen wird das Ancien Régime entmachtet, die Deklaration der Menschenrechte verkündet und der Feudalismus abgeschafft. Gemeinsam mit seinen Kommilitonen feiert der Student Hegel (1770-1831) diese „Morgenröte der Freiheit“, und sie gründen einen politischen Klub mit dem Ziel, in Deutschland „Freiheit und Gleichheit wie bei den Franzosen einzuführen“.
Sie abonnieren französische Zeitungen, verschlingen deren Nachrichten, diskutieren hitzig das Revolutionsgeschehen. Als ein französischer Revolutionär auf der Flucht vor der württembergischen Obrigkeit in Tübingen auftaucht, versteckt der Klub ihn im Stift und besorgt mit einem „Solikonzert“ die Mittel, um ihn heimlich zurück nach Frankreich schicken zu können. Über weitere Aktivitäten ist wenig überliefert: Der Klub musste geheim bleiben. In Deutschland galten die Menschenrechte noch nicht. Doch wie andere Revolutionäre in Deutschland werden auch sie Flugblätter verteilt und politische Veranstaltungen abgehalten haben.
Rund 30 Jahre später lehrt Hegel als weithin berühmter Philosoph in Berlin. Es ist die Epoche der Restauration, in der nach der endgültigen Niederlage Napoleons im Jahr 1815 die Freiheitsbestrebungen massiv unterdrückt werden. Dennoch hat Hegels Militanz nicht nachgelassen. Um den Jahreswechsel 1819/20 sitzt einer von Hegels Studenten wegen seines freiheitlichen Engagements in Untersuchungshaft. Die Freunde des Inhaftierten, ebenfalls Studenten Hegels, bitten diesen um einen Akt der Solidarität. Sie nehmen ein Boot und fahren gemeinsam mit ihrem Professor nachts ans Gefängnisfenster, um mit dem Inhaftierten zu sprechen und ihm ihrer Anteilnahme zu versichern. Das Gefängnis liegt an der Spree, die Fenster der Gefängniszellen gehen auf die Spree hinaus. Sie fahren nachts, im Schutz der Dunkelheit, weil die Kontaktaufnahme verboten war, um also dem Auge der Wächter zu entgehen, und begeben sich mit der Fahrt selbst in Lebensgefahr – Hegel und seine Schüler mussten damit rechnen, dass scharf geschossen würde.
Glorifizierung der Moderne
Doch ist Hegels Eintreten für die Revolution nur die eine Seite der Wahrheit. Zu seiner Philosophie gehört zugleich eine andere Seite, die in scharfem Kontrast zur ersten steht: Die Glorifizierung der modernen Herrschaftsverhältnisse, die nun neben den radikalen Befreiungsimpuls tritt.
So entwirft er in den Grundlinien der Philosophie des Rechts von 1820 die Idee eines modernen Staats. Dieser baut zwar auf den Prinzipien von Freiheit und Vernunft auf. Jedoch glorifiziert Hegel darin auch die antidemokratische Seite des modernen Staats. Diesen bezeichnet Hegel als wirklichen Gott, als absoluten Endzweck, dem die Individuen gänzlich untergeordnet sind. Der Staat mag deren Freiheit ermöglichen, doch die letztgültige Wirklichkeit gehört dem Staat, nicht den Individuen. Wenn der Staat etwa im Kriegsfall das Leben fordert, so muss das Individuum es geben. Entsprechend hält er eine Volkssouveränität im Gegensatz zur Regierung für einen verworrenen Gedanken.
Weil die modernen Prinzipien im preußischen Staat damals in vergleichsweise großem Ausmaß umgesetzt waren, galten Hegels Sympathien ab 1815 dem preußischen Staat (zuvor dem napoleonischen, der jedoch untergegangen war). Doch Preußen unterdrückte zu dieser Zeit die erstarkende nationalistische Bewegung autoritär. Besonders nach den Karlsbader Beschlüssen von 1819 wurde die nationalistische Bewegung mit Mitteln wie Zensur, politischer Haft und Entlassungen aus dem Staatsdienst zerschlagen. Hegel bezog dazu keine öffentliche Stellung, und so wurde seine oben zitierte Glorifizierung des modernen Staats auf diese autoritäre Repression bezogen.
Stellung bezog er allerdings gegen die nationalistische Bewegung, die für eine autoritäre Moderne eintrat und von der unter anderem die Hep-Hep-Unruhen ausgingen, die erste deutschlandweite antisemitische Judenverfolgung der Moderne. Für die tatsächliche Freiheitsbewegung, die es auch gab, die für eine liberale Moderne eintrat und sich nicht zuletzt dem antisemitischen Mob entgegenstellte, setzte Hegel sich durchaus öffentlich ein. Auch wenn er sich nicht öffentlich gegen die autoritäre Repressionswelle stellte, die die liberale Bewegung genauso traf, setzte Hegel sich konkret solidarisch für diese ein.
Wie zuerst Marx herausgearbeitet hat, liegen in der Phänomenologie des Geistes „alle Elemente der Kritik verborgen“, andererseits sei diese Kritik selbst schon die „Akkommodation Hegels gegen Religion, Staat etc.“. Diese eigentümliche Spannung zwischen Kritik und Glorifizierung der Moderne durchzieht Hegels gesamtes Werk ab 1807. So tritt Hegel zwar für ein modernes Geschlechterverhältnis ein, indem sich Mann und Frau als freie Individuen gegenübertreten, herausgelöst aus dem Patriarchat und seiner Verschmelzung von familiären Strukturen mit Ökonomie und Staat. Aber es ist doch die heteronormative bürgerliche Kleinfamilie und die Unterordnung der Frau unter den Mann, die Hegel als Sittlichkeit glorifiziert. Ähnliches gilt für seine philosophische Ausarbeitung des Kolonialrassismus: Obwohl alle Menschen als Personen rechtlich anerkannt sein sollen, hält er den modernen Kolonialismus doch für notwendig und Afrika für einen geschichtslosen Kontinent.
Aber wie geht das? Wie kann man für und gegen die Moderne zugleich sein? Zwar beansprucht Hegel diesen Widerspruch zu versöhnen, und sein System ist vielleicht überhaupt der großangelegte Versuch, Freiheit und Gewalt der Moderne in einer umfassenden Vermittlung zu denken. Doch erklären lässt sich der Widerspruch aus der Philosophie selbst nicht. Er rührt vielmehr aus der Politik: dem Schicksal der Französischen Revolution und wie Hegel auf dieses reagiert hat. Um den Widerspruch zu verstehen, müssen wir uns seiner politisch-intellektuellen Biographie zuwenden.
Der revolutionäre Aktivist
Diese beginnt keineswegs mit einem geborenen Philosophen. In seinen Jugendjahren bis etwa 1800 verstand er sich vielmehr als Aktivist und politischer Intellektueller, nicht als Philosoph. Er arbeitete noch keine Philosophie aus, sondern schrieb an Texten, mit denen er politisch-diskursiv intervenieren und zur Revolution beitragen wollte.
Sein Hauptprojekt nach dem Ende seines Studiums im Jahr 1793 war die Ausarbeitung einer „Volksreligion“. Damit meinte Hegel keine Religion im üblichen Sinn, vielmehr kritisierte er das herrschende Christentum und seine Kirchen mit scharfen Worten. Die Volksreligion sollte eine geistig-kulturelle Grundlage für die neue Gesellschaft nach der Revolution schaffen. Seine Frage war: Wie kann verhindert werden, dass die Ideale der Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – bloß abstrakte Ideale der Vernunft bleiben? Wie kann erreicht werden, dass sie Herz und Phantasie der Menschen ansprechen und von ihnen in ihrer tagtäglichen Praxis verankert werden? Hegel versuchte in mehreren Anläufen, diese Volksreligion auszuarbeiten, experimentierte mit verschiedenen Ideen und suchte nach einem Weg, sie politisch zu implementieren. Letztlich war er mit keinem seiner Manuskripte zufrieden und veröffentlichte nichts davon.
Veröffentlicht hat Hegel in dieser Zeit dagegen etwas anderes: die Übersetzung einer Streitschrift aus dem Pays de Vaud in der französischen Schweiz. Deren Autor Jean-Jacques Cart prangert darin die Unterjochung des Pays de Vaud durch die Stadt Bern an und legt die dortigen unfreien und repressiven Zustände offen. Hegel konnte diese aus nächster Nähe beobachten, weil er von 1793 bis 1797 als Hauslehrer in Bern lebte und ihn eine Reise nach Genf auch durch den Pays de Vaud führte. Die Streitschrift – Hegel gab ihr den deutschen Titel Vertrauliche Briefe über das vormalige staatsrechtliche Verhältnis des Waadtlandes (Pays de Vaud) – erschien 1793 auf Französisch und ging damit aus einer Befreiungsbewegung im Pays de Vaud hervor, die seit 1789 versuchte, die Berner Herrschaft abzuwerfen. Bern schlug die Aufstände jedesmal mit entschiedener Repression nieder, und entsprechend war auch Carts Streitschrift verboten. Hegel widersetzte sich also mit seiner Übersetzung, die er um eine Einleitung und um vertiefende Kommentare ergänzte, direkt der Berner Obrigkeit und beabsichtigte damit wohl, der revolutionären Bewegung in der Schweiz zur Seite zu springen.
Wenig später, vermutlich 1797, schrieb Hegel ein revolutionäres Manifest, das bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat. Obwohl es heute als „Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“ bekannt ist, hat dieser Titel nichts mit seinem Inhalt zu tun. Es ist kein Systemprogramm, sondern ein Manifest, das einen revolutionären Neuentwurf von Philosophie, Staat, Kunst und Kultur skizziert. Möglicherweise – das ist unklar – haben auch Hölderlin und Schelling daran mitgearbeitet, geschrieben hat es allerdings Hegel, da sich die Handschrift des Manuskript eindeutig ihm zurechnen lässt.
Auf nur zwei Seiten verdichtet dieses Manifest einige der radikalsten Gedanken der damaligen Zeit. So formuliert es eine radikaldemokratische Kritik am Staat, den es als Maschine, also als Herrschaftsapparat analysiert, der der Freiheit entgegensteht: „Wir müssen also über den Staat hinaus! – Denn jeder Staat muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er nicht; also soll er aufhören.“ Ebenso scharf geht es gegen die Kirche: Alle Priester seien zu verfolgen, die Religion sei im Sinne radikaler Diesseitigkeit grundlegend zu erneuern. Gott und Unsterblichkeit sollen nicht mehr außerhalb der Menschheit gesucht werden, sondern in der „absoluten Freiheit“, also in der radikalen Emanzipation der Menschheit. An die Stelle der Kirche soll eine sinnliche Religion treten (hier greift Hegel seine Überlegungen zur Volksreligion auf), die Volk und Intellektuelle gleichermaßen umfasst und ihren Gegensatz aufhebt. Deren unerhörte Neuigkeit ist dem Autor bewusst: „Zuerst werde ich hier von einer Idee sprechen, die, soviel ich weiß, noch in keines Menschen Sinn gekommen ist – … eine Mythologie der Vernunft.“ Gemeint ist damit keine irrationale Mythologie, sondern die Mythologie soll gerade vernünftig sein: Der höchste Akt der Vernunft ist, so das Manifest, zugleich ästhetisch. Es geht um eine Kulturrevolution, eine neue Lebensweise, in der die Vernunft selbst sinnlich und ästhetisch geworden ist. In gewisser Weise handelt es sich um das erste surrealistische Manifest, über ein Jahrhundert avant la lettre.
Hegel wird Philosoph
In den Jahren nach seinem Studium musste Hegel jedoch erleben, wie der revolutionäre Aufbruch sich ins Gegenteil verkehrte. 1793 schlug die Revolution in die Terrorherrschaft um, die Zehntausende das Leben kostete und zu deren Symbol die Guillotine geworden ist. Ab 1794 sicherte die Republik eine neue kapitalistische Herrschaftsordnung mit der besitzenden Bourgeoisie an der Spitze, die wiederkehrenden Volksaufstände wurden nun militärisch unterdrückt.
Das Scheitern der Revolution strahlte auch auf die revolutionäre Bewegung in Deutschland aus. Hegel war von der Entwicklung entsetzt und verfiel in eine mehrjährige Depression, eine „veritable Lebenskrise“ (Klaus Vieweg), ausgelöst durch die Frustration über den Verlauf der französischen Revolution. Aus einem Brief geht hervor, dass er sich durch wissenschaftliche Arbeit aus dieser Lebenskrise herausgearbeitet hat.
Ab etwa 1797 – in diesem Jahr siedelte er von Bern nach Frankfurt a. M. zu Hölderlin um – versuchte er die Gründe für das Scheitern der Revolution zu verstehen, suchte nach alternativen Wegen ihrer Verwirklichung, verlagerte seine Arbeiten zunehmend auf das Feld der Philosophie. Mehr und mehr schien ihm die Zerrissenheit der Zeit nur durch die Lösung grundsätzlicher philosophischer Probleme zu überwinden zu sein. Spätestens 1800 gab er schließlich sein Selbstverständnis als politischer Aktivist auf. Am 2. November 1800 schrieb er an Schelling, dass sein „Ideal des Jünglingsalters“ sich nun zur Philosophie gewandelt habe. Auf diesen Entschluss, Philosoph zu werden, folgte im Jahr 1801 der Umzug von Frankfurt nach Jena, wo Schelling sich schon eine Weile befand. An der dortigen Universität begann er seine akademische Karriere.
Diese erste Phase seiner Philosophie ist eine Vereinigungsphilosophie: Hegel sah es als die Aufgabe der Philosophie an, Entzweiungen der Wirklichkeit im Denken aufzuheben und die diesen Gegensätzen zugrunde liegende Einheit herauszuarbeiten. Diesem Projekt der Vereinigung ging Hegel in seiner ersten Jenaer Zeit in verschiedenen Anläufen nach. Er war damit zwar nicht mehr direkt in der politischen Praxis engagiert, arbeitete aber an einer kritischen Philosophie, die weiterhin die quasi-politische Aufgabe der Überwindung der Gegensätze zum Ziel hatte.
Napoleon
In dieser Zeit änderten sich die Koordinaten der Französischen Revolution ein weiteres Mal grundlegend. Dies hatte auch auf Hegel und seine philosophische Entwicklung entscheidende Auswirkungen. Am 9. November 1799 putschte Napoleon sich an die Macht und proklamierte offiziell das Ende der Revolution. Er hielt zwar an einigen Ergebnissen der Revolution fest, wie dem modernen bürgerlichen Recht (Stichwort Code Napoléon). Aber er schaffte die Republik ab, setzte eine neue Aristokratie ein und unterwarf in Kriegen weite Teile Europas.
Hegel gelangte in dieser Zeit zu der Einschätzung, dass die Revolution nicht mehr nur vorerst gescheitert war, sondern in ihrem absoluten Anspruch grundsätzlich nicht zu verwirklichen ist. Er kam daher zu dem Schluss, dass die moderne, bürgerliche Herrschaftsordnung die faktische Verwirklichung der Revolution war und es keine weiteren Emanzipationsschritte mehr geben würde, zumindest nicht auf dieser grundsätzlichen Ebene. Mit der Moderne ist gewissermaßen das „Ende der Geschichte“ erreicht – im Bereich der Politik und des Rechts wie auch in anderen Sphären des Geistes.
Seine politischen Sympathien gingen damit auf Napoleon über, den er als den zentralen Protagonisten der Durchsetzung der Moderne gegen das feudale Europa ansah. Hegels politischer Positionswechsel führte ihn damit zur Glorifizierung der Moderne als Herrschaftsordnung, inklusive ihrer gewaltsamer Durchsetzung. 1806 schrieb er in Jena – die Stadt war gerade von Napoleon besetzt worden:
„Den Kaiser – diese Weltseele – sah ich durch die Stadt zum Rekognoszieren hinausreiten; – es ist in der Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einen Punkt konzentriert, auf einem Pferde sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht.“
In seinen philosophischen Veröffentlichungen kommt diese politische Neuausrichtung zuerst in der Phänomenologie des Geistes zum Ausdruck. Sie markiert den Abschluss seiner Jenaer Zeit und den Beginn der zweiten Phase seiner Philosophie, der des Systems, als dessen erster Teil die Phänomenologie in ihrem Übertitel bezeichnet wird. Hegel hört auf, mit der Philosophie letztlich auf eine Veränderung der Wirklichkeit zu zielen, beginnt an einer systematischen Darstellung der neuen postrevolutionären Wirklichkeit zu arbeiten. Sein System stellt sich zwar zweifelsfrei auf die Seite von Vernunft und Freiheit, leitet jedoch auch die Notwendigkeit von Herrschaft und Gewalt philosophisch ab.
Die Moderne und der Terror
Die Phänomenologie stellt dieses Ergebnis der Revolution, die Synthese von Freiheit und Herrschaft, im Kapitel zur Französischen Revolution namens „Die absolute Freiheit und der Schrecken“ dar. Hegel zeichnet darin zugleich seinen eigenen Bildungsweg nach: von der Revolution über deren Scheitern bis hin zur ernüchterten Aufgabe der Emanzipationsansprüche.
Der revolutionäre Aufbruch von 1789 muss, so Hegel in diesem Kapitel, notwendig scheitern, denn er bleibt in seinem absoluten Anspruch auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit letztlich unwirklich und abstrakt. Diese Ideale erlangen nur eine negative Verwirklichung, insofern die soziale Ordnung mit ihren Hierarchien und Trennungen aufgelöst wird. Doch ein positives Werk können sie nicht vollbringen, die absolute Freiheit ist „nur das negative Tun; … nur die Furie des Verschwindens“. Mehr noch: Die Revolution schlägt notwendig in Repression und Terror (deutsch: „Schrecken“, daher die Kapitelüberschrift) um. Denn wer nicht Teil des geeinten Volkes ist, ist ein Feind der Revolution und gefährdet sie. Damit beginnt das Werk der Guillotine, das von Hegel sehr genau beschriebene maschinenmäßige staatliche Töten, das Menschen wie bloßes Material beseitigt.
Weil die Revolution zu keinem positiven Werk außer dem systematischen Töten kommt, gibt sie – so interpretiert Hegel den Verlauf der Französischen Revolution – schließlich ihren absoluten Anspruch auf und stellt die soziale Ordnung in Form einer bürgerlichen Organisation der Arbeit mit modernen Hierarchien wieder her. In ihr sind die Ansprüche der Revolution zwar nicht absolut, aber doch ein Stück weit verwirklicht: Freiheit und Gleichheit haben als formales Recht in der modernen Rechts- und Wirtschaftsordnung Realität erhalten. Durch diese Mäßigung schlagen sie zudem nicht mehr in Terror um, der jedoch als Repression in die neue Ordnung integriert wird – ebenfalls in gemäßigter Form. Notwendig bleibt die Repression, damit sich die Individuen der neuen Ordnung unterwerfen, sich nicht von ihr separieren und sich nicht gegen sie stellen. Die Moderne beruht also nach Hegel auf einem eigentümlichen Doppel von Konsens und Zwang – eine Analyse, die er mit vielen Theoretiker*innen teilt, etwa Antonio Gramsci („Hegemonie gepanzert mit Zwang“). Diese Synthese aus Emanzipation und Repression, die sich als moderne Herrschaftsordnung faktisch durchgesetzt hat, begründet den Hegels gesamtes System durchziehenden Widerspruch zwischen Freiheit und Gewalt, zwischen Kritik und Glorifizierung der Moderne.
Hegel ist in dieser letzten grundlegenden Weichenstellung seines Denkens durchaus selbstkritisch. Wie er in der Phänomenologie kritisch darlegt, war die Vereinigungsphilosophie seiner jungen Jahre kein reales Engagement für die Revolution, sondern lediglich eine Flucht vor den Problemen der Revolution in eine ideelle, bloß seinsollende Harmonie. Sie war eine frustrierte Reaktion auf das Scheitern der Revolution, die Hegel allerdings mit vielen Zeitgenoss*innen in Deutschland teilte. Weil sie weder ihre Vision radikaler Emanzipation aufgeben noch sich die Notwendigkeit des Scheiterns eingestehen konnten, hatten sie versucht, für die Revolution im Denken weiterzukämpfen. Diese Flucht aus der zerrissenen Wirklichkeit in ein Land der moralischen Ideale verändert, so Hegel jetzt, die Welt jedoch nicht: Sie stellt sich die Veränderung der Welt lediglich vor. Im nachfolgenden Kapitel der Phänomenologie zeigt Hegel die Moralität als notwendigen Bestandteil im System der Moderne auf, die dieser erlaubt, sich über ihre eigene Gewalt und Zerrissenheit in eine ideelle Versöhnung zu erheben.
Der Zerfall der hegelschen Schule
Hegel musste die revolutionären Ideale seiner Jugend verraten, weil er keine Möglichkeit mehr sah, sie zu verwirklichen, und blieb ihnen dennoch treu. Beides führte er in einer widerspruchsvolle Synthese zusammen, die es ihm erlaubte, die Moderne als dialektisches System darzustellen. Für diesen Doppelcharakter Hegels, seinem Widerspruch zwischen revolutionärem Aufbruch und zynischer Akkommodation, gibt es keine philosophische Begründung. Er erklärt sich aus seinem politisch-philosophischen Werdegang, nicht zuletzt aus seinen persönlichen Erfahrungen und psychologisch zu erklärenden Reaktionen.
Daher kann Hegels Philosophie auch nur von Hegel selbst wirklich vertreten werden. Ihr Widerspruch wird durch seine Person zusammengehalten. Nach seinem Tod zerfiel der Kreis seiner Schüler bald in zwei Parteien: Während der Linkshegelianismus die Seite der Kritik herausgriff und mit Hegel über die Moderne hinauswollte, knüpfte der Rechtshegelianismus an die Seite der Glorifizierung an. Die hegelsche Schule spaltete sich damit in eben die beiden Seiten des politischen Widerspruchs seiner Philosophie: Die Kritik eines Revolutionärs, dessen Projekt der Befreiung weit über seine eigene Zeit in eine auch für uns noch kommende Zukunft hinausweist, sowie die realistische Darstellung der modernen Herrschaftsordnung in ihrer Notwendigkeit, die sich nicht in eine moralische Illusionen ihre Reformierbarkeit flüchtet. Radikal zeitgemäß ist Hegel nur mit beiden dieser Seiten.
Emanuel Kapfinger ist Philosoph und politischer Autor. Er promoviert über Hegel und Kulturtheorie an der FU Berlin, ist assoziierter Doktorand des Centre Marc Bloch an der HU Berlin und Dozent des Bildungswerks Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Weitere Informationen sowie Veröffentlichungen siehe www.emanuel-kapfinger.net.




