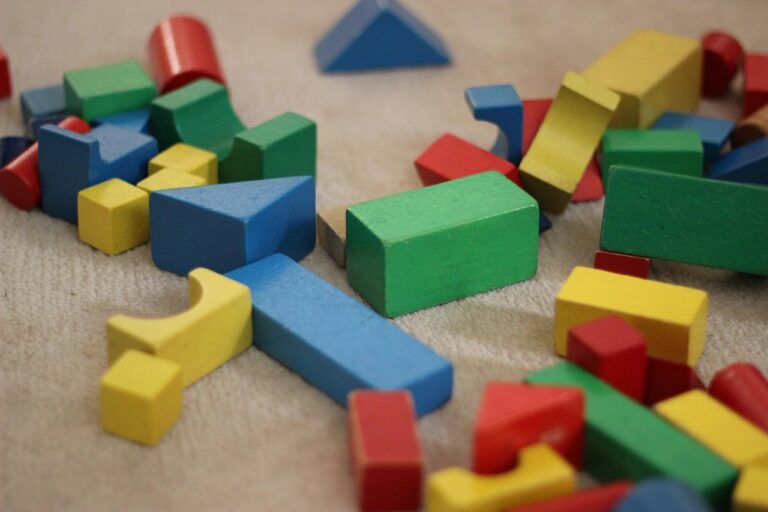Aufklärung, Wissenschaft und „post-truth politics”: Viele Fragezeichen und einige Ausrufezeichen
von Konrad Ott (Kiel)
Als vor Jahresfrist in Russland mehrere Hundert Demonstranten festgenommen wurden, kommentierte der Präsident der Duma, W. Wolodin, dieses Ereignis mit folgenden Worten: „Auf den Straßen Europas löst die Polizei täglich Demonstrationen noch härter auf als dies die russische Polizei tue“ (so die FAZ vom 28. März 2017, S. 1). Meine erste Reaktion war: „Das stimmt nicht, das ist nicht wahr“. Meine zweite Reaktion war: „Naja, ein weiteres Beispiel von ‚post-truth politics‘“. Meine dritte Reaktion: „Oh, ich fange an, mich daran allmählich zu gewöhnen!“. Seither ist es eher noch schlimmer geworden; die Präsidentschaft Trumps ist aber nur die sichtbare Spitze des Eisbergs.
Es scheint, als löse sich die politische Rede von der Bindung an Wahrheit allmählich ab. Unter „post-truth politics“ verstehe ich somit in erster Näherung ein Politikmodell, das die Wahrheitsbindung der politischen Kommunikation aufkündigt (oder Politik von Wahrheit konzeptionell entkoppelt). Dieses neuartige Politikmodell, als dessen ersten Vertreter ich Silvio Berlusconi sehe, hat Erfolge erzielt, mit denen vor Jahr und Tag in Demokratien nicht zu rechnen war. Dass Diktaturen und extremistische politische Parteien diese Wahrheitsbindung nie anerkannt haben, ist bekannt und nicht der Rede wert; verstörend ist der Umstand, dass auch Demokratien von diesem eigentümlich ansteckenden Virus befallen zu sein scheinen. Der „alte“ politische Extremismus glaubte unbeirrt an die Wahrheit seiner Weltanschauung, während neue Politikmodelle und sich um Wahrheit nicht mehr scheren. Darin liegt ein Unterschied zwischen Moderne und Postmoderne.
Timothy Snyder („Über Tyrannei“, 2017) hat auf die Tendenzen zu „post-truth politics“ reagiert: eine seiner „Zwanzig Lektionen für den Widerstand“ behandelt auf emphatische Weise die Wahrheitsbindung der politischen Rede. Snyder (ebd., S. 65): „Die Fakten preiszugeben, heißt die Freiheit preiszugeben. Wenn nichts wahr ist, dann kann niemand die Macht kritisieren.“ Wenn man in Zeiten lebt, in denen solche Sätze wieder geschrieben werden müssen, dann lohnt eine Selbstbesinnung auf geistige Hintergründe der Idee und des geschichtlichen Projektes namens „Aufklärung“, das sich selbst von Anbeginn an unverbrüchlich an die Idee der Wahrheit gebunden hat. Diese Idee besagt, dass wir im Medium von einzelnen Sprachen und „der“ Sprache (zu diesem Verhältnis siehe Richard Hönigswald: „Philosophie der Sprache“, 1937) Zutreffendes („Wahres“) über Sachverhalte und Begebenheiten in einer uns gemeinsamen Welt zu sagen vermögen. Diese Idee gehört nicht einem speziellen Reservat namens „Wissenschaft“, sondern betrifft alle Sphären des Geistes einschließlich der der Politik. Im Folgenden möchte ich folgende These begründen: Eine deliberative Demokratie muss sich gegen alle Formen von „post-truth politics“ zur Wehr setzen. Toleranz und Gewöhnung wären somit die falschen Grundhaltungen.
Dabei gehe ich folgendermaßen vor. Zunächst möchte ich (1) das moralische und politische Problem einer „post-truth politics“ an zwei aktuellen Beispielen diskutieren. Danach möchte ich (2) auf die bedeutsame Schrift von Harry Frankfurt eingehen, um das Problem der Gegensätze von Wahrheit zu schärfen: „On Bullshit“ (2005). Anschließend (3) reflektiere ich auf das Verhältnis von Wahrheit und Politik. Ich werde im Hauptteil des Essays (4) folgende „klassische“ Stationen des Denkens über Wissenschaft und Aufklärung behandeln: a) Immanuel Kants Aufklärungsschrift, b) Max Webers Werturteilsfreiheitsthese, c) die „Dialektik der Aufklärung“ von Horkheimer und Adorno, d) die Theorie der Geltungsansprüche bei Jürgen Habermas, e) philosophische Wahrheitstheorien und f) radikal wahrheitsskeptische Tendenzen innerhalb der heutigen Wissenschaften und auch der politischen Philosophie. Der letzte Punkt ist wichtig, da das obige Zitat von Snyder einen naiven realistischen Wahrheitsbegriff vorauszusetzen scheint, den viele als „unhaltbar“ ansehen werden. Es soll deutlich werden, dass die Ablösung von der Wahrheit unterschiedliche Formen annehmen kann. Ich möchte zuletzt (5) einige handlungsleitende Punkte thesenhaft festhalten.
1. Zwei Beispiele
Erdogan über Srebrenica
Im Gefolge der diplomatischen Krise zwischen der Türkei und den Niederlanden anno 2017 sagte der türkische Präsident Erdogan am 14. und 15. März folgendes (so die Übersetzung): „Wie verdorben ihre Natur und ihr Charakter ist, wissen wir daher, dass sie dort 8000 Bosniaken ermordet haben“. In genauerer Übersetzung aus dem Türkischen[1] heißt es: „Diese (gemeint sind Niederländer*innen, KO) haben mit der modernen Welt nichts zu tun. Sie haben in Srebrenica über 8000 Moslems massakriert. Wir kennen ihren Charakter.“ Es gibt mehrere Varianten der Äußerung Erdogans, die aber allesamt eine aktive Beteiligung der niederländischen Blauhelm-Soldaten an dem schwersten Kriegsverbrechen seit 1945 insinuieren bzw. diesen diese Beteiligung schuldhaft anlasten. Erdogan verbindet eine moralisierende Aussage über einen Volkscharakter mit einer wahrheitswidrigen Aussage über ein geschichtliches Vorkommnis, über dessen moralische Bewertung Einigkeit herrscht. Das Problem von Aussagen über Volkscharaktere setze ich außer Betracht. Ich setze allerdings voraus, dass die zitierten Sätze wirklich gefallen sind, d.h. ich unterstelle, dass ich von unseren Presseorganen wahrheitsgemäß informiert worden bin, d.h. dass „post-truth politics“ noch nicht total ist.
Die niederländischen Blauhelmsoldaten haben – so die meistvertretene Interpretation der Ereignisse – die damalige Lage völlig falsch eingeschätzt, sie haben ihr Mandat viel zu defensiv ausgelegt, sich von den serbischen Protagonisten täuschen lassen und haben sich infolgedessen kampflos zurückgezogen, wo sie hätten einschreiten müssen, aber sie waren an dem Massenmord an den bosniakischen Muslimen nicht aktiv beteiligt. Sie haben das Morden nicht verhindert, aber nicht getötet – and that’s a difference that makes a moral difference. Der Schluss Erdogans von einer wahrheitswidrigen Behauptung auf einen Volkscharakter ist abwegig.
Erdogans Behauptung über eine aktive Beteiligung von Niederländern an dem Massaker ist also wahrheitswidrig, d.h. sie entspricht nicht den Tatsachen. Einen derartigen Satz über korrekte Beziehungen von Sätzen auf (vergangene) Ereignisse (Vorkommnisse, Sachverhalte) muss ich jetzt allerdings geltend machen dürfen. Wenn nicht, hat „post-truth politics“ schon gewonnen. Nun könnte „post-truth politics“ Anleihen bei der erkenntnistheoretischen Skepsis machen, die seit der Antike die Möglichkeit wahrer Erkenntnis und wahrer Aussagen prinzipiell angezweifelt hat. Eine Verbindung aus Skeptizismus und „post-truth politics“ erscheint kohärent.
Aus der Perspektive einer Theorie der Geschichtswissenschaft gesagt, kann die Geschichte nicht beliebig „umgeschrieben“ werden. Wir können zwar neue Forschungsperspektive auf die Geschichte richten und unser „verstehendes Erklären“ kann sich verändern. Gleichwohl sträuben sich die Quellen als „Zeugnisse“ dessen, was geschah, gegen die Beliebigkeit von Erzählungen. Wäre dem anders, könnten wir nicht zwischen Historie und historischen Romanen unterscheiden.
Moralisch gesagt, diffamieren wahrheitswidrige historische Aussagen zum einen die fälschlich Beschuldigten. Aber das ist noch nicht alles. Von Walter Benjamin stammt der Gedanke einer anamnetischen Solidarität, die allen Opfern der Geschichte gilt. (Vielleicht ist diese anamnetische Solidarität mit den Opfern der tiefste Grund, warum wir Deutschen die Leugnung der Shoa als Straftatbestand einstufen.) Die Opfer haben einen eigentümlichen moralischen Anspruch, dass die Geschichten, die wir über sie erzählen, keine „fakes“ sind. Wer solche „fakes“ produziert, setzt in gewisser Weise das Unrecht fort. Die wahrheitswidrige Aussage diffamiert die Lebenden und sie schändet die Opfer.
Chemnitz 2018
In Chemnitz wurde, so der derzeitige Stand der polizeilichen Ermittlungen am frühen Morgen des 2. August 2018 ein deutscher Staatsbürger von zwei oder drei Asylbewerbern mit Messerstichen getötet. Am Sonntagnachmittag und –abend kam es im Gefolge der Tat zu Demonstrationen und Aufläufen, bei denen es zu, sagen wir vorsichtig, tätlichen Übergriffen auf Menschen mit Migrationshintergrund kam. In den Medien war noch am gleichen Tag ein Video zu sehen, das Pöbeleien und einen tätlichen Angriff zeigte. Tage später erklärte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Maaßen, in einem Zeitungsinterview folgendes: „Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken.“ Abgesehen davon, dass die Polizei wegen Totschlag, nicht wegen Mordes ermittelt, ist es beachtlich, dass der Präsident einer Behörde, der man Informationskanäle zutraut, die einfachen Bürger*innen unzugänglich sind, die Echtheit dieses Videos anzweifelt. Wenige Tage später korrigiert Maaßen seine Position dahingehend, dass er nur habe sagen wollen, dass aus dem Video nicht auf „Hetzjagden“ geschlossen werden könne.
Allerdings vermischen sich hier in den Aussagen zwei Themen auf eine Weise, die der politischen Debatte unzuträglich sind. Einmal geht es um die Authentizität des fraglichen Videos, zum anderen um die Wortwahl, d.h. die angemessene Beschreibungssemantik der Vorfälle des Sonntagnachmittags. Sollen wir Vorfälle terminologisch als „Hetzjagden“, „Pogrome“, „Mob“ oder „Ausschreitungen“, „Übergriffe“, „Pöbeleien“ oder anders bezeichnen? Hält man beide Themen (Authentizität, Beschreibungssemantik) säuberlich auseinander, können wir ein aufgeklärtes Niveau der politischen Debatte auch angesichts emotional aufwühlender Vorkommnisse beibehalten. Wir fragen dann einerseits nach den Gründen, die für oder wider die Authentizität eines Videos sprechen, andererseits nach den Gründen, aufgrund derer wir eine bestimmte wertbesetzte und moralaffine Semantik für (un)angemessen halten. Es mag dann erlaubt sein, zu sagen, es habe keine Hetzjagden, keinen Mob und keine Pogrome „gegeben“, wie dies der Ministerpräsident von Sachsen ausdrückte. Dies kann man mit neuen Belegen bestreiten. Vermischen und vermengen wir beide Themen, so öffnen wir den Weg in Richtung „post-truth politics“.
2. Harry Frankfurt „On Bullshit“
Frankfurt möchte in seinem kleinen Buch „On Bullshit“ (Princeton University Press 2005) zeigen, dass es außerhalb der Lüge andere wahrheitswidrige Redeweisen gibt. Die Lüge, definiert als absichtliche Äußerung wahrheitswidriger Tatsachen (Sachverhalte), ist gewissermaßen ein einfacher Standardfall innerhalb eines Spektrums solcher Umgangsweisen mit Sprache. Die Lüge mitsamt der ihr zugrundeliegenden Absicht steht kontradiktorisch zur Wahrheit; andere Sprechweisen stehen konträr zu ihr. Es gibt Humbug, Übertreibungen, Verdrehungen, Bezichtigungen, leeres Gerede, Phrasendrescherei, Dampfplauderei, Schönrednerei, „phony-ness“ und nicht zuletzt eben auch „bullshit“. Diese wahrheits-konträren Redeweisen sind in der politischen Debatte so beliebt, weil die, die so reden, sich gegen den Vorwurf der Lüge verwahren können. In der Lüge liegt nicht das Problem von „post-truth politics“.
Der Lügner achtet Frankfurt zufolge noch die Wahrheitsbindung der Rede als Erfolgsvoraussetzung der Lüge, wohingegen dem „bullshiter“ die Wahrheit gleichgültig ist. „The lack of connection to a concern with truth – this indifference to how things really are – that I regard as of the essence of bullshit“ (2005, S. 33f). Dem “bullshiter” ist Wahrheit „egal“, er/sie will nur mit “bullshiting” durchkommen, d.h. irgendwelche Erfolge einstreichen. „Bullshit“ ist daher begrifflich bestimmt als die Unbekümmertheit um Wahrheit. Bullshit is „a matter not of falsity, but of fakery“ (a.a.O., S. 47). Der „bullshiter“ setzt unbekümmert alle möglichen Behauptungen in die Welt, ohne sie verantworten zu wollen. Bullshiting, so Frankfurt, „is a greater enemy of the truth than lies are” (a.a.O., S. 61). Der „bullshiter“ lässt sich nie auf eine Argumentation ein über das, was er sagt, sondern produziert unaufhörlich „statements“, wechselt sprunghaft die Themen, assoziiert oder wiederholt Behauptungen bloß.
Das Wechseln der Themen verhindert einen diskursiven Modus der Themenbearbeitung, an dem „bullshiter“ kein Interesse haben. Man erkennt „bullshiter“ daran, dass sie Themenkonstanz scheuen wie Vampire den Knoblauch. Mit einem „bullshiter“ von Thema zu Thema zu hüpfen, heißt, ihm hinterher zu hecheln ohne Aussicht, mit ihm ein Thema jemals vertiefen zu können. Nun ist das „switching“ im Bereich der alten und neuen Medien ein weit verbreitetes Verhaltensmuster geworden. Wer selbst ständig „switching“ betreibt, dem kommt die Problematik ständigen Themenwechsels womöglich gar nicht mehr zum Bewusstsein. Das Redeverhalten des „bullshiter“ wirkt womöglich „flexibel“.
Der „bullshiter“ setzt außerdem darauf, dass Wiederholungen die Wirkungen zeitigen, die sie, logisch betrachtet, nicht zeitigen dürfen. Snyder bezeichnet dies im Anschluss an Victor Klemperer als einen „schamanistischen“ Umgang mit der Sprache (2017, S. 66). Wenn ich p behaupte, kann ich p nicht begründen, indem ich p wiederhole. Die Wiederholung unbelegter Behauptungen über unterschiedliche Medien und Kanäle ist high-tech-Schamanismus. Die neuen Medien scheinen, so gesehen, wie geschaffen für „fakery“ aller Art. Wir müssen sie im Interesse an Aufklärung stärker als bisher als Medien der Gegenaufklärung begreifen. Wer die neuen Medien so nutzt, hofft, dass Wiederholungen perlokutionäre Effekte zeitigen, d.h. dass schon etwas „hängenbleibt“.
Frankfurt rückt „bullshitism“ nahe an das „bluffen“, das beim Pokerspiel üblich ist (2005, S. 45). Mit einem „bluff“ kann man aber nur dann erfolgreich sein, wenn der andere sich „bluffen“ lässt. Darauf muss der „bullshiter“ wetten und damit geht er ein Risiko ein. „Bullshiting“ ist eine Wette darauf, die Karten nicht aufdecken, d.h. nicht argumentieren zu müssen. Wir müssen also antizipativ überlegen, wie man sich von „bullshit“ nicht „bluffen“ lässt. Darauf komme ich am Ende zurück.
Ich setze im Folgenden mit Frankfurt voraus, dass die Menge der wahrheitswidrigen Redeweisen mehr Elemente beinhaltet als nur die Menge der Lügen. Sie umfasst in jedem Falle „bullshiting“, dürfte aber noch weitere Elemente und Teilmengen aufweisen. Eine präzise sprachtheoretische Bestimmung dieser Menge wäre eine wichtige Komponente einer Kritik an “post-truth politics“.
Wahrheit und Politik
Nun könnte man fragen, warum sich die Wissenschaften und die Philosophie überhaupt daran stören sollten, wenn in der Sphäre des Politischen „post-truth politics“ vermehrt auftritt. Mit Niklas Luhmann könnte man die Subsysteme von Wissenschaft und Politik anhand ihrer jeweiligen Codes separieren: Wahrheit/Falschheit für die Wissenschaften, Macht/Opposition für die demokratische Politik. Oder man könnte mit Max Weber sagen, in der Wissenschaft seien Begriffe Pflugscharen zur Lockerung des Erdreiches des Geistes, in der Politik seien sie Schwerter zur Bekämpfung von Gegnern. Politische Rede, so könnte man hinzufügen, diene nicht der Wahrheitsfindung, sondern auch in Demokratien der Gewinnung einer Mehrheit der Stimmen des Wahlvolkes. Wahlkämpfe seien nun einmal keine Veranstaltungen zur Wahrheitsfindung, sondern eher der Werbung verwandt. Kandidat*innen für politische Ämter konkurrierten so ähnlich um die Gunst des Wahlvolks wie Waren um die Gunst der Konsument*innen konkurrierten. So sagt es auch die ökonomische Theorie der Demokratie. Und so, wie die Werbung auf Psychologie rekurriert, rekurriert die politische Rhetorik seit der Antike auf die Lehre von den Redefiguren, angefangen von der „capatatio benevolentia“ bis hin zum „ornatus in verbis conjunctis“. Politische Rede sei, so gesehen, von Hause aus polemisch, persuasiv und agonal; die Kunst der Rhetorik sei seit der Antike immer auf die Effekte ausgerichtet gewesen, die ein durch Sophisten geschulter Rhetor bei einem Auditorium erzielen kann.
Und kennen wir nicht aus der Geschichte der Politik vielfältige Formen der Intrige, der Irreführung, der gezielten Desinformation, des Streuens von Gerüchten bis hin zur Gräuelpropaganda im „phony war“? Schon für Aristoteles war die Demagogie der Schwachpunkt der Staatsform der Demokratie. Der demagogische Rhetor hat das Ziel, die Massen in seinen Bann zu ziehen, an ihre Gefühle zu appellieren, ihnen große Ziele vor Augen zu führen, ihre Begeisterung zu wecken und sie zum Engagement zu motivieren. Weder Machiavelli noch Gracian banden politische Rede an Wahrheit. Machiavelli schreibt: „Denn der Pöbel hält sich immer an den Schein und den Erfolg; und in der Welt gibt es nur Pöbel“ („Der Fürst“, Kap. XVIII). Das 20. Jahrhundert bietet Musterbeispiele politischer Propaganda.
In diesem Sinne ist „post-truth politics“ allerdings nichts Neues, sondern hat Geschichte. Die ethisch entscheidende Frage für unsere Gegenwart ist, ob und inwieweit man wahrheitswidrige Redeweisen i.w.S. in der Sphäre des Politischen toleriert oder nicht. Können die Staatsräson, das Parteiinteresse oder die Angst vor dem Erstarken bestimmter politischer Strömungen wahrheitswidrige Redeweisen für uns rechtfertigen könnten. Wenn wir über „post-truth politics“ nachdenken, denken wir nicht über Athen oder Florenz nach, sondern über die westlichen Massendemokratien am Beginn des 21. Jahrhunderts.
Viele von uns würden den agonalen Auffassungen des Politischen auf der Ebene der Faktizität politischer Kommunikation ein Wahrheitsmoment zubilligen, sie aber nicht als idealtypische Position mit allen Konsequenzen in die politische Philosophie und in die politische Praxis übernehmen wollen. Denn welche Hindernisse gäbe es dann noch wider eine implizite Rechtfertigung des „Abdriftens“ der politischen Rede auf einem „slippery slope“ in Richtung Demagogie, Propaganda und eben „post-truth politics“?
Dieses zunächst nur intuitiv geäußerte Unbehagen an der Aufkündigung des Wahrheitsbezuges durch „post-truth politics“ muss sich begründen lassen. Mein leitender Gedanke ist, dass das Projekt der Aufklärung mitsamt der Wahrheitsorientierung die Praxisfelder von Wissenschaft und Politik und unsere kommunikative Alltagspraxis überspannt. In einem sittlichen Gemeinwesen darf es daher keine Sphäre geben, in der wahrheitswidriges Reden legitim ist. (Den Grenzfall der Kunst setze ich außer Betracht.) Die Rede vom „Projekt der Aufklärung“ will dabei besagen, dass Aufklärung mehr ist als eine philosophische Epoche. Aufklärung ist eine Daueraufgabe.
3. Stationen aufklärerischen Denkens
Als philosophische Epoche datiert man die Aufklärung in das 17. und 18. Jahrhundert. Voltaire und die Enzyklopädisten sind Frontmänner der französischen Aufklärung, die aber schon damals ein europäisches Projekt ist. Die Aufklärung wendet sich gegen autoritativ gebundenes Denken. Die Freiheit des Denkens soll gesellschaftlichen und politischen Ordnungen zugutekommen, die nicht vernunftwidrig sind. Aufklärung ist „anti-autoritär“ (und mündet in die Revolution von 1789). Schon in der Epoche der Aufklärung werden im Geiste der Aufklärung die Beschränktheiten bestimmter aufklärerischer Konzepte kritisiert. Aufklärung ist gleichsam „ab ovo“ selbstreflexiv. (Hierzu immer noch lesenswert: Jochen Schmidt (Hg.): „Aufklärung und Gegenaufklärung in der europäischen Literatur, Philosophie und Politik von der Antike bis zur Gegenwart“, 1989.)
Immanuel Kant: Zur Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?
Für Kant ist Aufklärung, definitorisch gefasst als „Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit“, ein gemeinschaftliches Unternehmen auf Gegenseitigkeit. Für Kant fehlt es nicht an Verstand, sondern an Mut, sich seiner ohne Leitung anderer zu bedienen. Daher: „Sapere aude!“. Es sind bei Kant Gelehrte, die von ihren Verstandeskräften angesichts unterschiedlicher Themen einen öffentlichen Gebrauch machen und sich dabei in sprachlicher Form an ein interessiertes Publikum wenden. Redner bzw. Autoren und Publikum bilden dabei eine Verständigungsgemeinschaft, die unter dem „transzendentalen Prinzip der Publizität“ (Kant) steht. Der Ausdruck „transzendental“ bezieht sich bei Kant auf Bedingungen der Möglichkeit von etwas. „Publizität“ ist demnach eine Bedingung der Möglichkeit gemeinschaftlicher Aufklärung in einer Sphäre der Öffentlichkeit. Publizität wiederum ist ohne Wahrheitsbezug nicht zu haben. „Post-truth politics“ untergräbt daher in kantischer Perspektive ein transzendental einsichtiges Prinzip, d.h. sie arbeitet den Erfolgsbedingungen von gemeinschaftlicher Aufklärung entgegen. In der Friedensschrift heißt es daher: „Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, sind unrecht.“ Wenn es ein moralisches Anrecht eines/einer jeden gibt, an dem gemeinsamen Projekt der Aufklärung mitzuwirken und teilzunehmen, das unter dem transzendentalen Prinzip der Publizität steht, dann verletzen die Maximen, die hinter „post-truth politics“ stehen, dieses Recht. Damit sind sie für Kantianer der Moralität zuwider.
Was Kant ebenfalls voraussetzt, ist die Unterscheidung zwischen der theoretischen und der praktischen Vernunft. Die theoretische Vernunft bezieht sich auf Wissen und seine Grenzen (etwa in der Religion), während sich die praktische Vernunft mit den Imperativen des Handelns beschäftigt. Kant unterscheidet hierbei zwischen Regeln der Geschicklichkeit, Ratschlägen der Klugheit und Geboten der Moralität. Letztere werden vom Kategorischen Imperativ regiert, der einsichtig aus reiner praktischer Vernunft und daher für alle möglichen Vernunftwesen gültig ist. In metaethischer Sprache: Kant ist „Prinzipienkognitivist“. Die kantsche Ethik steht damit paradigmatisch für die Suche nach umfassender praktischen Vernunft, die bei Kant – wie in der Schrift „Zum Ewigen Frieden“ – auf das Gebiet der Politik reicht. Die „weltbürgerliche“ Perspektive von Kants politischer Philosophie impliziert, dass ein Unrecht, das an bestimmten Orten begangen wird, an allen Orten als solches verspürt wird. Der begrenzten Öffentlichkeit eines europäischen Lesepublikums des 18. Jahrhundert wohnt eine eigentümliche „Transzendenz von innen“ (Jürgen Habermas) hin zur Weltöffentlichkeit inne. Deshalb sind wir alle von „post-truth politics“ betroffen, von welchen Orten sie auch immer ausgehen mag.
Werturteilsfreiheit bei Max Weber
Max Weber hat die Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Vernunft in seinen berühmten Schriften über die Werturteilfreiheit der Wissenschaft und in den Essays über Wissenschaft und Politik als Beruf zugespitzt. Weber sagt nicht, dass die Wissenschaften faktisch werturteilsfrei sind; er sagt auf der Ebene der „quaestio facti“ das Gegenteil. In Historie und Volkswirtschaftslehre, in Biologie und Soziologie wimmelt es von impliziten Werturteilen aller Art. Weber kannte bspw. den Sozialdarwinismus und den „wissenschaftlichen Sozialismus“ marxistischer Prägung. Weber hat übrigens auch nicht gefordert, dass Wissenschaftler sich der Werturteile enthalten sollten, wenngleich er eine Art Kritik der Kathederwertung vornimmt (hierzu und zum Folgenden Konrad Ott: „Ipso Facto“, 1997, Kap. 3). Vom Katheder aus soll der Professor in der Vorlesung seine Zuhörer nicht mit seinen Wertvorstellungen traktieren, weil er eine privilegierte Sprecherrolle innehat und, zumindest zu Webers Zeiten, der Hörsaal ein Ort war, in dem alle bis auf einen zum widerspruchslosen Zuhören-Müssen verurteilt waren.
Weber treibt die Aufklärung durch Wissenschaft bis zu einer Selbstaufklärung der Wissenschaften über ihre unterschiedlichen Wertbezüge und über ihre Grenzen. Die Explikation und kritische Prüfung dieser Wertbezüge kommt letztlich der Idee der Wahrheit zugute, die von trüben und undurchschauten Vermischungen mit Werten gereinigt werden – und zwar so, dass beide Seiten der Unterscheidung zu ihrem Recht kommen. Theoretische und praktische Vernunft sollen sich weder diffus durchmischen noch äußerlich und abstrakt entgegenstehen. Weber ist auch kritisch gegen die Prätention der Allwissenheit von Wissenschaft. Die Wissenschaft klärt Gesellschaft auch darüber auf, wozu sie außerstande ist: Sie kann nur hypothetisch raten, sie beantwortet keine letzten Sinnfragen und sie tröstet nicht über die Endlichkeit des Lebens. Sie klärt uns auch darüber auf, dass sie nicht zu sagen weiß, wie wir leben sollen. Sie lebt mit disziplinären Dissensen, Schulbildungen, Unsicherheiten von Prognosen, fragwürdigen Annahmen in Modellen und vielem mehr.
Aufgabe jedes Wissenschaftlers ist es, sich und den Adressaten seiner Rede Rechenschaft zu geben über die „haarfeine Linie“ (Weber), die Seinsaussagen von Sollensforderungen trennt. Aus einem Sein lässt sich logisch kein Sollen deduzieren (Humes Gesetz) und der Ausdruck „ist (moralisch) gut“ lässt sich niemals zweifelsfrei durch empirische Prädikate definieren (Moores Gesetz). Das Sollen gehört einer anderen Geltungssphäre an. Bei Weber verbindet sich in der Haltung „intellektueller Redlichkeit“ (Weber) ein scharfes Bewusstsein von der Differenz zwischen Sein und Sollen mit einer soziologischen Skepsis hinsichtlich der Wahrheitsfähigkeit von Soll-Sätzen. Im Unterschied zu Kant ist Weber metaethischer Nonkognitivist. Angesichts des extremen Wertpluralismus‘ seiner Zeit (Anarchismus, Sozialdarwinismus, Marxismus, Liberalismus, Lebensreform, Nationalismus, Rassismus usw.) vertrat Weber eine Art existentialistischen Dezisionismus. Die höchsten Wertaxiome lassen sich für Weber nicht mehr rechtfertigen (denn woraus sollten sie sich ableiten lassen?), sondern nur noch bewusst wählen und durch den Lebensvollzug beglaubigen. Der Streit der Moralen und ihrer Reflexionsformen, der Ethiktheorien, bleibt auf ewig „unaustragbar“ (Weber).
Weber hatte allerdings noch Doktrinen und Ideologien vor Augen, die auf Prinzipien gründeten. Ob dies im Falle von „post-truth politics“ noch der Fall ist, ist fraglich. Es könnte auch sein, dass autoritäre Politikmodelle nur noch in Machtkategorien denken. Postideologische Machtpolitik, fast unverhüllter Zynismus und „post-truth politics“ wären eine Fusion, die man „nihilistisch“ nennen könnte.
Kritische Theorie
1944 übergeben Max Horkheimer und Theodor Adorno ihren Mitarbeitern eine hektographiere Schrift unter dem Titel „Dialektik der Aufklärung“, die zum Kultbuch der 68er-Generation wurde. Die These der Schrift lautet, dass im Prozess der Aufklärung selbst Tendenzen zu einer „Selbstzerstörung der Aufklärung“ (1944 bzw. 1947 bzw. 1986, S. 3) am Werke sind, dass also Aufklärung nicht nur von außen unterdrückt wird, sondern sich von innen heraus selbst dementiert. Nur so ist zu erklären, dass die „vollends aufgeklärte Erde im Zeichen triumphalen Unheils erstrahlt“. Die Schrift gilt der Aufdeckung dieser „retardierenden“ Momente, die in den Rückfall in neue Mythologien einmünden. „Nimmt Aufklärung die Reflexion auf dieses rückläufige Moment nicht in sich auf, so besiegelt sie ihr eigenes Schicksal“ (S. 3). Momente dieser Selbstzerstörung sehen Horkheimer/Adorno u.a. innerhalb der Wissenschaften bspw. in einem Nominalismus und Positivismus, in die Reduktion von Natur auf „Objektivität“, in der Produktion von Destruktionskräften, in Kulturindustrie und nicht zuletzt in der Dominanz von Konzepten zweckrationaler bzw. instrumenteller Rationalität, d.h. im Vernunftbegriff selbst. In diesen Konzepten werden Ziele beliebig gesetzt und sind der vernünftigen Beurteilung entzogen; der Verstand beurteilt bloß noch Effektivität und Effizienz der einzusetzenden Mittel. Konzepte zweckrationalen Handelns sind auch heute noch in der Ökonomik und der analytischen Handlungstheorie weit verbreitet. Aus der Perspektive instrumenteller Vernunft ist „post-truth politics“ ein mögliches Mittel zum Zweck.
Die sich auf unterschiedliche Weise vollziehende Selbstzerstörung der Aufklärung ist ein eminentes Politikum; die Formen zynischer Manipulation korrespondieren mit der „rätselhaften Bereitschaft der technologisch erzogenen Massen, in den Bann eines jeglichen Despotismus zu geraten“ (a.a.O., S. 3.). Im höchst aktuellen Kapitel über die Kulturindustrie, das aus den Erfahrungen in Los Angeles hervorging, zeigen Horkheimer und Adorno, wie Mixturen aus „entertainment“, „show business“, „scripts“, „short stories“, Aufwertung von Belanglosigkeiten, „Star-Kult“ und impliziten politischen Botschaften fabriziert werden, in denen Wahrheit nicht direkt bestritten wird, sondern allmählich untergeht. Dem Publikum wird durch Kulturindustrie das Interesse an Wahrheit genommen. Auf dem heutigen Boden von „reality shows“ und „infotainment“ gedeiht „post-truth politics“. Irgendwann suchen wir auch in der Politik nach dem „Superstar“.
Es ist vielleicht kein Zufall, dass Snyder (a.a.O., S. 79) den kritischen Zeitungsjournalismus fordert, den Trump tagtäglich beschimpft und bekämpft. Snyder berichtet von einer spontanen Reaktion Donald Trumps auf einer Wahlveranstaltung (a.a.O., S. 44), als Gegendemonstranten unter lautstarken „USA“-Rufen der Trump-Anhängerschaft unsanft aus dem Saal bugsiert wurden: „Der Kandidat rief dazwischen: ‚Ist das nicht viel lustiger als eine ganz normale langweilige Wahlveranstaltung? Für mich ist das ein Riesenspaß.‘“ Horkheimer/Adorno: „Fun ist ein Stahlbad.“ (a.a.O., S. 149).)
Theorie des kommunikativen Handelns
In der „Dialektik der Aufklärung“ fehlt ein Kapitel über die sprachlichen Formen, an denen die Selbstzerstörung der Aufklärung sich ablesen ließe. Der „linguistic turn“ wird in der ersten Generation der Kritischen Theorie nicht nachvollzogen; er kommt dafür in der zweiten Generation zu umso größeren Ehren. Habermas rekonstruiert in der „Theorie des kommunikativen Handelns“ (1981) die Geltungsbasis der menschlichen Rede unter dem (sprechakttheoretisch begründeten) Satz: „Verständigung ist das Telos der Rede“. Die Geltungsdimension von a) Wissenschaft und Technologie („Wahrheit“), b) Recht und Moral („Richtigkeit“), c) Kunst und Therapeutik („Aufrichtigkeit“) werden analytisch unterschieden (und sozialen Systemen zugeordnet), sie sollen aber für Habermas in einer aufgeklärten Alltagskultur wie ein Mobile ineinandergreifen. Einzelne Subsysteme spezialisieren sich zwar auf die Bearbeitung bestimmter Geltungsbezüge, aber gerade in der Sphäre der Politik, genauer: in einem Modell von deliberativer Demokratie, die auf den Prinzipien der Inklusion und der Argumentation beruht, müssen die Geltungsdimensionen sich ineinander verschränken können. Gemäß der „Theorie des kommunikativen Handelns“ ist es ausgeschlossen, die Sphäre der normativen Richtigkeit diskursiv zu pflegen und die Wahrheitsorientierung propositionaler Rede aufzugeben. Die Aufgabe der Wahrheitsbindung affiziert auch praktische Diskurse, vernünftige Rede über Werte und sogar ästhetische Kritik.
Demokratie ist weder angewandte Wissenschaft noch angewandte Moral, sondern eine gemeinsame geschichtliche Praxis der Beurteilung regelungsbedürftiger kollektiver Materien, die reflexiv zu einem umfassenden politischen Selbstverständnis führt („Verfassungspatriotismus“). Die regulative Idee von Diskursivität übergreift auch die Sphäre des Politischen, wenngleich sich politische Debatten von reinen wissenschaftlichen oder moralischen Diskursen dadurch unterscheiden, dass die Menge der zulässigen Gründe größer wird. In politischen Debatten dürfen Kostenkalküle, partikulare Traditionen, Risikoeinschätzungen, außenpolitische Rücksichten, Rücksichten auf Minderheiten usw. eine Rolle spielen. Der erweiterte Pool der Gründe, die politisch „zählen“, schließt in vielen Fällen strikte Konsense aus. In diesem Sinne sind politische Fragen Streitfragen. Der politische Streit darf jedoch nicht regellos sein und er darf nicht als Kampf zwischen unversöhnlichen Feinden konzipiert werden, wie dies bei Carl Schmitt geschieht („Der Begriff des Politischen“). Wird Politik als Kampf zwischen Feinden verstanden, ist politische Rede ein Mittel im Kampf. Daran ändert sich nichts Grundsätzliches, wenn der Kampf marxistisch als Klassenkampf gedacht wird. Deshalb sind politische Philosophien, die Carl Schmitt und Karl Marx fusionieren, anfällig für „post-truth politics“ auch dann, wenn sie sich selbst als „radikale Demokratietheorie“ bezeichnen.
Deliberative Demokratie ist der Idee der politischen Aufklärung verpflichtet, da sie (vgl. hierzu Habermas: „Faktizität und Geltung“, 1992, Kap. VIII) von formell intakten Kommunikationsflüssen zwischen a) einem professionalisierten Kernbereich des politischen Systems, b) einem Geflecht von intermediären Institutionen (staatliche Ämter, Gremien der wissenschaftlichen Politikberatung, Büros wie TAB, Verbände usw.) und c) einer aktiven und in Verbänden und Parteien organisierten zivilen Bürgerschaft ausgeht. Innerhalb demokratischer Praxis werden wir häufig zu der Einsicht kommen, dass wir abstimmen oder verhandeln müssen; gleichwohl ist die Beurteilungspraxis zunächst an das Beibringen von Gründen gebunden. Die Mehrheitsregel bei Abstimmungen und das Finden (fairer) Kompromisse gehören zum politischen Geschäft, sind aber nicht die „Quintessenz“ demokratischer Politik. Dies ist der Austausch von Gründen unter Staatsbürger*innen, wobei der „Pool der Gründe“ bei politischen Fragen recht umfänglich ist. Eine elementare Diskursregel gilt auch in politischer Rede: „Jede und jeder darf nur das sagen, woran sie/er selbst glaubt“.
Ohne ein wechselseitiges Grundvertrauen hinsichtlich der Arten und Weisen, in denen sich der Austausch der Gründe vollzieht, kann deliberative Demokratie nicht gelingen. Die klassische Zensur unterbindet Deliberation durch staatliche Verbote. Sie ist in der Verfassung des Grundgesetzes verboten (Art 5 (1)). „Post-truth politics“ ist, wenngleich auf andere Weise als direkte Zensur, mit den Gelingensbedingungen komplexer Deliberationen nicht vereinbar, sondern in einem strengen Sinne „dysfunktional“. Die Zensur fürchtet die freie Meinungsäußerung und versucht sie zu unterbinden. „Post-truth politics“ nutzt die Meinungsfreiheit schamlos und unbekümmert aus. Meinungen sollen frei flottieren; nach der Qualität von Meinungen soll nicht gefragt werden. Wahrheitswidrige Meinungen sind zumeist legal und kaum justiziabel. Daher ist „post-truth politics“ mit den Mitteln des Rechts nur schwer beizukommen. „Post-truth politics“ muss m.E. dort bekämpft werden, wo sie auftritt: in der politischen Öffentlichkeit, nicht primär im Gerichtssaal.
Deliberative Demokratie und „post-truth politics“ sind unvereinbar. Diese Unvereinbarkeit reicht weit tiefer als parteipolitische Unterschiede innerhalb deliberativer Politik. Auch deliberative Demokratie muss dann aber in einem näher zu bestimmenden Sinne „wehrhaft“ gegen alle Formen wahrheitswidrigen Redens sein können. Mag sein, dass einige jetzt in polemischer Absicht sagen, dies liefe auf „Diskurspolizei“ hinaus. Aber inwiefern ist dies als Vorwurf zu verstehen? Die Diskursregeln lassen einerseits eine Fülle von Redehandlungen zu, die sich auch auf Gefühle, Einstellungen, Überzeugungen, Bedürfnisse, Deutungsmuster usw. erstrecken dürfen. Auch von Mehrheitsmeinungen abweichende „dissenting votes“ sind zulässig. Andererseits sind wahrheitswidrige Redehandlungen keine Beiträge zum Diskurs. Es dürfte eine begriffliche Einsicht sein, dass wahrheitswidriges Reden nicht zur Wahrheitsfindung beitragen kann. (Diese Einsicht gilt im Allgemeinen auch dann, wenn sich Beispiele konstruieren lassen, in der P lügt, aber gegen seine Absicht die Wahrheit sagt, weil sich zufälligerweise die Welt geändert hat.)
Wahrheitstheorien
In meinem Buch „Ipso Facto“ (1997) habe ich zu zeigen versucht, dass der Wahrheitsbezug der Wissenschaften ein Wahrheitsethos ist, das auf einer anderen Ebene liegt als der Streit um die „beste“ Wahrheitstheorie: Korrespondenz-, Kohärenz-, Konsens-, Evidenztheorie (hierzu immer noch einschlägig: George Pitcher (Ed.): „Truth“, 1964). Richtigkeit im Bereich der praktischen Vernunft und die ästhetische Stimmigkeit von Kunstwerken sind von Wahrheit im epistemischen Sinne begrifflich zu unterscheiden. Natürlich gibt es „die“ Wahrheit nicht als Substanz (Wahrheit ist kein Substanzbegriff), sondern „wahr“ oder „falsch“ ist eine Eigenschaft von sprachlichen Gebilden, seien es einfache Propositionen, Messergebnisse (Daten), Berichte und Erzählungen, Kausalerklärungen, Theorien etc. Wahrheit ist keine Eigenschaft der Dinge, Ereignisse Sachverhalte, sondern der Aussagen über sie. Ich habe in „Ipso Facto“ auch dafür argumentiert, den Begriff der Wahrheit referentiell zu nicht-sprachlichen Entitäten zu bestimmen und einen Konsens unter idealen Sprechbedingungen nur als ein Wahrheitskriterium zu verstehen. Dieser philosophische Streit um die beste Wahrheitstheorie ist kein Argument für den Skeptizismus, sondern zeigt, wie komplex und facettenreich der Prozess der gemeinsamen Wahrheitsfindung ist. Aus dem Streit der Wahrheitstheorien kann „post-truth politics“ kein Kapital schlagen.
Aber ist die Wissenschaft nicht immer auch ein „organisierter Skeptizismus“ (R. K. Merton)? Ja, aber es gibt aufklärerische und gegenaufklärerische Formen der Skepsis. Hegel unterscheidet zwischen einer abstrakten („leeren“) und einer sich selbst aufhebenden Skepsis. Jene sagt sich von der Wahrheit los, was schon in der Antike in die Aporien einer totalen Skepsis führte; diese bindet sich eng an sie. In einer aufklärerischen Skepsis sind Redehandlungen wie „bezweifeln“, „bestreiten“, „kritisieren“ usw. Momente von diskursiver Verständigung. „Ich bezweifle, dass p“ impliziert dann: „Ich habe Gründe zur Annahme, dass non-p“. Wer sagt „Ich bezweifle grundsätzlich alles und jedes“ verwendet den Sprachakt „bezweifeln“ in diskurstheoretischer Perspektive demnach falsch. Dies macht den Unterschied zwischen sinnvoller Skepsis und einem sich radikal gebärdenden Skeptizismus. Der Skeptizismus verurteilt sich letztlich zum Schweigen, denn sobald er seine eigene Position als „richtig“ behauptet, setzt er Wahrheit voraus und widerspricht sich selbst.
In manchen Bereichen borgen sich „Leugner“ von Tatsächlichkeiten den Gestus der wissenschaftlichen Skepsis bloß aus, wie etwa im Bereich des Klimawandels. Die sog. „Klimaskeptiker“ fordern in diesem pseudo-skeptischen Gestus den „finalen Beweis“ des anthropogenen Klimawandels, während alle Klimaforscher wissen, dass es um die Wahrscheinlichkeit der Null-Hypothese geht, die geringer als 1% ist. Klimaskepsis ist „bullshitism“ im Kostüm wissenschaftlicher Skepsis. (Wenn dem so wäre, dann dürfte es der Regierung Trump sogar leichtfallen, von Klimaskepsis schnurstracks auf die Propaganda von „Solar Radiation Management“ umzuschalten, sobald der rechte Zeitpunkt gekommen ist. Hierzu vom Verfasser: „Political Economy of Solar Radiation Management“, 2018.)
Das Problem der Postmoderne
Was aber ist, wenn eine radikale Wahrheitsskepsis innerhalb einiger Gebiete der Wissenschaften zur intellektuellen Strömung wird? Wie die Skepsis, so sind auch die Wissenschaften Teil der Dialektik der Aufklärung. Das meint nicht nur, dass die Wissenschaften politisch ideologisiert und direkt kontrolliert werden können, wie dies im 20. Jahrhundert viele Wissenschaftler*innen leidvoll erfahren mussten. Arische Physik und Lyssenkoismus sind Beispiele. Die direkte politische Indienstnahme von Wissenschaft ist jedoch nur ein Moment dieser Dialektik. Seit mehr als 30 Jahren kursieren in den Humanwissenschaften wahrheitskritische Positionen. Dies fing meinen (nun doch schon geraume Zeit zurückreichenden) Erinnerungen zufolge damit an, dass bestimmte Begriffe aus Philosophie und Wissenschaftstheorie als intellektuelle Slogans aufgegriffen und zu modischen Redensarten wurden: „Sprachspiel“ (Ludwig Wittgenstein), „Paradigmenwechsel“ (Thomas Kuhn), „Anything goes!“ (Paul Feyerabend), „diskursive Dispositive“ (Michel Foucault), „Konstruktivismus“ (Heinz von Förster), „Dekonstruktion“ (Jaques Derrida). Diese Slogans verdichteten sich zu einem eigentümlichen intellektuellen Habitus, dem schwer beizukommen ist. Es wird in den philosophischen Fakultäten seither ständig von „Diskurs“ geredet, aber viele Diskurse kreisen scheinbar ohne jeden Referenzbezug in sich selbst und ziehen ihre eigenen Kreise. Die Unterscheidung zwischen dem Wahren und dem Falschen ist in diesen Diskurstheorien, wie Foucault meinte, ein „Ausschließungssystem“ bei der Produktion von Diskursen („Die Ordnung des Diskurses“, 1974, S. 10f). Die Berufung auf Wahrheit gilt als „von Machtverhältnissen durchzogen“ bzw. „expertokratisch“. Diskurse sind dann Texturen, an die sich andere Texturen anlagern und sich überschreiben, die allesamt nur Konstrukte aus Zeichen sind, die sich beständig ineinander verschieben. Alle Begriffe und Konzepte oszillieren und fluktuieren unkontrollierbar. Begriffe sind Metaphern, Unterscheidungen sind willkürlich, Theorien sind Narrative usw. An die Stelle einer sorgsamen Arbeit am Begriff tritt die Parataxe von Begriffsworten und ihrer Assoziationen. Jede und jeder bewegt sich in einem Pluriversum zeichenhafter Orientierungsmarken. Alles kann gesagt werden und nichts gilt. Die epistemische Tugend, die einer postmodernen Wahrheitskritik noch bleibt, ist schier grenzenlose Toleranz jedwedem gelehrt klingenden Gequassel gegenüber. Diese fragwürdige Tugend kommt der Sorglosigkeit im Umgang mit Begriffen (Extension/Intension, Denotation/Konnotation) und der Beliebigkeit von Interpretationen zugute.[2] Von dort ist der Weg zur „post-truth politics“ nicht weit.
Die Postmoderne ist, obschon sie Wahrheit als „Fluchtpunkt der wissenschaftlichen Orientierung“ (W. Stegmaier, „Philosophie der Orientierung“, 2008) anerkennen muss, eher unbekümmert um Wahrheit. Im „Fall Sokal“ wurde dies deutlich. Der Physiker Alan Sokal reichte einen Artikel unter dem Titel „Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity“ bei der Zeitschrift „Social Text“ ein, die Artikel aus dem Bereich der „postmodern cultural studies“ publiziert. Der Artikel war blühender Unsinn im postmodernen Jargon und steckte voller absichtlich eingebauter Fehler, die jeder Physiker sofort entdeckt hätte. Der Artikel wurde von „Social Text“ 1996 abgedruckt, woraufhin Sokal seinen „hoax“ öffentlich machte. Diese Affäre weist, wie immer man sie im Einzelnen deuten mag, zumindest auf mangelnde Sorgfaltspflicht bei der Wahrheitssicherung von Aussagen hin. Unbekümmertheit bzw. Sorglosigkeit im Umgang mit Aussagen ist aber laut Frankfurt (s. o.) das Kennzeichen von „bullshitism“. Diese Parallele wäre, wenn sie denn bestünde, höchst bedenklich.
Was aber geschieht, wenn sich eine wahrheitskritische Postmoderne auf dem heiklen Gebiet der politischen Philosophie mit einem Verständnis von Politik als einem Freund-Feind-Verhältnis (sensu Carl Schmitt) verbindet? Ich behaupte, es ergibt sich hieraus ein Musterbeispiel für die Dialektik der Aufklärung. Die Verbindung aus wahrheitsskeptischer Postmoderne und agonalen Politik-Modellen ist eine Form „falscher Aufklärung“ auch dann, wenn diese sich auf der politischen Linken beheimaten (vgl. hierzu Oliver Marchart, „Die politische Differenz“, 2010). Politik ist in diesen Modellen ein Wettkampf um Deutungshoheit und kulturelle Hegemonie. Politische Rede ist letztlich „Agitation“ – und genau diese Auffassung ist extrem anfällig für „post-truth politics“.
In der marxistischen Tradition, der sich viele dieser politischen Philosoph*innen zugehörig fühlen, zählte „Agitprop“ zum Klassenkampf hinzu, der allerdings in einer Konzeption von „wissenschaftlichem Sozialismus“ ökonomietheoretisch und geschichtsphilosophisch abgesichert war. Rhetorisch-ideologische Kompetenz war Teil der Kaderschulung; der Marxismus selbst galt als „wahre Ideologie“ des Proletariats. Da diese Konzeption, vorsichtig formuliert, an Glaubwürdigkeit verloren hat, hat eine linke, postmoderne und agonale politische Philosophie erstens ein Problem mit der impliziten Normativität von deliberativer Demokratie (s. o.) und ein zweites Problem mit „post-truth politics“. Sie setzt diese Normativität implizit voraus, ohne sie explizit anerkennen zu wollen, und sie lehnt „post-truth politics“ ab, ohne über prinzipielle Maßstäbe der Ablehnung zu verfügen. Der „dress code“ dieser politischen Philosophie ist „French radical chic“, wobei mich die Nuancen von Ranciere, Laclau, Badiou, Mouffe und Balibar jetzt nicht interessieren. Die wirklich interessante Frage ist vielmehr, welche normativen Maßstäbe diese Theoretiker*innen gegen „rechte“ „post-truth politics“ nationalistischer und autoritärer Provenienz (und gegen Typen wie Steve Bannon) aufbieten können.
Die Kritik am „Rechtspopulismus“ hängt in agonalen Theorien der Demokratie haltlos in der Luft. Wenn man Populismus über den Begriff der unzulässigen Vereinfachung definiert, so fragt sich, was in agonalen Theorien gegen Vereinfachungen und Zuspitzungen einzuwenden ist. Die postmoderne agonale politische Philosophie sehnt sich nach einer erfolgreichen „linken“ Rhetorik, die die Herzen der breiten Massen gewinnt, während sie die Erfolge populistischer Rhetorik anerkennend würdigen müsste, mit der neo-nationalistische Parteien in ganz Europa Wahlerfolge erzielen. Eine linke agonale Theorie des Politischen wird nicht mit zweierlei Maß messen können, ohne sich selbst ad absurdum zu führen. Oder könnte man die Position vertreten, das „linke“ „post-truth politics“ ganz anders zu bewerten sei als „rechte“? Ich glaube, dass diese Position in Paradoxien und Aporien führt, also philosophisch unhaltbar ist.
Hier stellt sich natürlich zuletzt auch die Frage, ob die Bindung von Politik an Wahrheit nicht ein typisch westlich-rationalistisches Konstrukt sei, dem andere Konstrukte gleichberechtig an die Seite zu stellen wären. Die Kritik an „westlichen Konstrukten“ ist in sog. post-kolonialistischen Diskursen wohlfeil. Allerdings setzen diese Diskurse auch voraus, dass die Behauptungen über die negativen Auswirkungen der Globalisierung, des Welthandels, der Agrarsubventionen, des Klimawandels, der Migrationsgründe usw. auf die Länder des Globalen Südens nicht wahrheitswidrig sind. Dies gilt auch für Kampagnen von NGOs. Das post-koloniale Denken kann auf Wahrheit nicht verzichten. Wenn dies gilt, kann das post-koloniale Denken keine „post-truth politics“-Konzepte in den Gebieten des Globalen Südens anerkennen, da andernfalls die Schilderungen der dortigen Zustände nicht vertrauenswürdig wären.
5. Woran können und sollen wir uns orientieren?
Wichtig ist die Einsicht, dass „post-truth politics“ das „framing“ der politischen Kommunikation grundlegend verändert: Wir streiten unter „post-truth politics“-Bedingungen nicht mehr über Sachfragen, sondern darüber, ob eine Meldung ein „fake“ ist oder nicht, ob man einer Quelle trauen kann oder nicht, ob bestimmte Sätze gefallen sind oder nicht usw. „Post-truth politics“ stiftet Verwirrung. Auf ihrem Boden gedeihen Verschwörungstheorien aller Art. Keiner hält mehr etwas oder jemanden für glaubwürdig, aber jeder weiß, wer oder was dahintersteckt. Man durchschaut alles als Lügengespinst und bleibt ratlos zurück. Die Tendenz zu „post-truth politics“ mündet in einer eigentümlichen Atmosphäre des Schleierhaften.
In der Politik geht es um die Befugnis, gesamtgesellschaftlich bindende Entscheidungen treffen zu können, also um Formen der Ermächtigung. Politische Entscheidungen bedürfen angesichts einer überkomplexen Welt voller Unwägbarkeiten einer gründlichen Vorbereitung etwa auf dem Wege der Ressortabstimmung, der parlamentarischen Aussprache, der Ausschussarbeit, der Abstimmung in einem Geflecht aus „checks and balances“. Die beteiligten Akteure müssen sich in bestimmten Hinsichten aufeinander verlassen können. Dies ist ohne Wahrheitsbindung nicht möglich. Es wäre nun vorstellbar, die professionalisierten Routinen des politischen Betriebs von der polemischen politischen Auseinandersetzung innerhalb der Bürgerschaft zu trennen und „post-truth politics“ für diese zu reservieren. Dies aber bringt ein zynisches „double speak“ in die politische Rede, die nicht durchzuhalten ist.
Tentative Thesen:
- Es gibt keine geschichtsphilosophische Garantie, dass ein deliberativer Modus politischer Urteilsbildung in Demokratien dauerhaft Bestand hat.
- Aufklärung ist ein ewig unvollendetes und immer gefährdetes Projekt.
- „Post-truth politics“ ist ein postmodernes und gegenaufklärerisches Projekt, an das wir uns nicht gewöhnen dürfen. Es verdient keine Toleranz.
- Deliberative Demokratie und „post-truth politics“ sind unvereinbar.
- Auch eine deliberative Demokratie muss den Mut zu einer ihr eigenen Wehrhaftigkeit gegen „post-truth politics“ finden.
- Mit „bullshitting“ und „post-truth politics“ darf man keine politischen Erfolge erzielen. Hier gilt: Wehret den Anfängen!
- Wir brauchen eine zeitgemäße Kritik der Kulturindustrie und der neuen Medien.
- Die Wissenschaft steht nicht in Äquidistanz zu allen politischen Regimen; die Parallelitäten zwischen Logik der Forschung, Wissenschaftsethos und Prinzipien einer offenen Gesellschaft, auf die Karl Popper („Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“) hingewiesen hat, sind nicht von der Hand zu weisen.
- Wissenschaftliche Diskurse und politische Deliberationen sind nicht identisch, aber sie sind umgriffen von der aufklärerischen Praxis des Argumentierens. Der Austausch von Gründen unter Forscher*innen und unter Staatsbürger*innen hat eine gemeinsame Wurzel in der transzendentalen Ausrichtung der Sprache an Verständigung.
- Die Wissenschaften und die Organisationsform der Universität sind ihrer Idee nach Garantiemächte der Aufklärung. Die Orte kritischer wissenschaftlicher Diskurse müssen immer auch die Orte freier politischer Debatten sein.
- Die Professorenschaft sollte ihre Privilegien im Sinne der vorgenannten Punkte nutzen. Sie muss die Tendenzen zu „post-truth politics“ innerhalb und außerhalb der Wissenschaften bekämpfen.
- Die Philosophie hat die Aufgabe, eine Theorie wahrheitswidrigen Sprechens zu entwickeln. Propädeutikum hierfür wäre die kleine Schrift von Arthur Schopenhauer: „Die Kunst, Recht zu behalten“, in der Schopenhauer rhetorische Kunstgriffe analysiert.
Konrad Ott wirkte von 1997 bis 2012 als Professor für Umweltethik an der Universität Greifswald und ist seitdem als Professor für Philosophie und Ethik der Umwelt an der Universität Kiel tätig. Zwischen 2012 und 2018 war er an etlichen Forschungsverbünden der Universität Kiel beteiligt, so etwa an den Exzellenzinitiativen “Future Ocean Sustainability” und “Roots”. Sein aktuelles Forschungsinteresse betrifft eine gesellschaftstheoretische Grundlegung von Umweltethik und Nachhaltigkeit.
Fußnoten
[1] Ich bedanke mich für diese Übersetzung bei Halis Yildirim (München).
[2] Alles soll sich sagen lassen und gleichzeitig sollen im akademischen Milieu aus Gründen einer intuitiv bleibenden „political correctness“ bestimmte „speech codes“ in Kraft gesetzt werden, die politisch inkorrekte Sprechweisen unterbinden. Der Widerspruch fällt nicht mehr auf. „Political correctness“ entwickelt sich derzeit zum subtilen diskursinternen Zwang. Die Regeln von „p.c.“ immunisieren viele postmoderne Produkte aus den „post-colonial studies“ und den „gender studies“ gegen Kritik.