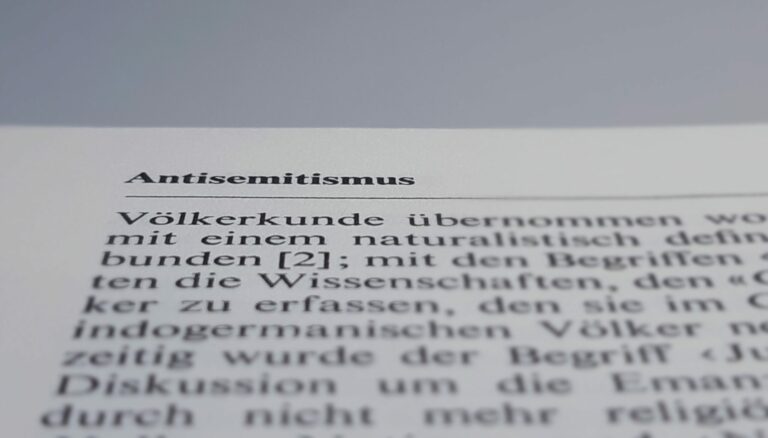Rassismus (auch) ohne Race
von Ina Kerner (Universität Koblenz)
Seit ein paar Jahren setzt sich die deutschsprachige Politische Theorie und Philosophie immer öfter kritisch mit dem Rassismus des eigenen Kanons auseinander. Das ist überfällig – und vollzieht eine Entwicklung kritischer Reflexivität nach, mit denen der englischsprachige Wissenschaftsraum bereits seit Beginn des Millenniums aufwartet (u.a. Mills 1997; Babbitt/Campbell 1999; Boxill 2001; Bernasconi 2001; Bernasconi/Cook 2003; Valls 2005; Eigen/Larrimore 2006). Es kommt nicht von ungefähr, sondern gründet im Material, in den explizit rassentheoretischen Arbeiten ebenso wie in den eher beiläufigen rassistischen Überlegungen, die den Kanon durchziehen, dass das neue Interesse an kritischen Rassismusanalysen deutlich fokussiert ist. Es geht primär um „Rasse“ oder Race – um theoretische Operationen zum Zweck der kategorialen Unterscheidung und Hierarchisierung verschiedener Großgruppen von Menschen, die sich auf die eine oder andere Weise auf körperliche Merkmale wie die Hautfarbe beziehen und diese Merkmale ursächlich mit vermeintlichen je gruppenspezifischen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften assoziieren. Man analysiert den Niederschlag, aber auch explizite Ausarbeitungen derart rassialisierter und rassialisierender Denk- und Wissensformen im politiktheoretischen und philosophischen Kanon und diskutiert die wichtige Frage, was das alles für künftige Bezugnahmen auf die dabei ins Zentrum des analytischen Interesses gerückten Texte und Autor:innen heißt.
Im Folgenden möchte ich argumentieren, dass dieses zweifelsfrei richtungsweisende Projekt komplementiert werden sollte – und zwar durch systematische Reflexionen über die Genese, die unterschiedlichen Aktualisierungen und die Implikationen rassistischer Denk- und Wissensformen, die sich auf herkömmliche Unterscheidungen menschlicher „Rassen“ oder Races gar nicht beziehen. Das theoretische Instrumentarium für eine solche Fokuserweiterung liegt genauso wie die US-amerikanisch geprägte Critical Race Theory seit einigen Jahrzehnten vor; allerdings wurde es vor allem in Frankreich entwickelt. Es handelt sich um Rassismustheorien, die vor allem kulturalistische Formen des Rassismus zu verstehen und zu kritisieren suchen. Damit werden Formen des Rassismus fokussiert, die ohne Klassifikation und Hierarchisierung von „Rassen“ oder Races auskommen und vielmehr auf kategorialen Differenzierungen und Abgrenzungen zwischen kulturell geframten Kollektiven fußen.
Gar nicht so neu: der kulturalistische „Neo-Rassismus“
Zu den zentrale Referenzautoren für dieses theoretische Unterfangen zählt nicht zuletzt Etienne Balibar, der kulturalistischen Rassismus als „Neo-Rassismus“ (Balibar 1990) fasst oder, im Anschluss an Pierre-André Taguieff (2000), als „differenzialistischen“ Rassismus. Beide Autoren unterscheiden idealtypisch zwischen biologischem und kulturellem Rassismus. Biologischen Rassismus assoziieren sie mit rassentheoretisch untermauerten kolonialen Praktiken sowie der NS-Rassenpolitik; kulturellen Rassismus identifizieren sie in den verschiedensten Formen der „Fremden“-Feindlichkeit der Nachkriegszeit. Historisches Modell des kulturellen Rassismus ist der europäische Antisemitismus vor dem Nationalsozialismus.
Von „Neo-Rassismus“ spricht Balibar aufgrund der Beobachtung, im Europa der Nachkriegszeit habe eine grundlegende Erneuerung des Rassismus stattgefunden. Dabei sei ein Rassismus entstanden, dem die eindeutige Verurteilung des genozidalen nationalsozialistischen Staatsrassismus, die seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum gesellschaftspolitischen Konsens liberaler Demokratien gehört, nichts anhaben kann – und der außerdem von der wissenschaftlichen Entlegitimierung des modernen biologischen Rassendenkens nicht angefochten wird. Die zentralen Merkmale des Neo-Rassismus sind erstens, dass er unter Rekurs auf rein kulturelle Differenzpostulate operiert und auf somatische Differenzverweise verzichtet, und zweitens, dass er statt Hierarchien zwischen verschiedenen „Rassen“ oder Races Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen postuliert. Anders als der biologische Kolonialrassismus, der in erster Linie auf die Herstellung von Hierarchien abzielte beziehungsweise Hierarchien legitimierte, ist die Zielrichtung des kulturalistischen, gegen Migration gerichteten „fremden“-feindlichen Neo-Rassismus die Reinhaltung beziehungsweise Entmischung von homogen vorgestellten Kollektiven, meist Nationen. Postuliert wird nicht die Überlegenheit der eigenen „Rasse“ oder des eigenen Volkes, sondern die Unvereinbarkeit verschiedener Lebensweisen und Traditionen, woraus die vermeintlich negativen Auswirkungen jeder Grenzverwischung abgeleitet werden. Argumentiert wird kulturrelativistisch und ethnopluralistisch, allerdings auf grundlegend andere Weise als bei Ethnologen wie Claude Lévi-Strauss, der entgegen der These einer vermeintlichen Unvereinbarkeit der Kulturen die Vorteile kulturübergreifender Interaktionen und Austauschprozesse betont hat (Lévi-Strauss 1994). In den neo-rassistischen Texten und Programmen kommt dieser Aspekt nicht vor; stattdessen wird hier die „Reinhaltung“ der eigenen Kultur als Beitrag zum Erhalt kultureller Vielfalt, als Schutzmaßnahme gegen verlustreiche kulturelle Homogenisierungstendenzen präsentiert.
Naturalisierung durch die Hintertür
Balibar weist nun darauf hin, auf welche Weisen dieser „Rassismus ohne Rassen“, der Differenzen zwischen Kollektiven zunächst ohne Rekurs auf Biologie und Hierarchien, sondern allein unter Hinweis auf Kultur und Verschiedenheit konstruiert, gewissermaßen durch die Hintertür doch auf naturalisierende und hierarchisierende Argumentationsmuster und Logiken zurückgreift – auch wenn diese auf andere Weise eingesetzt werden als im Kontext des „biologischen“ Rassismus. Er identifiziert zwei verschiedene Naturalisierungsmuster im rassistischen Denken; beide laufen auf die Naturalisierung menschlicher Verhaltensweisen hinaus. Das erste dieser beiden Muster besteht darin, dass die Zugehörigkeit zu einer kulturell konstituierten Gruppe kategorisch mit der Ausprägung kulturspezifischer Eigenschaften – man könnte auch sagen: einer kollektiven zweiten Natur – assoziiert wird. Der Effekt sind Stereotypisierungen; etwa die Vorstellung, Deutsche seien grundsätzlich pünktlich und obrigkeitshörig, US-Amerikaner:innen oberflächlich, muslimische Männer sexistisch und muslimische Frauen unterwürfig und traditional. Das zweite Muster geht auf soziobiologisches Gedankengut zurück und ist dadurch charakterisiert, dass der Wille zur Reinhaltung der eigenen Kultur, die Abwehr kultureller Vermischung, ja letztlich rassistisches Verhalten selbst zu natürlichen Regungen erklärt werden. Balibar erläutert:
„Die Aggressivität stellt ein fiktives Wesen dar, dessen Anrufung allen Formen des Neorassismus gemeinsam ist und die es ermöglicht, den Biologismus ein Stück zu verschieben: zweifellos gibt es keine ‚Rassen‘, es gibt nur Bevölkerungen und Kulturen, aber es gibt doch biologische (und biopsychische) Ursachen und Wirkungen der Kultur, sowie biologische Reaktionen auf die kulturelle Differenz (die gleichsam so etwas wie eine unauslöschliche Spur der Animalität des immer noch an seine erweiterte ›Familie‹ und an sein ›Territorium‹ gebundenen Menschen bilden).“ (Balibar 1990: 35)
Aufgrund dieser Argumentationsweise charakterisiert Balibar den kulturalistischen Rassismus als „Meta-Rassismus“ beziehungsweise als „Rassismus zweiter Linie“ (30); es handele sich um einen Rassismus, der sich selbst als Theorie über die Ursachen gesellschaftlicher Aggressivität und damit Konfliktivität darstelle. In diesem Zusammenhang formuliere der Neo-Rassismus auch seine eigenen Strategien der Konfliktprävention: Zur Vermeidung von Rassismus müsse man „abstrakten“, „idealistischen“ Anti-Rassismus vermeiden; geboten sei stattdessen, in Anerkennung psychologischer und soziologischer Gesetzmäßigkeiten menschlicher Bevölkerungen „Toleranzschwellen“ zu beachten und „natürliche Distanzen“ einzuhalten (vgl. 30).
Rassismus und Universalismus
Wie bereits angemerkt, diagnostiziert Balibar am Neo-Rassismus neben naturalisierenden auch hierarchisierende Argumentationsmuster – obwohl der Neo-Rassismus vor allem dadurch charakterisiert ist, dass er die Differenzen zwischen verschiedenen Kulturen beziehungsweise Nationen betont, und nicht dadurch, dass er sie in eine explizite Rangordnung bringt. Die Hierarchisierungen, die Balibar im Neo-Rassismus ausmacht, sind kulturbasiert und teilweise mit den Assimilationsforderungen verknüpft, die dem Ideal einer homogenen Nation entspringen. Er schreibt:
„Kein theoretischer Diskurs über die Gleichwertigkeit aller Kulturen kann einen wirklichen Ausgleich für die Tatsache schaffen, dass von einem ‚Black‘ in Großbritannien oder von einem ‚Beur‘ in Frankreich die Assimilation als Voraussetzung dafür verlangt wird, sich in die Gesellschaft ‚integrieren‘ zu dürfen, in der er doch bereits lebt (wobei zugleich unterschwellig immer der Verdacht gehegt wird, seine Assimilation sei oberflächlich, unvollständig oder bloß vorgetäuscht), und daß dies als ein Fortschritt, ein Emanzipationsakt, als Gewährung eines Rechtes dargestellt wird. Und hinter dieser Tatsache sind dann noch kaum veränderte bzw. erneuerte Varianten des Gedankens wirksam, die historischen Kulturen der Menschheit ließen sich in zwei große Teilmengen einordnen, nämlich in diejenigen, die universalistisch und fortschrittlich und in diejenigen, die unheilbar partikularistisch und primitiv seien.“ (33)
Die Kontrastierung universalistischer und partikularistischer Kulturen, auf die Balibar sich bezieht, war zentraler Bestandteil des Gedankengutes des französischen Kolonialismus. Balibar benennt jedoch auch eine aktuelle Variante dieser Hierarchisierung auf rein kultureller Grundlage: den Vorrang des individualistischen Modells. Zum Ausdruck komme dieser in der Einschätzung, dass Kulturen, die jede Form des Individualismus fördern, überlegen seien; während Kulturen, die durch eine besonders ausgeprägte Affirmation von Kollektivität den Individualismus begrenzen, als unterlegen betrachtet werden.
Wie diese Ausführungen zeigen, sind Universalismus und Rassismus für Balibar keine prinzipiellen, sondern vielmehr determinierte Gegensätze (Balibar 1998: 182). Darunter versteht er, dass der Universalismus rassistische Tendenzen berge und dass Praktiken, die sich auf ihn berufen, oftmals rassistische Wirkungen entfalteten; ferner, dass auch der Rassismus nicht ganz frei von universalisierenden Effekten sei. Hinsichtlich des erstgenannten Zusammenhangs unterscheidet Balibar zwei Varianten. Als „schwache These“ bezeichnet er die Überlegung, der Universalismus sei „als Maske und Instrument rassistischer Politik zur Legitimierung der rassistischen Ideologien benutzt worden“ (179). Beispielhaft hierfür seien der französische Kolonialrassismus und seine Fortführungen, genauer gesagt Praktiken, die von den Bevölkerungen der (ehemaligen) Kolonien unter dem Deckmantel des Fortschritts Assimilation und Verwestlichung verlangen; wobei dieses Ansinnen als Gebot von Vernunft und Zivilisation und als „Bürde des weißen Mannes“ rationalisiert werde. Die „stärkere These“ über das Verhältnis von Rassismus und Universalismus ist grundsätzlicher. Sie läuft darauf hinaus, dass die Koinzidenz der Entstehung der modernen universalistischen Anthropologie und der modernen Rassentheorie nicht bloß eine zeitliche gewesen ist; sondern dass vielmehr ein innerer Zusammenhang bestehe „zwischen den Begriffen von Menschheit, menschlicher Gattung, kulturellem Fortschritt der Menschen und den anthropologischen ‚Vorurteilen‘ zu den Rassen oder den natürlichen Grundlagen des Sklaventums“ (179). Unter Bezugnahme auf Kant und Aristoteles vertritt Balibar die These, dass „der Universalismus, sobald er aufhört, ein simples Wort […] zu sein, um ein System expliziter Konzepte zu werden, sein Gegenteil nicht einmal in seinem Kern ausschließen“ (180) könne. Selbst den größten Philosophen sei es nicht gelungen, nichthierarchische Konzepte der Vernunft zu entwerfen; und man habe „nie versuchen können, das Menschliche zu ‚definieren‘, ohne in die Definition den endlosen Prozeß der Unterscheidung zwischen dem Menschlichen, dem Übermenschlichen und dem Inframenschlichen […] wie auch die Reflexion über diese Eingrenzungen innerhalb der Grenzen der menschlichen ›Gattung‹ selbst einzuschließen“ (181).
Während also der Universalismus zum Rassismus tendiere, sobald er konkret wird, neigt Balibar zufolge der eigentlich partikularistische Rassismus dazu – und dies ist der zweite Aspekt des komplizierten Zusammenhangs zwischen Universalismus und Rassismus –, universalistische Formen auszubilden. Balibar erklärt, auch den Sexismus in seine Argumentation einbeziehend:
„Paradoxerweise sind Rassismus und Sexismus für sich genommen Partikularismen, da sie die menschliche Gattung spalten und diese Spaltungen wiederum die Hierarchien naturalisieren. Miteinander verbunden aber und sich gegenseitig beeinflussend, erarbeiten der Rassismus und der Sexismus Typen einer idealen Menschheit, die definitionsgemäß universell sind (ob es sich um moralische oder ästhetische Ideale handelt: die ‚männliche‘ und ‚zivilisierte‘ Beherrschung der Leidenschaften, das Verlangen eines der Schönheit obliegenden Lebens).“ (185)
Diese Überlegungen verleiten Balibar nun allerdings nicht zu einem generellen Abrücken von universalistischem Gedankengut. Eher verweist er darauf, dass man es sich zu leicht macht, wenn man glaubt, durch die bloße Bezugnahme auf Universalismus bereits ein geeignetes Mittel gegen Rassismus in der Hand zu haben. Ein nichtrassistischer Universalismus müsse erst erzeugt werden, er müsse errungen werden; und angesichts der verschiedenen Diagnosen hinsichtlich gesellschaftlicher Entwicklungen, die Balibar formuliert, wäre zu vermuten, dass diese Arbeit am Universalismus keine ist, die auf absehbare Zeit als abgeschlossen betrachtet werden kann. Er postuliert:
„Es ist lächerlich zu meinen, den Rassismus im Namen des allgemeinen Universalismus bekämpfen zu können; der Rassismus ist in ihm schon enthalten. Der Kampf also findet in seinem Innern statt, um gerade das zu verändern, was wir unter Universalismus selbst verstehen. Aber das bedeutet nicht – was wohl kaum noch betont werden muß –, jeglichen Universalismus aufzugeben, denn das hieße, kampflos die Waffen zu strecken.“ (187)
Die Flexibilität des Rassismus und die Aufgaben der Rassismuskritik
Rassismus ist nicht statisch. Er hat sich historisch mehrfach gewandelt und tritt auch innerhalb klar umrissener raumzeitlicher Kontexte in unterschiedlichen Formen in Erscheinung. Für die Rassismustheorie bedeutet das, dass sie nicht auf einfache Modelle zurückgreifen kann, wenn sie überzeugen möchte. Vor allem dann, wenn sie in kritischer Absicht an einem Verständnis der Funktionsmechanismen der verschiedenen Formen von Rassismus interessiert ist, muss sie vielmehr weite Definitionen zugrunde legen, Unterscheidungen unterschiedlicher Varianten treffen und sich um komplexe Erklärungen bemühen.
Für die Rechtfertigung rassistischer Ordnungsmuster, genauer gesagt für die Begründung der „Natürlichkeit“ homogener beziehungsweise „rassisch“ stratifizierter Gesellschaften können biologische und kulturelle Differenzpostulate vergleichbare Funktionen erfüllen – und sind damit in gewissem Sinne austauschbar. Wie wir aus der Geschichte der Rassentheorien wissen, treten biologische und kulturelle Differenzpostulate zudem oft im Zusammenhang auf, sind zumindest biologische Differenzpostulate in der Regel auch kulturell, insofern nämlich, als sie einen Zusammenhang zwischen körperlichen und charakterlichen Merkmalen unterschiedlicher „Rassen“ oder Races unterstellen. Kulturelle Differenzpostulate wiederum werden oft naturalisiert, dann etwa, wenn spezifische kulturelle Merkmale kategorisch allen Personen zugeschrieben werden, die zu einer kulturell definierten Gruppe wie einer Nation gezählt werden, und wenn diese Personen zudem ausschließlich durch diese spezifischen Merkmale definiert werden. Kultur wird dann statisch. Wie sich aus den Ausführungen Balibars ergab, kann zudem interkulturelle Konfliktivität naturalisiert werden. Was allerdings bedeuten diese Momente der Austauschbarkeit und der konstitutiven Kopplung biologischer und kultureller Differenzpostulate für kritische Analysen des Rassismus?
Folgt man Balibars Beschreibung der Erneuerung des europäischen Rassismus in der Nachkriegszeit, die ja darauf hinausläuft, dass sich rassistische Argumentationsweisen auf eine Weise verändert haben, die dazu angetan war, den erneuerten, den „Neo-Rassismus“ gegen die auf biologische beziehungsweise stratifizierende Varianten des Rassismus konzentrierte antirassistische Kritik zu immunisieren, so erhärtet sich die These, dass rassistisches Wissen flexibel auf diskursiven Wandel reagieren kann. Für eine gesellschaftstheoretisch ausgerichtete Rassismusforschung bedeutet dies, dass sie ihr Blickfeld beziehungsweise ihren Gegenstand nicht von vornherein dadurch einschränken sollte, dass sie eine historisch spezifische Variante des Rassismus zum Prototyp erklärt, beispielsweise jene Variante, die mit der Unterscheidung biologischer „Rassen“ oder Races operiert. Vielmehr sollte sie in dieser Hinsicht offen sein und zum Beispiel neben biologisch begründeten auch kulturell fundierte Postulate kategorialer Differenzen menschlicher Kollektive berücksichtigen. Wenn rassistisches Wissen als flexibel angesehen wird, liegt es zudem nahe, empirisch mit weiteren Erneuerungen zu rechnen. In der aktuellen Lage wäre beispielsweise zu untersuchen, inwiefern religiöse Differenzierungen an Bedeutung gewinnen – und sich beispielsweise in den vergangenen Jahrzehnten Ressentiments gegen „Ausländer“, insbesondere gegen Migrant:innen aus der Türkei, in Ressentiments gegen Muslime verwandelt haben. Zudem wäre zu überlegen, ob und inwiefern sich Aktualisierungen biologischer Rassendifferenzierungen im Zusammenhang der Genetik – zu denken wäre hier an sogenannte „Ethno-Pillen“ und andere Formen einer rassenspezifischen Medizin, an Techniken des Racial Profiling in der Forensik oder auch an die genetisch gestützte Ahnenforschung – auf rassistisches Wissen auswirken (vgl. hierzu bereits AG gegen Rassismus in den Lebenswissenschaften 2009). Nur unter Rückgriff auf einen theoretischen Rahmen, der inhaltlich offen konturiert ist und zudem Metamorphosen seines Gegenstandes einkalkuliert, ist gewährleistet, dass derartige Phänomene dem rassismusanalytischen Blick nicht verborgen bleiben, dass Rassismusanalysen die Erneuerungen rassistischen Wissens fassen und nachvollziehen können. Dies scheint angesichts der Virulenz des Rassismus auch für die Politische Theorie und Philosophie geboten. Nicht anstelle von ideengeschichtlichen Kanonrevisionen, sondern zusätzlich zu diesen.
Zitierte Literatur
AG gegen Rassismus in den Lebenswissenschaften (Hg.) (2009), Gemachte Differenz. Kontinuitäten biologischer „Rasse“-Konzepte, Münster.
Babbitt, Susan E./Campbell, Sue (Hg.) (1999), Racism and Philosophy, Ithaca – London.
Balibar, Etienne (1990), Gibt es einen „Neo-Rassismus“?, in: Balibar, Etienne/Wallerstein, Immanuel (Hg.): Rasse, Klasse, Nation. Ambivalente Identitäten, Hamburg – Berlin, S. 23-38.
Balibar, Etienne (1998), Der Rassismus: Auch noch ein Universalismus, in: Bielefeld, Ulrich (Hg.): Das Eigene und das Fremde. Neuer Rassismus in der Alten Welt?, Hamburg, S. 175-188.
Bernasconi, Robert (Hg.) (2001), Race, Malden – Oxford
Bernasconi, Robert/Cook, Sybol (Hg.) (2003), Race and Racism in Continental Philosophy, Bloomington – Indianapolis.
Boxill, Bernard (Hg.) (2001), Race and Racism, Oxford.
Eigen, Sara/Larrimore, Mark (Hg.) (2006), The German Invention of Race, Albany.
Lévi-Strauss, Claude (1994), Eine andere Geschichte. Claude Lévi-Strauss‘ Beitrag zur Rassismusdiskussion, in: Claussen, Detlev (Hg.): Was heisst Rassismus?, Darmstadt, S. 141-181.
Mills, Charles W. (1997), The Racial Contract, Ithaca.
Taguieff, Pierre-André (2000), Die Macht des Vorurteils. Der Rassismus und sein Double, Hamburg.
Valls, Andrew (Hg.) (2005), Race and Racism in Modern Philosophy, Ithaca – London.
Ina Kerner ist Professorin für Politische Wissenschaft im Institut für Kulturwissenschaft der Universität Koblenz (https://uni-ko.de/kernerpolwiss). Sie lehrt und forscht im Bereich der Politischen Theorie, der Postkolonialen Studien und der Gender Studies. 2009 erschien im Campus Verlag ihr Buch Differenzen und Macht. Zur Anatomie von Rassismus und Sexismus, auf das dieser Blogbeitrag stark zurückgreift.