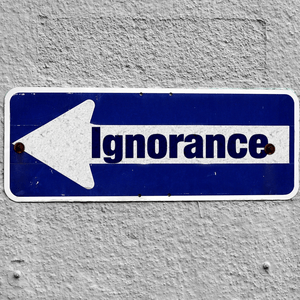
Ausbruch aus der Freiheit: zur sokratischen Unbeständigkeit
„Ich weiß, dass ich nicht weiß“ als ethische und erkenntnistheoretische Rasierklinge für eine befremdliche Gesellschaft der Gegenwart
Von Christoph Eydt
Freiheit gilt als eines der höchsten Güter und liefert sogleich die Grundlage für allerlei Konstruktionen in Bezug auf das Verhalten und Erleben von Menschen. Dass dem eine anhaltende Fremdbestimmung zugrunde gelegt ist und der Mensch kaum in der Lage zu sein scheint, seine Fesseln zu erkennen, kann mit Sokrates annäherungsweise beschrieben werden. Das Verlassen eines Standpunktes impliziert die Einnahme eines neuen, doch was ist damit gewonnen? – Ich weiß, dass ich nicht[s] weiß?
Während es allgemein anerkannt ist, dass der berühmte Ausspruch des Sokrates lautet: „Ich weiß, dass ich nicht weiß“, ist es hilfreich, ihn wenigstens temporär in das geflügelte Wort „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ zu transformieren. Das „nichts“ ist in diesem Falle ein Pronomen. Es wird verwendet, um die Abwesenheit von etwas auszudrücken. Im Satz „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ fungiert „nichts“ als direktes Objekt und steht im Akkusativ.
„Nichts“ ist also das direkte Objekt des Verbs „weiß“ bzw. „wissen“. Es drückt die Abwesenheit von Wissen aus. Im dualistisch geprägten Kausalitätsdenken vornehmlich sogenannter zivilisierter Kulturen impliziert dieser Satz das Wissen, denn die Abwesenheit desselben setzt zumindest seine Existenz voraus. Doch was weiß der Mensch schon über Wissen? Wahrnehmungsgestützte Erfahrungs- bzw. Erinnerungsgegenstände verlieren allein dadurch ihre Bedeutung, dass sie subjektiver Natur und höchst fehleraffin sind. Für menschliche Handlungskonsequenzen ist dies von weitreichender Bedeutung, neigt der Mensch ja gerade dazu, aus vermeintlichem Wissen Handlungen oder Handlungspotentiale oder Handlungstendenzen abzuleiten.
Auf der Suche nach Wissen: Von der unzureichenden Wahrnehmung
Seit jeher, so könnte man annehmen, strebt der Mensch nach Wissen oder bündelt es aufgrund seiner ihm zugemuteten Erfahrungen. Die Erfahrbarkeit der Welt ist die Conditio-sine-qua-non, welche die Basis konventioneller Wissensvorstellungen liefert. Gleichzeitig impliziert die Idee über die Erfahrbarkeit der Welt einen unüberwindbaren Dualismus, eine Trennung und damit die Zementierung des Nicht-Wissens im Gewand des Wissens als kollektivorientierte Vereinbarungen und Übereinstimmungen. Über das Wesen des Wissens ist damit freilich nichts gesagt oder gewonnen.
Geht man davon aus, dass der Mensch die Welt wahrnimmt durch seine Sinne und gleichzeitig auch fähig ist, Deutungsmuster und Handlungskategorien zu entwickeln, dann kann der Mensch als Beobachter interpretiert werden. Die Beobachtung als eine „ur-wissenschaftliche“ Methode sagt aus, dass es eine Trennung gibt zwischen eben dem Beobachter und dem zu beobachteten Gegenstand. Wie kann also ein Beobachter über einen Gegenstand eine Aussage treffen, wenn er mit diesem Gegenstand ob der zwischen beiden Polen liegenden Distanz keinerlei Bezug zu ihm hat? Man gewinnt allenfalls hinfällige Erkenntnisse über die eigenen Beobachtungs- und Wahrnehmungsmechanismen. Der Gegenstand bleibt davon völlig unberührt, was auch am Wortkern deutlich werden kann: Der Gegenstand ist etwas oder jemand, man weiß es eben nicht, was bzw. der einem gegenübersteht. Ein Kontakt ist von vornherein ausgeschlossen, denn was man verbindet, kann nur getrennt bleiben, sonst bräuchte es ja keine Verbindung.
Für das vermeintliche Wissen ist das von größter Relevanz, denn hier kann sichtbar gemacht werden, dass wir nichts wissen (können) und uns allenfalls mit Pseudo-Wissen oder Glauben zufriedengeben, mag man noch so faktengestützt denken wie nur irgendwie möglich. Ist die Vorstellung von Fakten denn nicht auch wieder nur ein Glaube? Und dann gilt nicht etwa zu fragen, was man glaube, sondern wem.
Wenn wir über Wissen sprechen, können wir es vorläufig wie folgt definieren:
Wissen bezeichnet das gesammelte und erlernte Verständnis, Informationen, Fakten und Konzepte über die Welt, Sachverhalte, Ereignisse oder Zusammenhänge. Es umfasst sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen, das durch Erfahrung, Studium, Beobachtung oder Kommunikation erworben wurde. Wissen ermöglicht es einer Person, über bestimmte Themen informiert zu sein, Probleme zu lösen, Entscheidungen zu treffen und ihre Umwelt besser zu verstehen. Es ist eine grundlegende Komponente des menschlichen Denkens und Handelns.
Wenn ich auf mein (vermeintliches) Wissen zugreife, wie kann ich dann damit etwas gemein haben? Um nach etwas zu greifen, muss es zwangsläufig fremd von mir sein. Ich bin ja auch nicht mein Autoschlüssel, ich muss Distanz überwinden, um ihn zu greifen und zu nutzen. Das Nutzen / Benutzen / Zugriffspotential bedingt stets die Distanz zwischen mir dem „Greifer“ und dem „Zu-begreifenden“, oder eben zwischen dem Beobachter und dem zu Beobachtenden, was freilich auch innerhalb der Körpergrenzen eines Individuums anzutreffen ist und nicht selten als Selbstreflexion enttarnt werden kann.
Gleichzeitig bleibt der Mensch wahrnehmungsgestützt in seiner Rolle des Beobachters. Hat schon mal jemand tatsächlich aktiv auf Wissen zugreifen können?
Für die Frage nach der Freiheit ist dies relevant, weil auf dem unterstellten oder angenommenen (Dies ist doppeldeutig zu verstehen.) Wissen schließlich Freiheitskonzepte, Emanzipationen und Verwirklichungsbestrebungen fußen. Doch was, wenn die Grundlage schon falsch ist? Wie weit ist es dann mit der allseits favorisierten Freiheit bestimmt? Und wenn etwas bestimmt ist, wie könnte es je frei sein?
Quod erat demonstrandum – oder: Was weiß ich nicht?
Der Mensch sucht sich seine Gedanken offenkundig nicht aus. Wie kann er dann seine Handlungen aussuchen? Was ist mit Emotionen und Gefühlen? Gedanken kommen und gehen und sind maßgeblich, wenn nicht sogar in Gänze, umweltindiziert. Dies kann experimentell aufgezeigt werden. Nimmt man einem Menschen seine Umwelt (Reizarmut), werden seine Gedanken zunehmend aufgelöst. Vermeintlich sichere, ja unantastbare Konstrukte lösen sich auf und können nicht reproduziert werden. Nicht umsonst gibt es hierzu etwaige Foltermethoden im Repertoire menschlicher Zivilisationsbemühungen.
Freiheit benötigt Wissen. Daher muss kritisch gefragt werden, wieso wir als Gesellschaft, Gruppe oder Individuum der Neigung nachgehen, vermeintliches Wissen hinzunehmen, statt es sofort nach dem Befestigungsbestreben aufzulösen, um auf der Suche zu bleiben. Warum nur wollen wir sogenanntes Wissen aufbauen, welches bei genauer Betrachtung sofort wieder nur als Vorstellung oder Glaube zurückgewiesen werden müsste? – Vielleicht weil uns die Orientierung fehlen würde? Alles würde vermutlich sinnbefreit (!) wirken. Wir stützen uns auf Wissen, um gestalten zu können. Die Freiheit nimmt eine doppelte Funktion ein: Sie ist die Grundlage für die Gestaltung von Welt und sie gilt als Ziel. Ist es nicht seltsam, dass der Mensch seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden immer noch darum bemüht ist, sich zu emanzipieren, sich freier zu machen, wobei gleichzeitig die unsichtbaren Ketten des vermeintlichen Wissens immer fester gezurrt werden?
Ein Mensch wie Sokrates, der diesen Aspekten nachgegangen sein könnte, ist nur leicht zum Tode zu verurteilen, wäre jede Ordnung hinfällig, ist sie ja nur die Folge von Behauptungen, welche als Wissen stilisiert und konditioniert werden. Ein Störenfried könnte hier ein sonderbarer Helfer sein, denn Götter, ganz gleich, in welchem Gewande sie daherkommen oder sie von Menschen positioniert werden, sind bestrebt ihre Ordnung zu erhalten. Freiheit bleibt deshalb stets ein Ideal. Der Mensch atmet nicht freiwillig. Sie ist ein Konzept und kann sofort auf den Prüfstein des Pseudo-Wissens gelegt werden; nicht etwa, um zu demonstrieren, wie fahrlässig der Mensch mit Erfahrungen agiert, sondern um aufzuzeigen, dass es jene Konzepte, jene Vorstellungen, die Ideen sind, die uns abhalten, die uns fernhalten oder kleinhalten. Die Unterscheidung zwischen „Erde“ und „Welt“ ist nicht zufällig, endet die Welt genau dort, wo das Weltbild sein Ende hat. Mit der Erde hat dies nichts gemein.
In postmodernen Gesellschaften nehmen Individualismus und Individualisierung als tragende Säulen der Lebensgestaltung zu. Der Mensch will sich selbst verwirklichen oder authentisch leben. Hierfür kann er auf eine Fülle an Angeboten (Wer oder was stellt sie ihm zur Verfügung?) zurückgreifen und sich im Angesicht des Freiheitsgefühls als einmalig und besonders erfahren. Wenn nun jeder besonders ist, braucht es die begriffliche Abgrenzung überhaupt nicht. Hier scheint wieder das Bemühen um Sedierung zur Geltung zukommen, dass das Individuum nutzt, um sich der unangenehmen Möglichkeit zu entziehen, dass alles, was als Wissen vorrätig ist, nichts anderes ist als der Versuch, sich gegen die Wogen des Lebens, gegen die Unwägbarkeiten, abzusichern. Die Freiheit kann im Sinne des Sokrates von ihrem Thron, bei manchen auch vom Altar, gestoßen werden durch Fragen, welchen man nicht durch Antworten ausweicht, Fragen wie:
- Was suche ich mir wirklich selbstständig aus?
- Was heißt „selbst“? Wie setzt es sich zusammen? Was hat es mit mir zu tun?
- Ist die Identität oder Persönlichkeit nicht nur wieder ein weiteres (Pseudo-)Wissens-Konstrukt?
- Wie hängen Wille und Wunsch zusammen?
- Warum willst du (nicht), was du dir wünscht?
- Welchen Einflüssen unterliegen Wunschbildungen?
- Tue ich wirklich, was ich will, gerade jetzt?
- Wie will ich etwas über die Welt wissen, wenn ich noch nicht einmal weiß, was in meinem kleinen Zeh vor sich geht?
- Von was bin ich abhängig?
Ganz im Sinne des Sokrates können wir über Freiheit keine Aussage treffen, allenfalls in der Negativfolie zeitgeistgestützt sagen, was sie nicht sein kann. Somit bleibt der Ausschluss mittels der Logik, welche ihrerseits durch (zeit-)kritische Fragestellungen aktiviert werden kann. Die Freiheit steht exemplarisch für den menschlichen Zwang – welch Paradox! Das Bemühen um Freiheit impliziert die Unfreiheit. Jedes Streben, das ist seinem Wesen ja immanent, sagt im Grunde aus, dass jener strebende Mensch nicht frei ist, denn sonst müsste er nicht streben. Dies gilt ungeachtet des Kausalitätsparadigmas von unterstellten Ursachen und Wirkungen, da bei genauer Beobachtung offenkundig ist, dass erst (irgendwelche) Wirkungen eintreten und der Mensch in Folge Ursachen im Sinne narrativer Zusammenhänge annimmt oder unterstellt. Frei ist dies nicht, sich auf die Einschränkung von Ursache-Wirkung zu konzentrieren, nur um so Bestrebungen begründbar zu machen.
Christoph Eydt ist Schriftsteller. Kürzlich erschien sein neues Buch „Sokratesk. Wider die Besserwisserei“ bei dem Berliner Verlag Periplaneta. Er studierte Theologie und Geschichte in Halle und promoviert an der Universität Magdeburg in den Bereichen Hexenforschung und Regionalgeschichte. Sein schriftstellerisches Schaffen widmet sich zahlreichen philosophischen Diskursen von ostasiatischen Ansätzen hin zur westlich geprägten Existenzphilosophie. Mit „Sokratesk“ will er dazu anregen, dem ständigen Entkommensgesuch des Menschen durch vermeintliches Wissen entgegenzutreten, denn dort, wo nichts ist: Wie kann da der Mensch sein?




