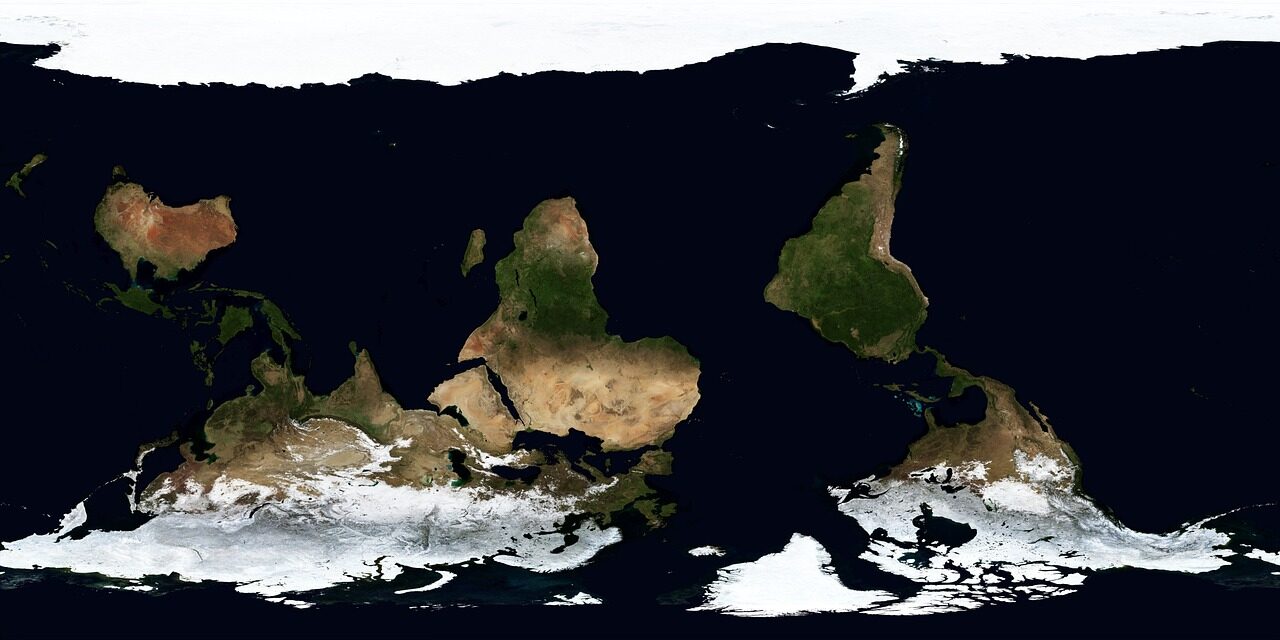
Der Universalismus der Aufklärung trotz postkolonialer Abgesänge
von Arnd Pollmann (Berlin)
Nur wenige Tage nach den grauenvollen Gewaltverbrechen der Hamas formuliert Philipp Sarasin auf dem Blog Geschichte der Gegenwart eine dezidiert postkoloniale Kritik an Omri Boehms (2022) Plädoyer für einen „radikalen Universalismus“.[*] Das Timing dieser Auseinandersetzung wirkt zunächst ungünstig: Auf Seiten vieler politisch „links“ stehender Menschen herrscht seit den schockierenden Massakern vom 7. Oktober nicht bloß unschlüssiges oder betretenes Schweigen. Spätestens seit der letzten Documenta drängt sich der ungute und in diesen Tage dann auch heftig diskutierte Verdacht auf, nicht wenige Befürworter:innen postkolonialer Herrschaftskritik könnten ein allzu sympathetisches Verhältnis zu israelkritischen oder sogar direkt antisemitischen Organisationen hegen. Und bisweilen ist gar so etwas wie ein postkoloniales Liebäugeln mit dem palästinensischen Terror zu vernehmen. Zugleich richtet sich Sarasins Kritik gegen einen israelisch-deutschen Kantianer, der selbst nicht recht in die üblichen Schubladen passt. Als „Universalist“ ist Boehm nicht nur ein erklärter Gegner postkolonialer Relativierungen. Eben dieser Universalismus führt ihn auch zu einer vehementen Kritik der israelischen Besatzung; was ihn in der Öffentlichkeit beinahe allseitig zur Zielscheibe macht.
Die Würde aller Menschen
In Boehms zuvor erschienen Buch Israel – eine Utopie (2020) hat dieser sich sowohl gegen die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung als auch gegen die Idee eines jüdischen Einheitsstaates gewendet und stattdessen für die Utopie einer „Republik Haifa“ argumentiert; für eine föderale, binationale Demokratie, die insofern auf der Idee „universeller Menschenwürde“ fußen würde, als dort die prinzipielle Gleichberechtigung aller Menschen – in diesem Fall: Juden wir Araber – garantiert wäre. Ein solcher Staat käme laut Boehm allerdings erst dann in Sicht, wenn die jüdische Besatzung als Besatzung ein Ende hätte: „Wo der Begriff des Rechts von der Würde und Gleichheit aller Menschen abgeschnitten wurde, ist sein Anspruch auf Autorität von innen heraus zersetzt“.
Das strikt egalitäre Rechtsmotiv der Würde, das im deutschen Verfassungskontext gesetzt ist, im israelischen jedoch „utopisch“ wirkt, erweist sich angesichts der Katastrophe dieser Tage auch in die politische Gegenrichtung als wegweisend. Denn im Rückgriff auf dieses radikale Gleichheitsprinzip kann zugleich gelingen, was vielen postkolonialen Kritiker:innen dieser Tage gerade nicht gelingen will: eine klare Grenze zu ziehen zwischen berechtigten palästinensischen Gleichheitsansprüchen und verwerflichen palästinensischen Terrorangriffen. Ohne damit eine Gleichsetzung im engeren Sinn vorzunehmen: Im Lichte einer „zukünftigen“ Verfassung universeller Menschenwürde verhalten sich die jüngsten Gräueltaten der Hamas spiegelbildlich identitär zur israelischen Siedlungspolitik. Auch die Hamas zielt gerade nicht auf Gleichheit, sondern auf radikale Ungleichheit – und in diesem Fall sogar auf die Vernichtung des Feindes. Oder anders: Es kann sich nicht schon jede Rebellion der Freiheit auf eine „höhere“ Gerechtigkeit berufen, sondern immer nur jene, die sich von vornherein als eine Bewegung „gleicher Freiheit“ versteht.
Der unsichere Grund der Gleichheit
Um den Nahostkonflikt soll es an dieser Stelle aber nur am Rande gehen. Auch von Sarasin, der beim Abfassen seiner Kritik von der jüngsten Entwicklung noch nichts wissen konnte, wird dieser Konflikt lediglich gestreift. In einer süffisanten Bemerkung wird Boehm zunächst in einem Atemzug mit Susan Neimans neuem Buch „Links≠woke“ (Neiman 2023) genannt und beiden „zugute“ gehalten, dass deren Israelkritik „immerhin“ von der „Sorge um gleiche Rechte in Israel/Palästina“ motiviert sei. Mit dieser Bemerkung tritt zugleich zutage, was den Kritiker an beiden Autor:innen vor allem zu stören scheint: deren Verteidigung eines aufgeklärten Universalismus gegen den postkolonialen oder „woken“ Zeitgeist und die damit verknüpfte Behauptung, dass dieser Zeitgeist anti-aufklärerisch sei, weil er die Idee universeller Gleichheit „identitätspolitisch“ opfere. Dies hält Sarasin für „nachweislich falsch“, ohne freilich entsprechende Nachweise anzuführen. Stattdessen tritt er eine postkolonialistisch motivierte Flucht nach vorn an, die im redaktionellen Teaser mit der Frage eingeleitet wird: „Ist der Universalismus der Aufklärung angesichts postkolonialer Kritik noch zu retten?“
Es ist genau diese Frage, die angesichts der aktuellen Entwicklung so unpassend wie brisant klingt. Denn man will unweigerlich zurückfragen: Spricht der Massenmord vom 7. Oktober samt seiner unabsehbaren Folgen eher gegen oder nicht doch für das Festhalten am Universalismus der Aufklärung? Sollte man die betreffende Leitfrage nicht vielmehr umkehren: „Ist die postkoloniale Kritik am Universalismus noch zu retten?“? Diese (doppelte) Problemstellung spielt selbstredend nicht nur im Nahostkonflikt, sondern derzeit auch in vielen anderen Krisen und Kriegen eine wichtige Rolle. Und der zentrale Dissens zwischen Boehm und Sarasin betrifft die Frage, ob die Behauptung einer universellen Gleichheit aller Menschen, die zugleich auch den Kern der Menschenwürdeidee ausmacht, einer „metaphysischen“ oder philosophisch „absoluten“ Begründung zugeführt werden kann.
Für Boehm scheint gerade darin die „Radikalität“ des besagten Universalismus zu liegen: Um politisch und rechtlich festen Halt geben zu können, muss sich die Idee egalitärer Menschenwürde dem relativierenden Zugriff des Menschen entziehen. Demgegenüber spricht Sarasin – geradezu in konstruktivistischer Manier – von einer bloßen „Erfindung“, für die man zwar politisch streiten, die man aber nicht philosophisch „letztbegründen“ könne. In dieser Gegenüberstellung zeigt sich, was mit dem umstrittenen Universalismus seit jeher und in aktuellen Krisen erneut auf dem Spiel steht: „Glaubt“ man, wie Boehm, an eine absolute Begründbarkeit der Menschenwürde, basiert deren Geltung auf metaphysischen Annahmen oder religiösen Glaubenssätzen, die gerade nicht schon universell Zustimmung finden werden. Relativiert man deren Begründbarkeit, so wie Sarasin, indem man aus der Würde eine soziale oder historische „Konstruktion“ macht, wird der globale Kampf für ein menschenwürdiges Dasein normativ haltlos und beliebig. Jede Politik der Menschenwürde wäre so unvermeidlich kontingenten Machtumständen ausgeliefert, in denen die Realisierung dieser Idee entweder eingefordert oder aber regierungsamtlich und mitunter auch terroristisch bekämpft wird. Lässt sich hier vermitteln?
Postkoloniale Differenzen
Machen wir uns das Universalismus-Problem zunächst am Beispiel der Menschenrechte klar. Während relativistische Anfeindungen noch in den 1990er-Jahren wesentlich aus politisch-autoritären Kreisen und unter Berufung auf vermeintlich afrikanische, islamische oder asiatische „Werte“ kamen, schallen sie einem heute vornehmlich aus so unterschiedlichen Theorieprojekten wie der Critical Race Theory, den Gender Studies, den Diversity Studies, den Black Studies oder eben aus postkolonialen Theoriekontexten entgegen. Auf die Gefahr grober Vereinfachung und unzulässiger Vereinheitlichung verschiedenster Ansätze hin: Diese postkoloniale Kritik an den Menschenrechten tritt heute in zwei grundverschiedenen Varianten auf, von denen die eine begrüßenswert und notwendig, die andere aber problematisch ist.
Anhänger der ersten Variante weisen zurecht darauf hin, dass in den bis heute gängigen „Narrativen“ moderner Menschenrechtsentwicklung meist ein historisch unkritisches, weil anmaßendes Selbstbild westlicher Apologet:innen zum Ausdruck kommt, das über blinde Flecken und eigene Verstrickungen des Westens in vielfältige Gewaltkontexte hinwegtäuscht. Dabei werde zudem der Umstand ignoriert oder gar gezielt verschwiegen, dass es stets auch wichtige nicht-westliche Einflüsse auf das heutige Menschenrechtsdenken gegeben habe; man denke hier zum Beispiel an die „vergessene“ Revolution in Haiti von 1791, an die Befreiungskämpfe Südamerikas zwischen 1809 und 1825, an die Dekolonialisierung Afrikas im 20. Jahrhundert oder auch daran, dass die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ aus dem Jahr 1948 von Menschen vielfältiger religiöser, kultureller und weltanschaulicher Überzeugungen ausgearbeitet worden ist. Wer dies ignoriere, verfahre bereits auf ideengeschichtlicher Ebene „eurozentristisch“ (dazu exemplarisch Mutua 2002).
Während diese erste Kritikvariante auf eine historisierende Genugtuung durch postkoloniale „Gegengeschichten“ hinarbeitet, geht es der zweiten Kritikvariante um eine fundamentale Diskreditierung der Menschenrechtsidee. Wahlweise wird die Rhetorik der Menschenrechte dann als ein scheinheiliges Herrschaftsinstrument zur Durchsetzung nationalistischer, imperialer, rassistischer, religionsfeindlicher, sexistischer oder kapitalistischer Interessen vorgeführt. Auch wenn diese Kritik beizeiten berechtigt ist, weil es offenkundig vorkommt, dass sich politische Machthaber die Rhetorik der Menschenrechte zynisch zunutze machen: Das Resultat dieser fundamentalkritischen Abgesänge ist allzu oft eine „neue“ intellektuelle Feier radikaler Ungleichheit und „präskriptiv-ideologischer“ Gruppenzugehörigkeiten (Scheller 2021), die das gemeinsame Menschsein leugnen oder doch zumindest für normativ irrelevant halten. Stattdessen werden radikale Differenzen markiert und vormals Unterdrückte unumwunden zu Überlegenen erklärt, womit der Spieß ganz einfach umgedreht ist: Der westliche Universalismus der Aufklärung sei es, der historisch rückständig, philosophisch naiv und politisch gefährlich agiere (etwa im Anschluss an Spivak 2008).
Erben der Aufklärung
Damit sind wir unmittelbar bei einer zweiten Verwirrung angelangt. Sie betrifft das – jeweils auch von Sarasin, Boehm oder Neiman – problematisierte „Erbe“ der Aufklärung. Bei genauerem Hinsehen ist gar nicht recht klar, wer dieses Erbe antritt oder aber ausschlägt: die universalistischen Verteidiger der Menschenrechte oder aber deren postkolonialen Kritiker:innen? Denn Letztere verstehen ihre Kritik an westlichen Selbstbespiegelungen oft ja selbst als dekonstruktive Mitwirkung an einem noch unvollendeten Projekt, das es durch Aufdeckung destruktiver Machtgrammatiken und ungenutzter Potenziale allererst über sich selbst aufzuklären gilt. Diese Verwirrung wird nachvollziehbar, wenn man sich eine grundlegende, aber doch häufig übersehen Spannung innerhalb des Projekts der Aufklärung bewusst macht. Die gemeinte Aufklärung hat gleich zwei Denkbewegungen in Gang gesetzt, deren Unverträglichkeit bis heute der Aufhebung harrt.
Da ist zum einen Immanuel Kants „Sapere aude!“ und damit die geschichtsphilosophische Hoffnung auf eine weltumfassende Ausbreitung autonomen Vernunftgebrauchs, der in moralischer, politischer und auch rechtlicher Hinsicht zu einem Zuwachs an Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Frieden, Menschenwürde und Menschenrechten führen soll. Und da ist zum anderen ein sich mit derselben Aufklärung ausbreitender Skeptizismus, der keineswegs „unkantisch“ klingt und besagt: Hüte dich vor den Verkündern ewiger Wahrheiten! Und mithin vor all jenen, die ein traditionelles, religiöses oder wissenschaftliches Herrschaftswissen „verwalten“, um damit ihre Macht zu stabilisieren. Heute aber schlägt dieses Zweifeln zunehmend in einen Relativismus weltanschaulicher Beliebigkeit um: Ist das jeweils „vorherrschende“ Wissen nicht immer bloß das Resultat einer über Jahrhunderte währenden Geschichte der Unterdrückung marginalisierter Wissensformen?
Dieser Skeptizismus mag für viele Kritiker:innen intellektueller Balsam sein, doch beim aktuellen Stand unzureichender Vermittlung untergräbt das skeptische Teilprojekt der Aufklärung das emanzipativ-politische. Selbst dort, wo die postkoloniale Kritik sich erklärtermaßen selbst für emanzipativ und progressiv hält, lebt diese Kritik meist von begrifflichen und auch normativen Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann (dazu auch Feige 2022, Kap. 3). In Politik und Alltag jedenfalls führt diese Skepsis zu massiven Verunsicherungen, denn man kann ersichtlich nicht beides zugleich haben: ein starkes, selbstbewusstes Plädoyer für Vernunft, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenwürde, Menschenrechte und doch zugleich auch die relativistische Weigerung, eine jeweils bestimmte Leitidee als für alle Menschen gleichermaßen und damit „universell“ verbindlich zu akzeptieren.
Mit Blick auf die Menschenrechte bedeutet dies ganz konkret: Relativistische Abgesänge sehen allzu vorschnell von den Schicksalen all jener Menschen ab, die jeweils vor Ort, ob in Butscha, Charkiw, Mariupol, ob in Aleppo, Mossul, Xinjiang, ob in Israel oder in den palästinensischen Autonomiegebieten von Kriegsverbrechen, regierungsamtlichem Terror oder schweren Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. „Im Chor der Opfer gibt es keine Dissonanzen“, hat der Völkerrechter Eckart Klein einmal gesagt. Man sollte deshalb nicht vorschnell bestreiten, dass diesen Menschen ein mitunter grauenhaftes Unrecht geschieht, das sehr wohl in menschenrechtlicher Begrifflichkeit rekonstruiert werden kann. Es mag als akademische Geste „progressiv“ anmuten, die Menschenrechte zu Komplizinnen politischen Unrechts zu stempeln. Doch auch wenn man keineswegs abzustreiten braucht, dass die Rhetorik der Menschenrechte beizeiten instrumentalisiert wird: Den Leidtragenden selbst ist man mit diesen intellektuellen Abgesängen keine Hilfe.
Der neue Universalismus
Insgesamt mag es also schwerfallen, mit Blick auf die Aufklärung von einem eindeutigen „Erbe“ zu sprechen. Denn es ist dieselbe Aufklärung, die sowohl den Universalismus der Menschenrechte als auch viele ihrer heutigen Gegner:innen hervorgebracht hat. Zu dieser Einsicht muss kommen, wer die Aufklärung neuerlich über sich selbst aufklären will. Und nur so kann dann auch ein „neues“ Verständnis von Universalismus Konturen gewinnen. Die bisherige Menschenrechtsdebatte jedenfalls leidet daran, diesen Universalismus entweder – philosophisch herkömmlich – als ein empirisch bereits gegebenes, „absolut“ begründbares Faktum zu verstehen oder aber – wie etwa Sarasin – als eine historisch kontingente Erfindung, für die es zwar zu streiten gilt, ohne dass es dafür aber eine allgemeinverbindliche Begründung gäbe. Folglich müsste man sich zwischen den beiden Positionen „Die Menschenrechte gelten bereits universell“ und „Die Menschenrechte gelten gerade nicht universell“ entscheiden. Doch muss man das tatsächlich?
Meine eigenen Überlegungen verstehen den Universalismus der Menschenrechte weder als empirische Gegebenheit noch als ein historisch kontingentes Konstrukt, sondern als ein dezidiert politisches, historisch umkämpftes und mithin revolutionäres „Projekt“ (Pollmann 2022). Der begrifflich zentrale Punkt ist zunächst: Die Frage, ob die Menschenrechte universell gelten, ist von vornherein falsch gestellt. Denn die konzeptionell angemessene Frage ist, ob die Menschenrechte universalisierbar sind. Man kann sich dies an einem historischen Beispiel klarmachen: Im revolutionären 18. Jahrhundert erklären „die“ Franzosen die Menschenrechte. Aber wie die postkoloniale Kritik im Rückblick völlig zurecht beklagt: Damit waren keineswegs die Rechte aller Menschen gemeint. Der männliche, freie, weiße Franzose des Dritten Stands sagt zu dem Adeligen: „Du und ich, wir sind doch beide gleichermaßen Mensch, und daher haben wir auch dieselben Menschenrechte“. Doch das bedeutet nicht, dass auch alle anderen Menschen, z.B. unfreie und nicht-weiße Personen, Frauen und Kinder, Arbeiterschaft und Landbevölkerung, nicht-heterosexuelle oder non-binäre Personen, geistig schwerbehinderte Menschen, Migrant:innen oder „Fremde“ ebenfalls dieselben Rechte gehabt hätten.
Trotzdem scheint auch hier bereits das Potenzial menschenrechtlicher Universalisierung auf, das von Ferne an Georg Wilhelm Friedrich Hegels „List der Vernunft“ erinnert. Das Projekt dieser Universalisierung treiben selbst jene voran, die zwar „Menschenrechte“ sagen, damit aber am Ende doch nicht alle Menschen meinen. Bereits der Begriff der Menschenrechte „transzendiert“ den normativen Horizont all jener, die sich zu unterschiedlichsten Zeiten darauf berufen haben. Was historisch jeweils folgt, ist ein politischer Kampf um Einlösung eines immer schon gegebenen, aber meist noch unzureichend verstandenen Versprechens fortschreitender Nicht-Diskriminierung – und damit die anhaltend umstrittene Inklusion vormals marginalisierter oder gar exkludierter Gruppen in den gemeinsamen Geltungsbereich der Menschenrechte, die auf diese Weise sukzessive, aber keineswegs unumkehrbar universalisiert werden.
Das ist die „Radikalität“ des menschenrechtlichen Universalismus: Es handelt sich um ein umkämpftes, unabschließbares Projekt. Und auch Boehm scheint etwas ganz Ähnliches im Sinn zu haben, wenn es schreibt: „Für wahre Universalisten aber sollte das »Wir« nie der Beginn von Politik sein; es kann lediglich ihr niemals endgültiges Resultat sein“ (Boehm 2022, 111). Wer das durchaus verletzliche Kind der Menschenrechte mit dem postkolonial geprüften Bade „westlicher Werte“ ausschüttet, mag so mit Blick auf den globalen Kampf gegen politische Inhumanität am Ende schädlicher sein als jene, die zwar „Menschenrechte“ sagen, damit aber nicht schon alle Menschen meinen. Vielleicht aber wird man sich im Streit zwischen „absoluten“ Begründungen universeller Gleichheitsansprüche und deren postkolonialen Kritiker:innen auf das Folgende bereits einigen können: Der Universalitätsanspruch der Menschenrechte ist ein Anspruch und seit jeher als die revolutionäre Mahnung zu verstehen, die politischen Herrschaftsverhältnisse nicht einfach als „naturgegeben“ aufzufassen, sondern als „menschengemacht“; als stets nur vorläufige Machtverhältnisse, die keineswegs so beschaffen sein müssen, wie sie es derzeit sind.
Arnd Pollmann lehrt Ethik und Sozialphilosophie am der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Zuletzt ist bei Suhrkamp das Buch „Menschenrechte und Menschenwürde. Zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts“ (Berlin 2022) erschienen. Er ist u.a. Mitherausgeber der Zeitschrift für Menschenrechte und kommentiert regelmäßig auch im Radio und in Wochenzeitungen tagespolitische Themen aus philosophischer Sicht.
Literatur
Boehm, Omri: Israel – eine Utopie, Berlin 2020.
Boehm, Omri: Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität, Berlin 2022.
Feige, Daniel M.: Die Natur des Menschen, Berlin 2022.
Mutua, Makau: Human Rights. A Political and Cultural Critique, Philadelphia 2002.
Neiman, Susan: Links≠woke, Berlin 2023.
Pollmann, Arnd: Menschenrechte und Menschenwürde. Zur philosophischen Bedeutung eines revolutionären Projekts, Berlin 2022.
Scheller, Jörg: Identität im Zwielicht. Perspektiven für eine offene Gesellschaft, München 2021.
Spivak, Gayatri Chakravorty: Righting Wrongs – Unrecht richten, Zürich 2008.
[*] Die Redaktion von Geschichte der Gegenwart hatte den vorliegenden Text, der ursprünglich als Replik auf Sarasin gedacht war, bei mir angefragt. Von einer Veröffentlichung nahm der Blog dann überraschend Abstand, und zwar mit der Begründung, man veröffentliche keine Repliken. Ich danke den Herausgeber:innen von Praefaktisch für die Veröffentlichung an dieser Stelle.




