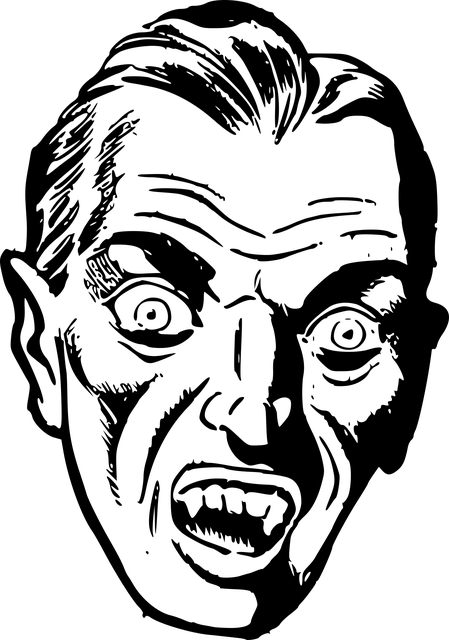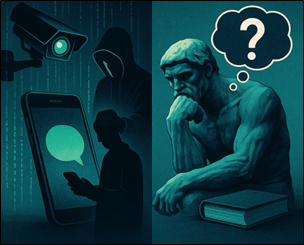Mind the GAP, Teil II
Zur Preisfrage 2021 der GAP: “Was haben Platon, Kant oder Arendt besser verstanden als die gegenwärtige analytische Philosophie?”
Von Daniel-Pascal Zorn und Martin Lenz
Die diesjährige Preisfrage der GAP scheint auf das Verhältnis der gegenwärtigen analytischen Philosophie zur Geschichte zu zielen. Die Frage ist wichtig, hat in der gegebenen Form jedoch zumindest in den sozialen Medien ein gewisses Erstaunen ausgelöst. Da wir an einem Dialog über diese Frage interessiert sind und rasch feststellten, dass unsere Bedenken konvergieren, haben wir uns entschlossen, zwei Dinge zu tun: Erstens möchten wir die Vorannahmen der Frage näher betrachten (Teil I hier); zweitens möchten wir Kriterien möglicher Antworten ausloten.
Teil II: Kriterien für mögliche Antworten (Daniel-Pascal Zorn)
Wie könnte nun eine sinnvolle Antwort aussehen, bei der auch diejenigen, die eine solche Frage formulieren, etwas lernen können? Klar ist, dass eine solche Antwort nicht einfach davon ausgehen darf, dass das „Was“, wonach die Frage fragt, ein schon irgendwie von irgendwoher festgelegter Gegenstandsbereich ist, zu dem es verschiedene Meinungen gibt, von denen dann eine „besser“ ausfallen kann als die andere. Ebenso klar ist, dass auch das „besser“ nicht einfach einen Maßstab voraussetzen kann, mit dem man philosophische Lehrmeinungen misst. Wo sollte dieser Maßstab herkommen? Schließlich muss auch das „verstanden“ von der stillen Voraussetzung befreit werden, die sich durch die allzu enge Bindung an das „Was“ ergibt. Wer ein Urteil über die philosophische Tradition fällen will, kann nicht einfach davon ausgehen, dass Philosophie „Theorien über etwas“ aufstellt – eine Vorstellung, die vor allem bei Vertreter:innen der analytischen Philosophie weit verbreitet ist.
Es geht, so teilt uns die Erläuterung der GAP mit, um „das Verhältnis zwischen Philosophiegeschichte und analytischer Philosophie“. Also dürfen die Vorstellungen der analytischen Philosophie, was aus ihrer Sicht „gute“ Philosophie ausmacht, bei dieser Beurteilung keine Rolle spielen. Andernfalls würde sich die Beantwortung der Frage in einen Zirkel verstricken: Sie würde als Maßstab die Analytische Philosophie voraussetzen, um das Verhältnis der Analytischen Philosophie zur Philosophiegeschichte zu beurteilen. Umgekehrt kann aber aus dem gleichen Grund auch keine einzelne Philosophie der Philosophiegeschichte diesen Maßstab abgeben. Das wirft das Problem auf, von wo aus die Frage der GAP eigentlich beantwortet werden kann?
Kehren wir noch einmal zur Fragestellung zurück. Gefragt wird: Was hat die Philosophiegeschichte besser verstanden als die Analytische Philosophie? Bei näherem Hinsehen ist die Frage schief gestellt. Sie ist schief darin, dass auch die analytische Philosophie zur Philosophiegeschichte gehört. Sollen beide miteinander in einen Vergleich gebracht werden, bei dem beurteilt werden kann, welche von beiden etwas „besser verstanden“ hat als die andere, dann impliziert das, dass mit „die analytische Philosophie“ nur die gegenwärtige analytische Philosophie gemeint sein kann, die dann jeder vergangenen Philosophie gegenübergestellt wird. Zugleich wird gefragt, was die Philosophie der Philosophiegeschichte – für die Platon, Kant und Arendt exemplarisch stehen sollen – besser verstanden hat als die analytische Philosophie. Es handelt sich damit eigentlich um zwei Fragen: Was hat die Vergangenheit besser verstanden als die Gegenwart? Was haben nichtanalytische Philosoph:innen der philosophischen Tradition besser verstanden als die Philosoph:innen der analytischen Tradition?
Die Frage danach, was die Vergangenheit besser verstanden hat als die Gegenwart setzt voraus, dass zu zeigen ist, inwiefern die Vergangenheit die Gegenwart übertrifft. Aus philosophischer Sicht ist das zunächst keine besonders sinnvolle Frage, da bloße Zeiteinteilungen nichts über die Qualität von philosophischen Texten implizieren. Ob eine Philosophie 1756 oder 2011 verfasst wurde, sagt nichts darüber aus, ob die eine etwas „besser versteht“ als die andere, wenn es nicht gerade um bloß inhaltliches, zeitgebundenes Wissen geht, bei dem die Frage trivial wird: Der allgemeine Wissensstand ist 2011 natürlich größer als 1756, weswegen man unter dieser Voraussetzung etliche Beispiele dafür finden wird, dass man 2011 etwas „besser verstanden“ hat als 1756.
Aber die Frage der GAP fragt nicht nach dem allgemeinen Wissensstand, sondern nach Philosophie. Setzt man nicht – wie analytische Philosoph:innen das häufig tun – voraus, dass Philosophie immer nach dem Modell naturwissenschaftlicher Forschung, also als Theorie von etwas, als rein inhaltliche Argumentation zu einem festgelegten Gegenstandsbereich verstanden werden muss, fällt das reduktive Verständnis aus, die Philosophie sei ein Wissensgebiet unter anderen und daher prinzipiell vom gleichen Wissensfortschritt betroffen wie andere Wissensgebiete, etwa der Naturwissenschaften. Wenn aber diese Voraussetzung wegfällt, warum sollte man danach fragen, inwiefern die Vergangenheit die Gegenwart übertrifft, jene etwas „besser versteht“ als diese? Eine solche Frage macht nur dann Sinn, wenn man die teleologische Voraussetzung macht, dass die Gegenwart prinzipiell der Vergangenheit überlegen ist. Das ist ein Schema, das nicht in die Kategorie der Philosophiegeschichte, sondern in die der Geschichtsphilosophie gehört. Es identifiziert die Gegenwart mit Fortschritt und die Vergangenheit mit Rückschritt und es ist selbst historisch. Das Schema gehört in die Zeit um 1800, als in den lauter werdenden politischen Forderungen, die unter dem Eindruck der Französischen Revolution und der Säkularisierung formuliert werden, die alte Ordnung verabschiedet wird. Es handelt sich also um eine philosophische Interpretation der Geschichte.
Diese Interpretation ist in sich problematisch. Wer die Gegenwart zum Maßstab erklärt, für den ist alles Historische mangelhaft und ungenügend. Wer zugleich diesen gegenwärtigen Standpunkt selbst vertritt, dessen Legitimation ist gesichert: Wo man selbst steht, ist immer vorne. Man vertritt das bestmögliche Wissen, die bestmöglichen Theorien, hat die bestmöglichen Methoden und ein bestmögliches Verständnis der eigenen Disziplin. Wieder sind es vor allem analytische Philosoph:innen, die ein solches Bild von der Vergangenheit pflegen: „Tote Philosophen interessieren uns nicht“, lautet das Credo. Wo sie doch interessieren, etwa um Lehrstühle mit historischer Denomination besetzen zu können, interessieren sie als Vorläufer des gegenwärtigen, also immer schon besseren Wissens. Verbindet sich diese teleologische Vorstellung mit dem Ressentiment gegenüber einer „Spökenkiekerei“, einer Metaphysik also, die sich naive Vorstellungen macht, kann man jede historische Position zur infantilen Vorstufe der eigenen Gegenwart degradieren. Das ist, seit dem 19. Jahrhundert, die Geschichtsphilosophie des Positivismus: die Geschichte als Stufenleiter, deren höchste Stufe man in der Gegenwart erklommen hat.
Wenn also die GAP danach fragt, was „die Philosophiegeschichte“ „besser verstanden“ hat als „die analytische Philosophie“, dann stellt sie eigentlich ein solches teleologisches Verständnis in Frage. Unter der Voraussetzung aber, dass Philosophie immer Theorie von etwas ist, wird diese Infragestellung ambivalent. Denn in diesem Fall setzt man ja das Philosophieverständnis der GAP voraus, um das Philosophieverständnis der GAP in Frage zu stellen. Es wäre dann gefordert, zu zeigen, welche Gegenstände Philosoph:innen wie Platon, Kant oder Arendt „besser verstanden“ haben als die analytische Philosophie. Solange man die Philosophie aber auf diese Weise zu einem Wissensgebiet erklärt, ist die Antwort trivial, denn man kann, wie gesagt, immer zeigen, dass das heutige Wissen größer ist als das vor 70, 220 oder 2400 Jahren. Erst, wenn man diese Voraussetzung konsequent weglässt, eröffnet sich ein weites Feld für die Beantwortung der Frage.
Dieses Feld wird durch die Frage selbst eröffnet. Wie sich gezeigt hat, ist schon die Entgegensetzung von „Philosophiegeschichte“ und „analytischer Philosophie“ problematisch. Die GAP hat diese Problematik nicht nur nicht reflektiert, sie hat sie durch ihre Erläuterung sogar erst geschaffen: Nämlich indem sie den Gegenstandsbereich auf die Philosophiegeschichte ausgeweitet hat. Ist die analytische Philosophie selbst Teil der Philosophiegeschichte, ist die Frage danach, welche etwas „besser verstanden“ hat, sinnlos: Sobald die analytische Philosophie etwas „besser verstanden“ hat, gilt das auch für die Philosophiegeschichte. Die Gegenüberstellung macht nur Sinn unter der stillen Voraussetzung, dass die analytische Philosophie die Gegenwart und die Philosophiegeschichte die Vergangenheit repräsentiert. Dann aber eröffnet sich der Problembereich, der gerade dargelegt wurde und das Zirkelproblem einer teleologischen Weltanschauung.
Eine Reflexion der Selbstbestimmung
Kehren wir zu der Frage vom Anfang zurück: Wie könnte eine sinnvolle Antwort aussehen, bei der auch diejenigen, die eine solche Frage formulieren etwas lernen können? Eine solche Antwort müsste die genannten Voraussetzungen vermeiden, um das Zirkelproblem einer teleologischen Weltanschauung zu vermeiden. Formulieren wir die Frage also offener, ganz im Sinne einer philosophischen Preisfrage: Was haben die Positionen der philosophischen Tradition besser verstanden als die gegenwärtige analytische Philosophie? – Worauf haben sich die Positionen der philosophischen Tradition besser verstanden als die gegenwärtige analytische Philosophie? – Schließlich: Inwiefern haben sich die Positionen der philosophischen Tradition selbst besser verstanden als die gegenwärtige analytische Philosophie sich selbst versteht?
Die einfachste Antwort ergibt sich wieder aus der Fragestellung selbst. Die philosophische Tradition ist nicht weiter spezifiziert – sie wird als „die Philosophiegeschichte“ angegeben, also als die Philosophie, von der Antike bis in die jüngste Vergangenheit, exklusive der analytischen Philosophie der Gegenwart. Da sich die analytische Philosophie selbst bestimmt, also mittels bestimmter Voraussetzungen selbst begrenzt, wären diese selbst auferlegten Grenzen die erste Anlaufstelle für eine Prüfung. Eine solche Prüfung entspricht der bereits oben gestellten Frage: Was haben nichtanalytische Philosoph:innen der philosophischen Tradition besser verstanden als die Philosoph:innen der analytischen Tradition?
Das Kriterium für das „besser verstanden“ hängt damit ab von der Selbstbestimmung und Selbstbegrenzung der analytischen Philosophie, die sie allererst als analytische – in Abgrenzung von nichtanalytischer – und als gegenwärtige – in Abgrenzung von historischer – Philosophie möglich macht. Gibt sie die erste Bestimmung auf, lautet die Frage: Was hat die Philosophiegeschichte – also die Philosophie – besser verstanden als die Philosophie? Gibt sie die zweite Bestimmung auf, lautet die Frage: Was hat die Philosophiegeschichte besser verstanden als eine Position, die zu dieser Philosophiegeschichte gehört? Die beiden Kriterien „nichtanalytisch“ und „gegenwärtig“ sind damit notwendige Voraussetzungen, um die Frage stellen und also auch beantworten zu können. Sie sind zugleich die beiden Voraussetzungen, mit denen sich die beschriebenen Probleme ergeben.
Beginnen wir mit der zweiten, impliziten Selbstbestimmung, dem „gegenwärtig“: Diese Voraussetzung ist, wie oben gezeigt wurde, problematisch, denn sie führt in ein zirkuläres Verständnis von Philosophie, einen Bestätigungsfehler. Wenn die Gegenwart der Maßstab ist, dann fällt dagegen alles Vergangene als mangelhafte Vorstufe ab. Um die Frage, was die Vergangenheit „besser verstanden“ hat als die Gegenwart ohne diesen Zirkel beantworten zu können, muss man die Voraussetzung aufgeben, die den Bestätigungsfehler erzeugt. Ist die Gegenwart nicht mehr der Maßstab für die Beurteilung des „besser verstanden“, kann man also nun fragen: Was hat die Vergangenheit „besser verstanden“ als die Gegenwart – ohne dass das gegenwärtige Verständnis von Philosophie von Vornherein der Maßstab der Beurteilung ist?
Die erste, explizite Selbstbestimmung lautet „analytisch“. Es ist unklar, was das besagen soll.[1] Analytische Urteile legen das auseinander, was schon vorausgesetzt ist. Eine analytische Philosophie käme, so verstanden, immer zu spät. Sie würde nur auseinanderlegen, was sie schon als gültig vorausgesetzt hat. Tatsächlich ist das eine Vorgehensweise, die sich in der analytischen Philosophie oft beobachten lässt: Es werden eine ganze Menge Annahmen über die Natur der Sprache, die Natur der Dinge, darüber, was Philosophie ist usw. gemacht – und vor dem Hintergrund dieser extrem voraussetzungsreichen Rahmenbedingungen spielt man dann mit und an den Variablen herum, die noch veränderbar sind. Das kann man Philosophie nennen, aber es wäre eher so etwas wie eine extrem – und unnötig – beschränkte Binnenphilosophie. Viele analytische Philosoph:innen würden allerdings wohl bestreiten, dass sie so etwas tun.
Nehmen wir also an, „analytisch“ bezieht sich eher auf ein Set von vorphilosophischen Überzeugungen, die man mit anderen teilt. Zum Beispiel teilt man einen gemeinsamen Begriff von Ontologie. Man glaubt, dass die Welt, so wie sie ist, erkennbar ist. Oder man ist überzeugt davon, dass Paradoxien wahre Widersprüche sind. Analytische Philosophie wäre dann so etwas wie ein Pool möglicher Überzeugungen, die man hat und in deren Grenzregionen man dann mit anderen Diskussionen führt, um zu sehen, ob die eigenen Überzeugungen halten. Doch auch in diesem Fall würde man etliche Voraussetzungen machen, die unhinterfragt bleiben – angefangen von dem Missverständnis, Philosophie sei so etwas wie ein „educated guess“ einer individuellen Gedankenwelt, die man auf einem Meinungsmarkt zur Geltung bringt, bis zu problematischen Begriffen wie „Ontologie“, „Welt“ und „Paradoxie“ und noch in Voraussetzungen der Art „so wie sie ist“.
Kant, Platon, Arendt
Immanuel Kant, nach dem exemplarisch in der Fragestellung der GAP gefragt wird, hat genau solche Voraussetzungen in seiner Kritik der reinen Vernunft zum Problem gemacht. Sein Gegenspieler ist die wolffianische Schulphilosophie, eine Richtung, die der heutigen analytischen Philosophie nicht unähnlich ist. Lustigerweise ist diese Schulphilosophie auch die Vertreterin einer „Metaphysik“, gegen die die frühe analytische Philosophie – die also schon zur Philosophiegeschichte gehört – polemisiert. Die Wolffianer gehen davon aus, dass die Welt so ist wie sie ist, unabhängig von unserer Erfahrung. Ihr Vorschlag lautet, diese Welt begrifflich und mathematisch präzise und vollständig zu beschreiben. Immanuel Kant erkennt in diesem Vorschlag ein Problem, mithilfe des Skeptizismus von David Hume, der ihn, wie er schreibt, aus seinem „dogmatischen Schlummer“ geweckt habe: Wenn wir voraussetzen, dass sie Welt so ist wie sie ist, unabhängig von unserer Erfahrung, dann stellt sich die Frage, woher wir eigentlich wissen, dass die Welt so ist wie sie ist. Ist diese Aussage nicht schon Ausdruck unserer Erfahrung?
Die Wolffianer vertreten, so Kant im Paralogismus-Kapitel seiner Kritik der reinen Vernunft, einen Dogmatismus der Außenwelt. Doch auf seiner Rückseite ist dieser Dogmatismus, wie die Skeptizisten erkennen, widersprüchlich: Wenn das Kriterium, dass ein Ding wirklich erkannt ist, immer schon im Ding liegt, wissen wir nie, ob wir es erreicht haben. Wir könnten uns immer täuschen, denn jeder weitere Beleg wäre doch wieder nur unabhängig von unserer Erfahrung. Wir hätten uns mit der Voraussetzung der Wolffianer das Kriterium dafür, dass wir die Welt richtig beschreiben, selbst entzogen. Deswegen müssen die Wolffianer die Welt dogmatisch voraussetzen und folgern die Skeptizisten – unter dieser Voraussetzung korrekt –, dass die Welt dann nie sicher erkennbar wäre, weil wir immer durch die Voraussetzung „unabhängig von unserer Erfahrung“ davon getrennt wären. Kants Vorschlag lautet aber nicht etwa, eine andere Theorie von der Welt an die Stelle der Theorie der Wolffianer zu setzen. Er vertritt ebenso wenig die Position der Skeptizisten, die behaupten, man könne die Welt nicht erkennen. Das „Ding an sich“, das Kant als unerkennbar ausweist, ist eine begriffliche Konstruktion der Wolffianer. Es ist unerkennbar, weil es – qua Voraussetzung – unabhängig von unserer Erfahrung ist. Kant setzt dagegen eine Doppelperspektive: Wir müssen nicht voraussetzen, dass die Welt so ist wie sie ist, um sie erkennen zu können. Wir können uns mit weniger zufriedengeben und empirische Urteile fällen, die immer wieder überprüft werden können.
Das, was die Wolffianer in die Welt hineinlegen, um ihre These zu sichern, die notwendige Voraussetzung der Welt wie sie ist, hat nach Kant einen ganz anderen Ort: Den Begriff und das Argument. Die empirische Beschreibung der Welt wird so für ihn ergänzt durch eine begriffliche Explikation der Voraussetzungen dieser Beschreibung. Nicht als Theorie eines psychischen Vorgangs des Erkennens, sondern als Frage nach der Rechtfertigbarkeit eines Arguments – quid juris, nicht quid facti, wie Kant explizit festhält. Kant versucht zu zeigen, dass „die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung … zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung sind“ und noch die Explikation dieser Bedingungen möglich machen. Der Bezug auf den Gegenstand ist zugleich der Bezug auf diesen Bezug. Das Dilemma, in dem Dogmatiker und Skeptizisten kreisen, ist ein Selbstmissverständnis, das aus einer einseitigen Prämisse entsteht.
Interessant an diesem Argument Kants ist im Kontext dieses Textes weniger die erkenntnistheoretische Pointe. Es ist der Aufweis, dass eine philosophische Position sich selbst missverstehen kann und dann in Aporien gerät, der Kants Argument für die Fragestellung der GAP bedeutsam macht. Kant stellt fest, dass eine einzige Prämisse ausreicht, um ein ganzes schulphilosophisches Paradigma in unlösbare Probleme zu stürzen. Und er gibt ein Beispiel, wie man ein solches Dilemma auflöst: Man gibt die Prämisse auf und stellt sich die Kriterienfrage neu; man übernimmt nicht einfach schulphilosophische Einteilungen, sondern differenziert Hinsichten der Explikation
Diese Vorgehensweise ist allerdings nichts, was Kant erfunden hätte. Auch in Platons Dialogen geht es immer wieder darum, dass Bestimmungen und Selbstbestimmungen den Weg zu einer Lösung verstellen. Im Dialog Sophistes soll es darum gehen, den Sophisten zu bestimmen, in Abgrenzung zum Philosophen. Der Fremde aus Elea, der die Rolle des schweigenden Sokrates angenommen hat, versucht mit seinem jungen Gesprächspartner Theaitetos das Problem zu lösen. Doch der Weg ist steinig und schwierig. Als sie glauben, den Sophisten gefunden zu haben, bestimmen sie ihn auf eine Weise, die es rechtfertigt, sie selbst für Sophisten zu halten. Der Sophist, so bestimmen sie, ist jemand, der Philosophie nur vortäuscht, der nur zum Schein Philosoph ist. Doch Begriffe wie Schein und Täuschung implizieren ein Wissen von etwas, das nicht wirklich ist, das falsches Sein ist.
Der Sophist, sagt der Fremde, ist „gar schön und schlau in einen höchst schwierig zu erforschenden Begriff hineingeschlüpft“, den Begriff des Nichtseienden. Erst als sie sich der Aufgabe stellen, die Frage zu klären, wie man vom Nichtseienden sprechen kann, ohne dabei in einen Widerspruch zu geraten, können sie am Ende auch bestimmen, was den Sophisten ausmacht, im Unterschied zum Philosophen. Auch hier ist es nicht die Bestimmung des Sophisten oder die Diskussion des Nichtseins, die Platons Dialog für die Frage der GAP interessant macht. Es ist die radikale Unsicherheit, in der der Fremde aus Elea und Theaitetos sich befinden, die zu dem zeitweisen Problem führt, dass der, der sich von etwas abgrenzen will, durch die Art und Weise der Abgrenzung selbst zu dem wird, wovon er sich abgrenzen will: „Damit würden die Sprechenden … selbst zu dem, was sie als ihren Gegner zu suchen haben; sie werden beinahe selbst zur … Sache; wollen sie ihre Gegner bessern, so sind sie es selbst.“[2]
Übertragen auf die Frage, was die philosophische Tradition „besser verstanden“ hat als „die analytische Philosophie“, könnte man antworten: In der philosophischen Tradition finden sich Beispiele dafür, wie eine Selbstbestimmung durch Abgrenzung – als Philosoph in Abgrenzung vom Sophisten oder als analytische Philosophie in Abgrenzung von der Philosophiegeschichte – das Problem, das durch die Abgrenzung gelöst werden sollte, auf eine neue, reflexive und durchaus schwierige Weise stellt. Mit einem etwas plakativen Beispiel gesagt: Vielleicht ist es kein Zufall, dass die analytische Philosophie, die als harte, positivistische und wissenschaftsorientierte Abgrenzung von der philosophischen „Metaphysik“ begann, in ihrer gegenwärtigen Form exakt diese „Metaphysik“ als eine ihrer Schulformen, als analytische Ontologie, vertritt.
Das Festlegen von Schulformen, Gegenstandsbereichen, Standardmethoden oder -begriffen ist in der Philosophie immer ein Zeichen dafür, dass man versucht ist, in bestimmten Bereichen allzu kritische Fragen nicht mehr zuzulassen. Die Berufung auf populär vertretbare Forderungen wie „Verständlichkeit“ oder „Klarheit“, die man angeblich selbst vertritt, während andere sie ebenso angeblich verweigern, ist eine Form der Polemik, mittels derer man sich der Zustimmung der Masse, der Öffentlichkeit zu versichern versucht. Der Zirkel, der darin liegt, das eigene Paradigma als Maßstab vorauszusetzen, um dann festzustellen, dass Philosoph:innen, die dieses Paradigma nicht teilen, „unverständlich“ erscheinen, lässt sich gut als theoriepolitisches Mittel einsetzen. Denn wenn man selbst immer wieder die Wissenschaftlichkeit der eigenen Position betont und andere philosophische Positionen wie wirre Gedankenkonstrukte fragwürdiger Herkunft aussehen lässt, dann hat man natürlich diejenigen auf seiner Seite, die schon einmal bei der Hegel- oder Schellinglektüre gescheitert sind und ganz sicher diejenigen, die ein grundsätzliches Ressentiment gegen die Philosophie pflegen und sich dafür nun auf philosophische Autoritäten berufen können.
Solche Praktiken stehen, so Hannah Arendt in ihrem Buch Sokrates. Apologie der Pluralität, der Philosophie aber diametral entgegen. „Der Unterschied zwischen den Philosophen (deren Anzahl klein ist) und der Menge liegt […] darin“, dass die Menge das Erstaunen, die Praxis radikalen Fragens, die die Philosophie auszeichnet, „nicht ertragen will.“ (78-79) Und dieses Nichtertragen, die Verweigerung der Radikalität äußert sich gerade darin, dass man Meinungen zum Kriterium der Philosophie macht. Man richtet sich in einem Relativismus von Lehrmeinungen ein, die gar nicht mehr dazu kommen, die eigenen Voraussetzungen zu reflektieren. Zugleich identifiziert man die eigene Position mit der bestmöglichen Form von Philosophie, zu der alle anderen Formen nur noch eine mangelhafte Vorstufe bilden. Der Philosoph, so Arendt, der vor der Radikalität seiner Frage nicht flieht, „ist der Einzige, der … keine klar definierte und deutliche doxa“, also Meinung, „hat, die mit den anderen Meinungen konkurrieren könnte … Ihm fehlt jener sechste Sinn, … der uns … in eine gemeinsame Welt stellt und so diese überhaupt erst möglich macht.“
Philosoph zu sein, so Arendt, bedeutet also gerade nicht, ständig die gemeinsame Welt zu betonen, ständig populäre Positionen zu vertreten, möglichst viele Lehrstühle zu besetzen, möglichst breit das eigene Paradigma zu verbreiten. Es bedeutet erst recht nicht, immer schon so zu sprechen, dass man für alle anderen „verständlich“ ist – denn in dieser Verständlichkeit liegen gerade jene Voraussetzungen, die die Philosophin hinterfragt und das auf radikale Weise. „Wenn der Philosoph beginnt, in diese Welt“ der vorausgesetzten Selbstverständlichkeit „hineinzusprechen, wird er immer versucht sein, in Begriffen des Unsinns zu reden, oder gemäß der Logik … der verkehrten Welt“. Das ist kein Plädoyer für Nonsens, sondern eine perspektivische Aussage: Aus Sicht des Menschen in der Welt, der populären analytischen Philosophen applaudiert, weil sie das untersuchen, was er verstehen kann, weil er es voraussetzt, ist das, worin derjenige lebt, der diese Voraussetzungen nicht wie selbstverständlich macht, eine „verkehrte Welt“. Das ist die Herausforderung der Philosophie – aber es ist nur ihre eine, radikale, notwendigerweise welt-fremde Weise.
Die andere Seite, so Arendt, besteht darin, dass auch der Philosoph am Gespräch aller mit allen teilnimmt. Die Philosophie ist nichts, was im stillen Kämmerlein zusammengebraut wird, sie entfaltet sich in der Praxis. Während sie es strikt vermeidet, der Masse zu gefallen oder selbst meinungsförmig zu werden, besteht ihre Eigenart gerade darin, erst im gemeinsamen Gespräch Philosophie zu sein. „Der Unterschied“ des Philosophen „zu seinen Mitbürgern“, so Arendt, „besteht nicht darin, dass er irgendeine besondere Wahrheit besitzt, von welcher die Menge ausgeschlossen wäre, sondern dass er immer bereit bleibt, sich dem pathos des Staunens“, der radikalen Infragestellung, „auszusetzen, und deshalb dem Dogmatismus derer entgeht, die lediglich über Meinungen verfügen.“ (80-82) Das bedeutet auch, dass man Philosophie eben nicht einfach so vermarkten oder messen kann, als handelte es sich um Theorien mit klaren Gegenstands- und Methodenkriterien oder um philosophisches Wissen, bei dem man sich wie in einem Gemischtwarenladen bedienen kann.
Es bedeutet vielmehr, dass Philosoph:in zu sein eine eigene Verantwortung impliziert, genau diese Verfestigungen durch Kritik und Prüfung aufzuweisen und zu problematisieren. Diese Verantwortung ergibt sich daraus, dass man, wenn man diese Kritik und Prüfung unterlässt,– vor allen anderen, die man mit den eigenen Meinungen beeinflusst – sich selbst in diesen Verfestigungen einsperrt. Man sieht nur noch das, was man sich selbst zu sehen ermöglicht und erlaubt hat. Je nach Voraussetzung, die man dabei macht, ist das dann nicht mehr sehr viel oder in Bezug auf die philosophische Tradition oder „die Philosophiegeschichte“ sogar nur noch ein Abklatsch dessen, was sich tatsächlich in den Texten findet.
Sich selbst besser verstehen
Worin besteht hier das Kriterium von „besser“ in „besser verstanden“? Es liegt in den genannten Beispielen darin, die Philosoph:innen vor einer Selbsttäuschung zu bewahren, die in der vorzeitigen Festlegung vermeintlichen philosophischen Wissens liegt. Gerade weil die Philosophie eine radikale Praxis ist, haben solche Festlegungen, die dann tief in die Bedingungsebene unserer Argumente und Begriffe reichen, fundamentale Konsequenzen. Man kann sich das an dem bis heute schwierigen Verhältnis verdeutlichen, das psychologische und philosophische Perspektive unterscheidet und verbindet. Die Philosophie gilt als Disziplin des Denkens und weil man mit „das Denken“ etwas bezeichnen kann, was in uns allen vorgeht, entsteht der Schein, dass Philosophie nur so etwas wie eine bessere (oder schlechtere) Psychologie ist, eine Para-Psychologie, die uns erklärt, wie Erkenntnis entsteht oder wie Denken im Kopf abläuft. Doch der überwältigende Großteil der philosophischen Tradition denkt „das Denken“ nicht auf diese Weise. Er versteht es begrifflich, argumentativ, als das Geben von Gründen und Gegengründen, als Explikation von Bedingungen und Voraussetzungen, und als kritische Überprüfung dieser Gründe, Gegengründe, Bedingungen und Voraussetzungen.
Die psychologische Erklärung reicht aber so tief in das Phänomen des „Denkens“ hinein, sogar bis zum „Unbewussten“ und „Vorrationalen“, dass es scheint, als sei das Argumentieren nur eine Weise dieses psychologisch beschriebenen Denkens. Erst wenn man darauf aufmerksam wird, dass die psychologische Beschreibung – noch vor jedem Anspruch auf Gegenstand und Methode – ein Argument darstellt, sieht man, dass es sich genau andersherum verhält: Die Philosophie, der Begriff, die Logik ist immer schon da, ganz gleich, welche Behauptung man darüber aufstellt, was Philosophie ist oder welche Disziplin sie angeblich voraussetzen muss. Auch wenn man diese Behauptung verneint, setzt man voraus, dass Verneinen etwas anderes ist als Bejahen – und wer nun beginnt, mithilfe einer vorausgesetzten Theorie festzulegen, warum diese Argumentation falsch ist, tut genau das, was die logische Beschreibung beschreibt: Er macht Voraussetzungen, er zieht Schlussfolgerungen und er widerspricht einer These.
„Besser verstehen“ bedeutet hier also gerade nicht, dass ein Gegenstandsbereich oder eine Methode „besser“ verstanden wurde. Es bedeutet, dass es Philosophien gibt, die auf die Aporien aufmerksam achtet, in die andere und sie selbst geraten und dass es Philosophien gibt, die diese Aufmerksamkeit nicht entwickeln, weil sie schon ganz genau wissen, wie man Gegenstände anspricht, welche Begriffe man benutzt und welche Standardmethoden üblich sind. Es sind diese Philosophien, die von den ersteren lernen könnten, das nicht mehr zu tun, auch auf die Gefahr hin, dann eben nicht mehr „analytische Philosophie“, sondern eben nur noch: Philosophie zu sein. Und dieser Lernschritt würde sie vielleicht zu der Einsicht führen, dass die Frage danach, was die Vergangenheit „besser versteht“ als sie selbst, bei all ihrer Problematik ein notwendiger Schritt war, um sie in Zukunft nicht mehr stellen zu müssen – oder noch besser: sie anders stellen zu können.
Ohne sich selbst als Philosophie mit Adjektiv auszuweisen, ohne sich an Überzeugungen und Schulmeinungen zu klammern, könnte sie die Frage offener formulieren: Was kann die gegenwärtige Philosophie von ihrer eigenen Tradition lernen? Welche philosophischen Lektionen hat sie vergessen, weil sie sich selbst vor sich selbst verborgen hatte? Und die Antwort darauf könnte einen echten philosophischen Dialog ermöglichen: eine ganze Menge.
[1] Vgl. https://christophschuringa.medium.com/the-never-ending-death-of-analytic-philosophy-1507c4207f93
[2] Urs Schällibaum: Reflexivität und Verschiebung, Wien 2001, S. 25.
Dr. Daniel-Pascal Zorn ist Philosophischer Komparatist, Logiker und Lehrbeauftragter an der Bergischen Universität Wuppertal. Er forscht und lehrt dort zu Eugen Fink und zur Verbindung von phänomenologischer und spekulativer Philosophie. Als Philosophischer Komparatist ist „die Philosophiegeschichte“ für ihn selbstverständliche Voraussetzung seiner Arbeit. Letzte Veröffentlichungen: Logik für Demokraten (2017), Einführung in die Philosophie (2018), Shooting Stars. Philosophie zwischen Pop und Akademie (2019). Für das Frühjahr 2022 ist ein umfangreiches Buch zur sogenannten „Postmoderne“ geplant.
Martin Lenz ist Professor für Philosophie und Leiter des Departments für Geschichte der Philosophie an der Rijksuniversiteit Groningen. Seine historischen Spezialgebiete sind mittelalterliche und frühneuzeitliche Philosophie. Überdies ist er besonders an der Geschichte der analytischen Philosophie interessiert. Systematisch konzentriert er sich auf die Philosophie der Sprache und des Geistes sowie auf die Geschichts- und Sozialphilosophie. Zuletzt ist sein Aufsatz “Criticism and Silencing in Academia: The Ambivalent Role of Feedback” in Zoon Politikon erschienen. In Kürze wird sein Buch Socializing Minds: Intersubjectivity in Early Modern Philosophy bei Oxford University Press erscheinen. Auf seinem Blog Handling Ideas erscheinen regelmäßig Texte, Podcasts und gelegentlich Videos.