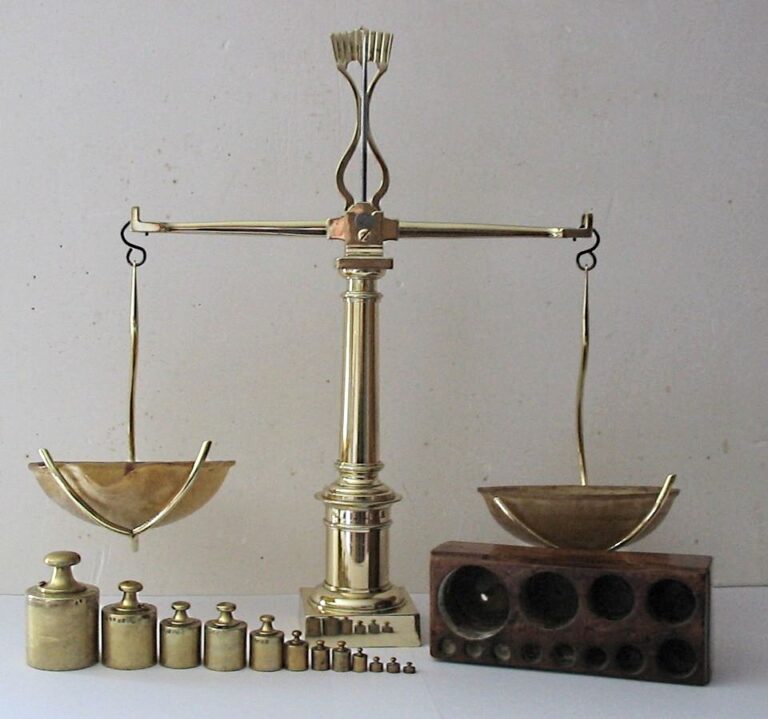Sharing is Caring? Pflegende Elternschaft zwischen Privatheitsverlust und politischem Aktivismus
Von Laura Hartmann-Wackers (Düsseldorf) –
Die Darstellung von Kindern auf Plattformen wie TikTok oder Instagram ist in den letzten Jahren verstärkt in die Kritik geraten. Familyblogger:innen und Momfluencer:innen wird, neben der Ausbeutung ihrer Kinder zu monetären Zwecken, vor allem auch die Verletzung der Privatsphäre ihrer Kinder vorgeworfen (siehe hierzu bspw. Karimi 2024 für Vorwürfe, die von den Kindern selbst erhoben werden, sowie den neuen Ratgeber des Deutschen Kinderhilfswerks 2025). Sei es das Abfilmen/Fotografieren der Kinder oder das Teilen persönlicher Stories, zu oft werden persönliche Informationen der Kinder in die Öffentlichkeit getragen. Viele Eltern berufen sich dabei auf das Argument, man wolle „das Leben mit Kindern so zeigen, wie es wirklich ist“ und sowohl die herausfordernden Aspekte von Elternschaft, wie auch ihre besonderen Freuden offen zeigen.
Was im ersten Moment wie eine einfache Abwehrstrategie wirkt – und in vielen Fällen sicherlich kein ausreichendes Argument für die Darstellung der eigenen Kinder ist, auch weil fraglich ist, inwieweit sich durch die Inszenierung auf Social Media-Plattformen ein authentisches Familienleben abbilden lässt – führt uns zu einer zentralen Frage des Privatheitsdiskurses: Hat der Schutz von Privatheit immer Vorrang vor anderen Gütern oder können diese gegeneinander abgewogen werden?
In der Idee, dass in der Veröffentlichung von persönlichen oder intimen Momenten ein Wert liegen kann, der größer ist, als das Zurückhalten dieser Momente, drückt sich eine Haltung aus, die den Wert von Privatheit zunächst einmal für verhandelbar hält. Diese Idee ist nicht neu und auch nicht unbegründet. Viele zentrale menschliche Erfahrungen werden erst möglich, wenn wir Privatheit aufgeben und uns für andere zugänglich machen. Sei es im zwischenmenschlichen Nahbereich in unseren Beziehungen, wo wir willentlich und wissentlich Informationen über uns preisgeben, um Vertrautheit und Nähe herzustellen. Oder in größeren gesellschaftlichen Kontexten, in denen wir uns in eine Öffentlichkeit begeben, um an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben und an diesen mitzuwirken. Es kann sehr gute Gründe geben, Privatheit aufzugeben. Auch weil nicht alle Erfahrungen im Privaten positiv sind. Ist unsere Privatheit auf der einen Seite notwendiger Schutz für zahlreiche Aspekte unseres Lebens wie unsere Selbstbestimmung oder intime Beziehungen (Rössler 2001), bietet sie auf der anderen Seite immer auch einen Nährboden für Grenzüberschreitungen oder Schädigungen, die außerhalb der öffentlichen Sichtbarkeit stattfinden. Häusliche Gewalt, Unterdrückung und Kindesmisshandlungen sind nur einige Beispiele für Schädigungen, die insbesondere im Privaten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden (Allen 1988).
Die feministische Kritik hat mit ihrem Ausspruch Das Private ist politisch auf diese Missstände hingewiesen und für eine differenzierte Betrachtung von Privatheit als vermeintlich unhintergehbares Gut plädiert. Nur wenn wir sowohl über die negativen wie auch positiven Aspekte von Privatheit sprechen, können wir sie adäquat erfassen und sinnvoll über ihren Wert und ihren Schutz sprechen. Strukturelle Ungleichheiten, Gewalt und Diskriminierung aufzudecken und aus dem Deckmantel des Privaten herauszuholen, muss deshalb ebenso Teil der Diskussion sein, wie Fragen nach rechtlicher Absicherung und den Gütern, die Privatheit schützt. Das gilt auch für die Privatheit von Familien. Die meisten von uns halten Eingriffe in die Privatheit einer Familie zum Schutz des Kindeswohles beispielsweise für gerechtfertigt. Das Recht von Eltern auf Privatheit kann nicht bedeuten, dass diese im Privaten mit ihren Kindern verfahren können, wie sie wollen. Das Recht auf physische und psychische Unversehrtheit der Kinder wiegt hier schwerer. Umgekehrt scheinen wir Eltern allerdings wenig Recht auf Selbstausdruck oder Öffentlichkeit zuzugestehen, wenn diese mit der Privatheit ihrer Kinder kollidieren. Wir erwarten, dass Eltern den Schutz der Privatheit ihrer Kinder über ihre eigenen Bedürfnisse stellen. Das liegt sicherlich vor allem darin begründet, dass Kinder in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Eltern stehen und in diesem besonders verletzlich sind. Kinder sind darauf angewiesen, dass ihre Eltern sie schützen – auch auf eigene Kosten. Dieser notwendige und richtige Grundsatz kann allerdings dazu führen, dass bestimmte Lebensrealitäten von Eltern gesellschaftlich unsichtbar bleiben. Insbesondere für viele Mütter ist die Elternschaft nicht (nur) die Erfüllung eines lang gehegten Traumes, sondern geht mit Einschnitten, Belastungen und Verlusten einher, die für sie vorher nicht absehbar waren. Unter anderem, weil diese Realitäten nicht öffentlich zugänglich waren. Dass dies mittlerweile anders ist, kann durchaus als ein Verdienst von Social Media gesehen werden.
Diese Lebensrealitäten abzubilden und öffentlich zu machen, bedeutet aber immer auch eine Güterabwägung: Was wiegt schwerer, das Recht des Kindes auf seine informationelle Privatheit oder das Bedürfnis der Eltern, strukturelle Ungleichheiten, Benachteiligungen und Schattenseiten von Elternschaft aufzudecken? Eine klar definierte Grenze, wo das Recht auf den eigenen Ausdruck endet und der Schutz der eigenen Kinder beginnen muss, sucht man dabei vergeblich. Ein Familienleben lässt sich nicht immer scharf in Informationen über Kinder und Informationen über Eltern trennen. Viele der Informationen, die wir für sensibel halten und unmittelbar mit unserer Identität und unserem eigenen (Er)Leben verknüpfen, sind ebenso sensible Informationen unserer intimen Nächsten. Eltern können nicht über die zermürbenden und herausfordernden Aspekte von Elternschaft sprechen, ohne über ihre Kinder zu sprechen. Mütter können nicht auf den Gender-Care-Gap aufmerksam machen, ohne zu benennen, was Carearbeit konkret ausmacht. Die Identität von Eltern ist unauflösbar mit der Existenz und dem Leben ihrer Kinder verknüpft. Sie können das eine nicht ohne das andere benennen.
Wenn Realitäten von Elternschaft gesellschaftlich lange ungesehen und unbeachtet blieben, so gilt das für die Lebensrealität pflegender Eltern ganz besonders. Die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der Versorgung kranker Kinder oder solcher mit Behinderung ergeben, führen allzu oft zu dem Verlust gesellschaftlicher Teilhabe auf verschiedensten Ebenen. Sowohl Kinder mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen als auch ihre Eltern werden gesellschaftlich zu wenig gesehen und mitgedacht. Wo nicht-pflegende Eltern noch die Möglichkeit haben, sich in Elterngruppen oder Spieletreffen vor Ort auszutauschen und über ihre Erfahrungen zu sprechen, bleiben pflegenden Eltern diese Optionen oft verwehrt. Weder die Standardangebote für junge Eltern noch die Betreuungsmöglichkeiten in Kindertagesstätten richten sich explizit an pflegende Eltern. Je nach Einschränkungen kann bereits die Teilnahme an einer Krabbelgruppe oder die regelmäßige und verlässliche Betreuung durch Fachpersonal eine unüberwindbare Hürde darstellen. Pflegende Eltern und ihre Kinder werden somit auch immer wieder ins Private verbannt, weil in öffentlichen Räumen kein Platz für sie ist oder diese schlicht und ergreifend nicht zugänglich sind.
Dabei handelt es sich nicht bloß um persönliche Tragik oder bedauernswerte Einzelfälle. Indem bestimmte Erfahrungen oder Gruppen in die Privatheit gezwungen werden, wird auch ein gesellschaftlicher Diskurs über diese Erfahrungen und mit diesen Gruppen erschwert bzw. unmöglich gemacht. Pflegenden Eltern werden wichtige Werkzeuge genommen, um auf gesellschaftliche und politische Lösungen für ihre Herausforderungen und Probleme hinzuarbeiten und ein gesellschaftliches Bewusstsein für ihre Lebensrealitäten und die ihrer Kinder zu schaffen. Der Austausch und das Sichtbarmachen ihrer Erfahrungen auf Social Media muss deshalb auch als ein Versuch gesehen werden, aus dieser erzwungenen Privatheit und politischer wie gesellschaftlicher Unsichtbarkeit herauszutreten, um für die eigenen Rechte und Bedürfnisse sowie die ihrer Kinder einzustehen. Pflegende Eltern haben oftmals gar keine andere Chance, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen und auszutauschen, als auf einen Onlineaustausch zurückzugreifen. Dabei bewegen sie sich allerdings auf einem schmalen Grat zwischen dem Kampf um Gleichberechtigung und Anerkennung und der Fürsorgepflicht für ihre Kinder, die auch deren Privatheitsschutz umfasst. Wie auch für nicht-pflegende Eltern gilt, dass pflegende Eltern nicht auf die Unzulänglichkeiten von Gesundheitsversorgung und Inklusion aufmerksam machen können, ohne nicht auch über ihre Kinder zu sprechen, denen diese Grundgüter verweigert werden. Ebenso wenig lassen sich Vorurteile und negative Stereotype über das Leben mit Kindern mit Behinderungen oder Erkrankungen abbauen, wenn die schönen und bereichernden Momente gesellschaftlich unsichtbar bleiben.
Hier eine allgemeine Lösung zu propagieren, scheint daher weder zielführend noch realistisch, was auch daran liegt, dass es sich bei Privatheit um ein relationales und kontextabhängiges Phänomen handelt (siehe dazu bspw. Nissenbaum 2010). Was in dem einen Kontext ein zulässiges und unproblematisches Teilen von Informationen ist, kann in einer anderen Beziehung eine Verletzung von Privatheit darstellen. Unsere Privatheit ist keine fixe Sphäre, sondern setzt sich aus einem Geflecht vielfältiger Beziehungen und Kontexte zusammen. Dennoch können wir auf bestimmte Aspekte verweisen, die eine Orientierung für den Umgang mit Informationen über die eigenen Kinder auf Sozialen Medien bieten können:
Selbstbestimmung: Wo möglich, sollten Kinder ein Mitspracherecht über die Inhalte haben, in denen sie thematisiert werden.
Anonymisierung: Klarnamen, Adressen von Wohnort, Schule oder Betreuungseinrichtungen sollten nicht bekannt gegeben werden. Foto- und Videoaufnahmen der Kinder sollten möglichst spärlich eingesetzt werden und bestimmten Grundprinzipien folgen: Verdeckung oder Unkenntlichmachung der Gesichter, keine Nacktaufnahmen/ausreichende Bekleidung, keine Fotos oder Videos von Situationen, die man selbst oder die eigenen Kinder als herabwürdigend, entblößend oder peinlich empfinden könnte(n).
Sensible Sprache und eigenes Erleben: In der Beschreibung des Alltags und der Herausforderungen, welche die Erkrankungen selbst oder die gesellschaftlichen Strukturen betreffen, sowie auch der persönlichen Glücksmomente, sollten Eltern vordergründig über ihre Erfahrungen sprechen, nicht über ihre Kinder. Wo sie über ihre Kinder sprechen müssen, um ihre Erfahrungen zu benennen, sollten sie wertschätzend, wohlwollend und rücksichtsvoll sein.
Auch unter Berücksichtigung dieser Aspekte sind eine Vielzahl verschiedener Äußerungen und Darstellungen möglich, die in den allermeisten Fällen eine individuelle Bewertung benötigen. So kann das Teilen der Diagnose eines Kindes in einem Fall eine moralisch relevante Verletzung seiner Privatheit darstellen, in einem anderen Fall aber möglicherweise eine notwendige Information sein, um das Erfahrene einzuordnen und zu benennen.
Wir müssen anerkennen, dass digitale Räume eine notwendige und wichtige Ressource für pflegende Eltern sind, die ihnen Austausch und Teilhabe ermöglichen. Auch wenn pflegende Eltern sich dafür entscheiden, ihre und damit auch die Privatheit ihrer Kinder in gewissen Hinsichten aufzugeben, sollten wir uns deshalb davor hüten, ihnen generell eine Vernachlässigung oder Verletzung der Privatsphäre ihrer Kinder vorzuwerfen. Gleichzeitig müssen aber auch pflegende Eltern immer mit bedenken, ab welchem Punkt das individuelle Wohlergehen ihrer Kinder und der Schutz ihrer Privatheit Vorrang vor dem eigenen Aktivismus und den eigenen Bedürfnissen haben muss.
Literatur:
Alig, Olivia (2021): https://www.bzkj.de/resource/blob/187302/d4d36492d4fd527cbafd76e13ae3ea05/20214-sharenting-mama-blogger-kinderinfluencer-data.pdf.
Allen, Anita L. (1988): Uneasy access: Privacy for women in a free society. Totowa and N.J: Rowman & Littlefield.
Deutsches Kinderhilfswerk e.v. (2025): Sharing is not Caring. Wie man die Privatsphäre von Kindern im Internet schützt. https://www.dkhw.de/informieren/unsere-themen/kinder-und-medien/kinderfotos-im-netz/.
Karimi, Faith (2024): The first social media babies are adults now. Some are pushing for laws to protect kids from their parents’ oversharing. https://edition.cnn.com/2024/05/29/us/social-media-children-influencers-cec.
Kutscher, Natalie (2021): https://www.bzkj.de/bzkj/service/publikationen/bpjmaktuell/kinderfotos-im-netz-sharenting-kinderrechte-undelternverantwortung-187310.
Nissenbaum, Helen (2010): Privacy in context. Technology, policy, and the integrity of social Life. Stanford: Stanford University Press.
Rössler, Beate (2001): Der Wert des Privaten. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Laura Hartmann-Wackers ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und hat zum Thema Privatheit und Demenz promoviert. Neben der Frage eines inklusiveren Privatheitsbegriffes liegen ihre Forschungsinteressen in der angewandten Ethik und der Medizinethik.
Dieser Blogbeitrag erscheint parallel in Kooperation mit dem Blog des Forschungsprojekts „DiversPrivat: Diversitätsgerechter Privatheitsschutz in digitalen Umgebungen“.