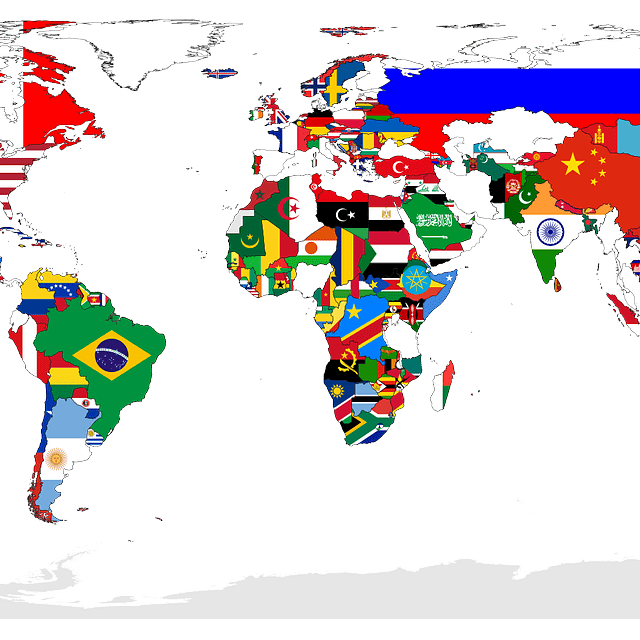
Staatliche Souveränität in der multipolaren Weltgemeinschaft
Von Max Gottschlich (KPU Linz)
Es gehört heute zum vornehmen Ton in der Einschätzung politischer Verhältnisse, die Rede von staatlicher Souveränität für gehaltlos anzusehen. Man verweist dazu auf die Evidenz allseitiger Abhängigkeitsverhältnisse sowie ökologischer, ökonomischer, gesundheitspolitischer und sicherheitspolitischer Herausforderungen, die nicht auf einzelstaatlicher Ebene bewältigbar sind. Das zunehmende Gewicht supranationaler Bezüglichkeiten lasse doch, so scheint es, keinen Raum mehr für Souveränitätspolitik. Damit wird konsequenterweise der Staat selbst in seinem Existenzrecht fraglich. So scheint der Staat – und zwar v.a. unter dem Vorzeichen eines bloß instrumentellen Staatsverständnisses –obsolet zu sein. Zweifellos: Beschränkte sich die Legitimation staatlicher Souveränität auf die Sicherung des Funktionierens der Gesellschaft, des Waren- und Kapitalverkehrs, dann hätte er ausgedient. Dazu ist nämlich kein Staat im Alleingang mehr in der Lage. Dazu kommen grundsätzlichere Vorbehalte: Sind staatliche Grenzen nicht Relikte der Geschichte wildgewordener Nationalgeister? Sollte an deren Stelle nicht eine globale Zivilgesellschaft treten, die den Naturzustand unter den Staaten beendet und allen Menschen die gleichen Realisierungschancen ihres pursuit of happiness ermöglicht, besorgt und behütet durch einen Weltstaat? Die bleibende Bedeutung des Staates und seiner Souveränität begreift sich erst, wenn der Staat als Wirklichkeit von Freiheit gedacht wird. Damit gerät das Vernünftige am Schritt in die Überstaatlichkeit nicht aus dem Blick.
Partikularer Resonanzraum der Freiheit
Souverän ist, machttechnisch betrachtet, derjenige, der das Recht in Geltung setzt. Souveränität, von der Freiheit her gedacht, besteht darin, dass der Staat die freie Subjektivität im Großen ist und sein soll. Dies in doppelter Weise: im Verhältnis des Staates zu seinen Bürgern und Institutionen sowie im Verhältnis zu anderen Staaten. Dies folgt nicht einer Logik der Unterwerfung, sondern einer Logik der Anerkennung.
Innere Souveränität bedeutet, dass der Staat in seiner institutionellen Gegliedertheit, die sich in der Verfassung artikuliert, ein bestimmtes, geschichtlich-kulturell vermitteltes Bewusstsein der Freiheit zu leben ermöglicht. Dies ist sein partikulares bonum commune. Der Staat ist innerlich dort souverän, wo er für die Dominanz des Politischen im Sinne der Gemeinwohlorientierung über die Partikularinteressen wirtschaftlicher Akteure sorgt.
Diese staatliche Macht verdankt sich aber einer Anerkennung. Die innere Souveränität ist wirklich, wenn der Staat in seiner institutionellen Gegliedertheit und der Tätigkeit seiner Institutionen im Bewusstsein der Bürger als Resonanzraum der Freiheit anerkannt ist. Dies bedeutet, dass der Bürger im Bewusstsein lebt, dass seine rechtlich und moralisch erreichte Freiheit vom Staat und seinen Institutionen getragen wird. Ohne dieses Entsprechungsbewusstsein wäre der Staat nur ein Name für organisierte Gewalt.
So gibt es ohne menschliche Gemeinschaft, ohne Staat als Garant eines bestimmten bonum commune keine wirkliche Freiheit des Einzelnen. Der Mensch hat nicht als abstrakt auf sich selbst bezogener Einzelner seine Existenz, sondern als Gesellschaftswesen. Nur so setzt und empfängt er seine Identität in einer bestimmten kulturellen Prägung. Umgekehrt lebt der Staat nur in seinem Anerkanntsein. Das ist kein Hurra-Patriotismus, sondern meint, dass man seine Steuern zahlt, überhaupt seine Partikularinteressen als Ich-AG mit Blick auf das Allgemeine mäßigt.
Die äußere Souveränität wurzelt in dem Willen zur Selbsterhaltung einer individuellen Totalität geistigen Lebens im Zeichen eines bestimmten Freiheitsbewusstseins. Das umfasst das Recht auf Integrität des staatlichen Territoriums, das Recht auf Erhaltung und Sicherung der inneren Souveränität gegenüber anderen Staaten bzw. Akteuren (im Sinne der „inneren Angelegenheiten“: nationaler gesetzlicher Willensbildung, der Gestaltung gesellschaftlichen Lebens usw.) und das Recht auf umfassende Selbstverteidigung. Ohne diese Selbstaffirmation eines allgemeinen, vernünftigen Willens, der sich nötigenfalls als Wehrwilligkeit artikuliert, gibt es keine äußere Souveränität. Bedeutet dies schon eine nationalistische Bornierung?
Abbau des Naturzustandes
Der neuzeitliche Staat verstand sich zunächst als suprema potestas, als Gewalt, die auf Erden nichts Höheres über sich anerkennt, unabhängig von der Bezüglichkeit auf andere Staaten. So befinden sich die Staaten zunächst im rechtsfreien Raum, in dem das Recht des Stärkeren gilt. Wo sie miteinander in Konflikt geraten, wird dieser durch den Krieg entschieden. Ist dieser Naturzustand aufhebbar, ohne dass man das Recht auf Souveränität der Staaten und damit die individuelle Staatlichkeit aufgibt?
Mit der Etablierung des (neuzeitlichen) Völkerrechts hat sich der Gedanke Bahn gebrochen, dass die äußere Souveränität nicht unmittelbar Funktion der eigenen wirtschaftlichen und militärischen Macht ist, sondern sich der Anerkennung der anderen Staaten verdankt. Die Souveränität des Staates nach außen beruhte auf der Gleichheit der Souveräne und ihrem Recht zum Krieg. Das Völkerrecht fordert aber bereits die wechselseitige Anerkennung als Selbständige, was sich im Kriegsrecht und der Hegung des Krieges sedimentiert.
Nun hat das Völkerrecht hinsichtlich seiner Verbindlichkeit Probleme: Erstens ist es in seiner Reichweite begrenzt in Hinblick auf den Willen jener Staaten, die als Garanten des Völkerrechts mächtig genug sind. Die völkerrechtlich handelnden Akteure sind immer auch durch die Partikularinteressen der Großmächte bestimmt. Zweitens sind Staaten stets Repräsentanten unterschiedlicher Freiheitsauffassungen, die einander mitunter exkludieren. Etwa: Sind die politischen Verhältnisse nach der Scharia zu gestalten oder nach dem Prinzip, auf dem der moderne Rechtsstaat beruht, nämlich dass der Mensch als Mensch frei ist – ein Prinzip, das nach Hegel mit dem Christentum in die Welt trat? Prallen diese Prinzipien aufeinander, so gibt es keinen übergeordneten Gerichtshof. Gäbe es ihn, könnte er nicht unparteiischer Richter sein. So steht die Rede von Grundrechten und die Errichtung eines Gerichtshofes für Menschenrechtsfragen auf dem Boden des Prinzips, dass der Mensch als Mensch frei ist. Der Anerkennungsgedanke im Völkerrecht bedeutet also keine Nivellierung der jeweils leitenden Freiheitsprinzipien der Akteure.
Ein weltgeschichtlicher Fortschritt war die Überwindung der auf sich fixierten Staatlichkeitim Sinne des Nationalismus seit der Erfahrung der beiden Weltkriege. Wir stehen heute vor der Aufgabe der Versittlichung des Verhältnisses der Staaten zueinander. Diese beruht auf der Einsicht, dass Staaten ihre Selbständigkeit nicht unmittelbar für sich, sondern nur in ihrer Bezüglichkeit auf andere Staaten haben können. Die Rede von Souveränität wird damit nicht gehaltlos. Denn für jeden Staat stellt sich die Aufgabe, diese Einheit von Selbständigkeit und Bezüglichkeit zu gestalten. Wie wollen wir unsere staatliche Selbständigkeit verstehen? Inwiefern haben wir eine gewisse Autarkie sicherzustellen und was nehmen wir dafür in Kauf? Wie wollen wir daher das System der Abhängigkeiten, in dem wir stehen, gestalten? Welche Abhängigkeiten akzeptieren wir aus wirtschaftlichen und politischen Gründen, welche sollten wir vermeiden?Souveränitätspolitik ist also nicht obsolet, sondern wir müssen uns vielmehr ausdrücklich bewusst machen, dass wir unsere Selbständigkeit in der Bezüglichkeit von bestimmten Prämissen im Freiheitsbegriff her laufend gestalten.
Gegen die nivellierende Logik des Marktes
Daran knüpft sich das Ringen um die Gestaltung unserer Souveränität. Wir erfahren die Härte der Abhängigkeit im globalen Wirtschafts- und Finanzwesen. Zwar etablieren sich durch die zunächst im Eigennutzen zentrierten Partikularinteressen der Akteure hindurch (rechtliche) Anerkennungsverhältnisse, die den Naturzustand negieren. Doch ohne politische Hegung dieses Komplexes entsteht nur ein vertraglich vermittelter Naturzustand. Ganze Staaten und Staatenbünde werden in ihren politischen Entscheidungen in die Geiselhaft von Partikularinteressen zur Erhaltung und Steigerung der Marktmacht genommen, zu Spielbällen im Kampf der Konzerne (man denke an die Effekte der Finanzkrisen für die staatliche Handlungsfähigkeit).
Dies evoziert einen staatenübergreifenden Willen zur Selbsterhaltung politischer Souveränität gegenüber der Verselbständigung des Marktes. Ein Weltstaat wäre nur der Nachtwächter, der dem Funktionieren der Maschinerie des Marktes dient – nicht jedoch Garant konkreter Freiheit und ihrer Lebensformen auch gegenüber der nivellierenden Tendenz des Marktes, die den Menschen als Bedürfnisträger und Konsumenten fasst. In der Anerkennung dessen, dass jeder Staat das Recht und die Pflicht hat, auf sein partikulares bonum commune im Rahmen eines globalen Wirtschaftens zu achten, ist die Anerkennung des Anderen nicht bloß formell-rechtlich, sondern sittlich. Das Bewusstsein eines solchen übernationalen Allgemeinwohls stärkt sich in gemeinsam durchlittenen Krisen.
Souveränitätspolitik mit geweitetem Horizont
In diesem Bewusstsein wird Souveränitätspolitik so gestaltet, dass in seinem Handeln der andere Staat (zumindest die geostrategisch relevanten) nie nur Mittel, sondern zugleich als Zweck (als Freiheitssubjekt) anerkannt ist. Eine wechselseitige Anerkennung auf der Ebene souveräner Staaten hat sich gegenwärtig in einer Vielzahl überstaatlicher Institutionen objektiviert. Die Mehrheit der Staaten der Welt hat den bewussten Schritt in die institutionelle Überstaatlichkeit und Anerkennung übergreifender Verbindlichkeiten vollzogen. Ihre Souveränität wird damit zu einer Souveränität innerhalb eines Staatenbundes. Der souveräne Staat gibt damit Teile seiner Souveränität in der Rechtssetzung und -sprechung ab.
Doch ebenso alternativlos ist es, das rechte Maß der Übertragung der Regelungskompetenz zu bestimmen (eine Frage, der sich die Mitgliedsstaaten der EU laufend stellen). Souveränität bedeutet somit das Recht der Partikularität als Ort konkret gelebter Freiheit. Es ist das Recht und die Pflicht des Staates, nicht in erster Linie für ein abstraktes Allgemeinwohl überhaupt, sondern für ein konkretes Allgemeinwohl zu sorgen (ein „Weltstaat“ würde diese Schwierigkeit nur in ein globales „Innen“ verschieben). In dieser Spannung stehen überstaatliche Institutionen und haben daran ihre Grenze. Denn diese können die Einschränkung selbstbezogener Interessen mächtiger (Mitglieds-)Staaten nicht erzwingen, ohne diese Staaten zugleich in Anspruch zu nehmen. Bleibt es damit beim Naturzustand zwischen den Staaten?
Der Kampf aller gegen alle ist an sich überwunden, wenn anerkannt ist, dass es die Aufgabe der Politik ist, einen Ausgleich zwischen dem Interesse am partikularen Gemeinwohl und den anzuerkennenden Aspekten eines überstaatlichen bonum commune zu finden. Dazu muss die Untrennbarkeit beider Seiten begriffen werden. Diese Integrationsleistung wird in ihrer Notwendigkeit laufend deutlicher: in der Mäßigung unseres Zugriffs auf die Natur als bloße Ressource und der Rückgewinnung der Hoheit des Politischen gegenüber der Abhängigkeit von der Macht globaler wirtschaftlicher Akteure. Die Einigung der OECD-Staaten auf eine globale Mindeststeuer, der sich auch Großkonzerne beugen müssen, ist ein Schritt in diese Richtung.
Moderne, über sich aufgeklärte Souveränitätspolitik hat sich um die Gestaltung der Einheit von Selbständigkeit in der Bezüglichkeit in Hinblick auf bestimmte, geschichtlich erreichte Freiheitsprinzipien zu bemühen. Für die Europäer sollte es außer Streit stehen, dass es dabei um die Erhaltung und Fortbildung jener Institutionen und Lebensformen geht, in welchen anerkannt ist, dass der Mensch als Mensch frei ist.
Max Gottschlich ist Mitglied des Strategie- und Sicherheitspolitischen Beirats der Wissenschaftskommission des Bundesministeriums für Landesverteidigung und lehrt am Institut für Praktische Philosophie/Ethik der Katholischen Privatuniversität Linz




